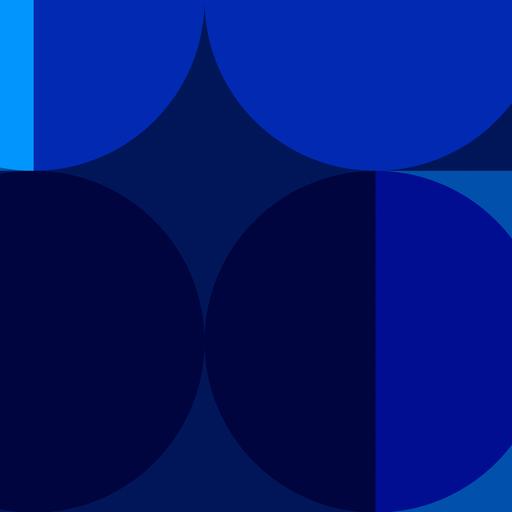Der Wunsch, Deutschland zu verlassen, sei damit endgültig vom Tisch gewesen. "Bauen, Bleiben, Dazugehören" habe sie ihre Rede damals überschrieben, sagte Charlotte Knobloch, die seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist. Nach Kriegsende sei der Wunsch da gewesen, Deutschland zu verlassen. Mit ihrem Mann Samuel habe sie eigentlich auswandern wollen. Dieses Thema sei aber mit der Geburt des zweiten Kindes erledigt gewesen.
Mit zehn Jahren kein Kind mehr
Charlotte Knobloch erlebte als Kind die Deportation ihrer Großmutter. Eine ehemalige Hausangestellte ihres Vaters brachte sie auf den Bauernhof ihrer katholischen Familie ins mittelfränkische Arberg und gab sie als uneheliches Kind aus. So überlebte sie den Holocaust. Der Aufenthalt auf dem Land war aber ganz anders als das bürgerliche Elternhaus. Durch ihre große Liebe zu Tieren habe sie es geschafft, sich anzupassen, erklärte sie. 1945 kehrte sie mit ihrem Vater nach München zurück.
Zeit der Zeitzeugen geht zu Ende
Charlotte Knobloch sieht eine große Aufgabe darin, das Wissen über die Vergangenheit Deutschlands zu vermitteln. Die Zeit der Zeitzeugen gehe zu Ende. Die Verbrechen Adolf Hitlers dürfe man aber mit Blick auf die Zukunft des Landes nie aus den Augen verlieren, betonte sie. Die jungen Menschen müssten wissen, in welchen Abgrund Deutschland sich gestürzt habe, und sie müssten sich der Verantwortung für die Zukunft bewusst sein. Notwendig sei Engagement für dieses Land, das stolz sein könne, in die Weltgemeinschaft aufgenommen worden zu sein.
Anti-Semitismus und Rechtsradikalismus treten offen zutage
Im Gegensatz zum Jahr 1985, als Charlotte Knobloch Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern wurde, seien heute Anti-Semitismus, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit offen spürbar. Damals sei das nur latent vorhanden gewesen. Enttäuscht ist sie vom Verhalten der muslimischen Gemeinden in Deutschland. Diese äußerten sich nicht zum Anti-Semitismus. Viele junge Muslime, die in Deutschland geboren seien, trügen einen offenen Judenhass in sich. Alle, die in Deutschland leben wollten, müssten auch die Werte dieses Landes leben, betonte Knobloch.
Zur Person:
Die Zeit des Nationalsozialismus überlebte das jüdische Mädchen bei einer katholischen Familie in Franken, die sie als ihr uneheliches Kind ausgab. Wer sich mit ihrem späteren Werdegang im Nachkriegsdeutschland befasst, erlebt eine Frau, die einhellig als charmant, spontan, glaubwürdig, aber auch als resolut beschrieben wird.1932 in München geboren, als Tochter des Rechtsanwalts und Senators Fritz Neuland, mit dem sie nach Krieg und Holocaust 1945 in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehrte. Dort heiratete sie 1951 den aus Krakau stammenden Kaufmann Samuel Knobloch. Drei gemeinsame Kinder folgten. In vielfältiger Weise engagiert sich Charlotte Knobloch national und international für jüdische Belange. So ist sie seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Von 1997 bis 2006 war Charlotte Knobloch zunächst Vizepräsidentin und danach bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Ehrenbürgerin Münchens, die unter anderem Trägerin des großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist, hat sich immer wieder vehement in Diskussionen über Probleme des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher religiöser und nationaler Herkunft eingemischt.
Die Zeit des Nationalsozialismus überlebte das jüdische Mädchen bei einer katholischen Familie in Franken, die sie als ihr uneheliches Kind ausgab. Wer sich mit ihrem späteren Werdegang im Nachkriegsdeutschland befasst, erlebt eine Frau, die einhellig als charmant, spontan, glaubwürdig, aber auch als resolut beschrieben wird.1932 in München geboren, als Tochter des Rechtsanwalts und Senators Fritz Neuland, mit dem sie nach Krieg und Holocaust 1945 in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehrte. Dort heiratete sie 1951 den aus Krakau stammenden Kaufmann Samuel Knobloch. Drei gemeinsame Kinder folgten. In vielfältiger Weise engagiert sich Charlotte Knobloch national und international für jüdische Belange. So ist sie seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Von 1997 bis 2006 war Charlotte Knobloch zunächst Vizepräsidentin und danach bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Ehrenbürgerin Münchens, die unter anderem Trägerin des großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist, hat sich immer wieder vehement in Diskussionen über Probleme des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher religiöser und nationaler Herkunft eingemischt.
Das Gespräch in voller Länge:
Charlotte Knobloch: Ich schätze das unter den großen Wundern, dass mein Vater und ich überlebt haben, die uns zuteilwurden.
Kindheit in München, frühe Erfahrungen von Ausgrenzung und Verlust, und immer ein gepackter Koffer.
Birgit Wentzien: Frau Knobloch, "eine hartnäckige Deutsche" hat ein Autor Sie einmal in einem Porträt genannt, und zwar war das unmittelbar vor der Wahl zur Vorsitzenden, der ersten Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das ist ein Kompliment oder eben auch kein Kompliment, hartnäckig. Sind Sie hartnäckig?
Knobloch: Ich bin hartnäckig, weil wenn ich eine Idee habe und die auch durchsetzen möchte, dann versuche ich in jeder Hinsicht alles, um das auch durchzuziehen. Aber natürlich, Hartnäckigkeit bedeutet für mich nicht, dass ich mich nicht auch mal hinsetzen kann und nachdenken kann über verschiedene Einsprüche gegen meine Hartnäckigkeit oder gegen das, was ich ausgesagt habe, um zu wissen, mache ich das richtig oder nicht.
Wentzien: Beharrlich haben Sie sich selber mal genannt. Beharrlich, durchsetzungsstark.
Knobloch: Ja, das ist das, was ich eben auch mehr oder weniger angemerkt habe, dass ich schon meine Ideen oder meine, wie soll ich sagen, meinen Weg gehen möchte, ohne dass ich da – vielleicht hat man das gemeint –, dass ich verschiedene Lösungen außerhalb gerne in Anspruch nehme. Das ist vielleicht das, was man mir etwas negativ nachsagt.
Wentzien: Oder charakterstark, kann man auch sagen.
Knobloch: Ja, gut, da müsste ich mich jetzt selbst loben, und das tu ich nicht!
Wentzien: Sehr gut! Daheim sind Sie in München, und zwar, wenn man Sie danach fragt, finde ich die Ortsangabe wunderbar: Sie sagen, ich wohne am Oktoberfest.
Knobloch: Genau so ist es!
Wentzien: Damit kann dann auch jeder was anfangen! "In Deutschland angekommen", Frau Knobloch, so lauten Ihre Erinnerungen, und Sie machen dieses Datum des Ankommens fest, sehr eindrücklich in Ihrem Buch, an einem Termin. Das ist der 9. November 2006. Sie sagen, von diesem Tag, das sei "der wichtigste Tag in meinem Leben".
Knobloch: Dieser Tag war ein Tag, der meine Träume, die ich hatte, die ich dann natürlich auch an die Öffentlichkeit gebracht habe, mit dem Wunsch, den ich auch weiter beharrlich durchgesetzt habe, in München eine Hauptsynagoge in Erinnerung an die ehemalige Hauptsynagoge zu bauen, ein jüdisches Museum, um der Welt zu zeigen, die ein Museum auch besucht, was das Judentum in Deutschland geleistet hat – das war mir sehr wichtig –, und ein Gemeindezentrum, das alle Institutionen, die eine jüdische Gemeinde benötigt, darin unterbringen kann. Das hat sich zu diesem Datum bewahrheitet. Darauf war meine Reaktion in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ich habe meine Koffer ausgepackt. Meine Koffer auspacken heißt, dass viele Koffer jahrzehntelang gut aufbewahrt waren im Keller und dass der Wunsch, Deutschland zu verlassen, das Anfang der Jahre nach Kriegsende natürlich ein wichtiges Thema für uns war, dass das zu Ende war, dass diese Gedanken jetzt, nachdem ich gesehen habe, das Judentum kann hier eine Zukunft aufbauen, das Judentum hat Zukunft, das Judentum wird, was ich mir immer gewünscht habe, nicht in einem Nebeneinander leben, sondern in einem Miteinander, dieses Land für die weitere Zukunft aufzubauen. Das sind alles Themen, die man nicht gedacht hat, dass sie sich bewahrheiten. München hatte diese Chance, wo ich jedes mal denjenigen zu danken habe, die mich da vehement unterstützt haben. Das war der damalige Oberbürgermeister in München, der dieses Thema zur Chefsache machte, und da war für mich sehr, sehr wichtig, dass er, wir auch das unsere dazu tun, dass die Gemeinsamkeit, die ich mir immer gewünscht habe mit meinem Umfeld, mit der nichtjüdischen Bevölkerung, dass die sich jetzt so darstellt, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen können.

Wentzien: Hin zu diesem Tag, in dieser Nacht vor diesem 9. November haben Sie wenig geschlafen. Sie sind, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, noch mal aufgestanden und haben am Manuskript gefeilt, haben Sie noch mal überlegt, was wollen Sie morgen wirklich sagen an dem Tag dann selber und haben an den Rand des Manuskripts – und das waren dann auch die eindrücklichen Passagen der Rede am nächsten Tag – geschrieben, "bauen, bleiben, dazugehören, Herz Münchens". Wenn man das rekapituliert und an Ihrer Geschichte reibt, Frau Knobloch, und Sie dann auch noch mal zitieren darf, nämlich mit den Worten "entgegen der Pläne der Nazis habe ich dank mutiger Menschen den Holocaust überlebt. Ich habe Liebe und Geborgenheit zurückerobert, auch die Liebe zu meinem Vaterland und das Vertrauen in die Menschen." Dann müssen wir über Ihre Kindheit sprechen und über eine Zeit, wo weder Bauen noch Bleiben noch Dazugehören noch im Herzen Münchens möglich waren. Wie haben Sie überlebt als Kind in diesem Land?
Knobloch: Ich bin in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen, in sie hineingeboren. Das kann sich niemand aussuchen, wo er hineingeboren wird. Für mich waren die ersten Jahre meines Lebens – nicht für meinen Vater, aber für mich –, sicherlich gehören die zu den glücklichsten in meinem Leben. Mir war es sicher zur damaligen Zeit nicht bewusst, welche Schrecken mein Vater durchgemacht hat. Das er hat er mir aber dann später erzählt, als er wusste – ich bin drei Monate vor der Machtergreifung geboren –, dass das jüdische Leben in Deutschland keine Zukunft mehr haben wird. Da hat er recht gehabt zur damaligen Zeit schon. So ist für mich das Wort Jude nie ein Thema gewesen. Ich kannte das Wort nicht und habe das zum ersten Mal erfahren, als man mir gesagt hat, ich darf nicht mehr als Judenkind mit den Nachbarskindern spielen, weil das möchte man nicht. Für mich war dieses Wort vollkommen unbekannt, bin dann natürlich weinend zu meiner Großmutter, die damals schon Mutterstelle an mir vertreten hat, zurückgelaufen und habe sie gleich gefragt, was das Wort Jude ist, und sie war natürlich sehr entsetzt. Das wusste sie auch nicht, dass ich jetzt damit konfrontiert wurde. Sie versuchte, das mir dann in irgendeiner Form zu erzählen. Wir haben in der Nähe einer Kirche gewohnt: Es gibt Leute, die gehen in die Kirche, wir gehen in die Synagoge. Sie wollte das irgendwie nicht in der Form auf mich eindringen lassen, wie ich jetzt total zerstört vor ihr stand und nicht verstanden habe, warum ich als Judenkind nicht mehr mit den Nachbarkindern spielen durfte. Das hat sich natürlich dann auch noch weiter ergeben, dass meine Klavierlehrerin – mein Vater kam aus Bayreuth und war ein Musikliebhaber, ein Wagnerverehrer, wollte natürlich, dass ich auch ein Instrument lerne, das war dann noch der Fall –, und dann kam meine Klavierlehrerin weinend zu uns in die Wohnung und sagte, sie würde auf die Gestapo, die Geheime Staatspolizei gerufen, und man hat ihr untersagt, weiterhin ein Judenkind zu unterrichten, sonst wüsste sie, welche Erfahrungen sie machen wird, so in diesem Slogan. Wir sind natürlich dann damals davon ausgegangen, dass wir vom Haus aus denunziert wurden, weil wer wusste sonst, dass ich Klavierunterricht habe. Jedenfalls diese Themen haben mich zum ersten Mal damit berührt und haben mir zur Kenntnis gebracht, dass wir etwas anderes sind. Die Ausgrenzung als solche und die Diffamierung, die hat man dann in späteren Jahren, im Laufe der Jahre auch persönlich erlebt. Im Treppenhaus wurde ich angespuckt – früher wurde mir gedankt, wenn ich guten Morgen oder Grüß Gott gesagt habe, dann kamen solche Reaktionen, oder man gab mir irgendeinen kleinen Schubs oder irgendwas. Jedenfalls, ich habe erlebt, dass wir nicht dazugehören, was ich die ersten Jahre dieses Lebens, wo ich mich auch noch zurückerinnern kann, nie gesehen habe und erst dann durch diese Vorfälle gewusst habe, dass die uns mehr oder weniger zeigen, dass wir irgendetwas sehr Negatives sind.
Wentzien: Was macht das, wenn Sie sich erinnern, mit einem Kind? Sie waren sechs Jahre an der Hand Ihres Vaters, sind quasi 1938 auf der Flucht durch die Stadt. Es kamen dann auch lichtere Momente: Eine Frau, die – als Ihr Vater dann abgeholt wurde – Sie an den Kinderwagen nahm und als an Kindes statt mitnahm. Sie waren zehn und sagen, "damals zu diesem Zeitpunkt war meine Kindheit zu Ende". Ihr Vater hat Sie aufs Land gebracht, weil er sich auch nicht mehr zu helfen wusste. Was macht das mit dem Kind Charlotte Knobloch?
Knobloch: Diese Charlotte Knobloch damals mit zehn Jahren war kein Kind mehr in der üblichen Form eines Kindes. Wie gesagt, sie wusste – und es wurde ihr auch immer gesagt –, dass sie sich, wenn sie auf die Straße geht und sie sieht die uniformierten Männer, sie soll, auch wenn sie an der Hand geht von unserer Haushälterin, die damals dann auch nicht mehr bei uns arbeiten durfte, dass sie sofort auf die Fahrbahn gehen sollten, also dass wir nicht aufhalten sollten. Das war das Leben, was mich dazu geführt hat, dass ich keine kindlichen Überlegungen mehr hatte und – die Fahrt in die große Unbekannte, weil ich wusste nicht, wo ich hinfahren werde – das für mich eine große Erleichterung war, damals auch noch gehofft habe, dass vielleicht mein Vater bei mir bleibt. Das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, nachdem wir nach einer Zugfahrt, wo wir nicht kontrolliert wurden, Gott sei Dank – ich war allein im Abteil, mein Vater war in einem anderen Abteil –, und er hat mir immer gesagt, wenn ich sehe, dass an der Haltestelle Uniformierte einsteigen, soll ich sofort aussteigen und im Bahnhof auf ihn warten. Ich habe ihn nach 45 gefragt, was hast du dir eigentlich vorgestellt, ich soll im Bahnhof auf dich warten. Wenn sie dich erwischt hätten, hätte ich gar nicht im Bahnhof auf dich warten können, ich hätte dich gar nicht erwarten können. Da hat er mir immer gesagt, er wusste es selbst nicht. Er hat einfach gehofft, dass mir irgendjemand hilft. Dort angekommen –
Wentzien: Das war in Gunzenhausen?
Knobloch: Das war in der Nähe, 12 Kilometer entfernt von Gunzenhausen. Dort angekommen war das natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Kann man auch mit den heutigen Aufenthalten auf dem Land gar nicht vergleichen. Es war eine ärmere Gegend, wo die Leute gelebt haben. Nachdem mein Vater ihnen natürlich schon die Tatsache, die sie nicht wussten, warum ich gekommen bin, erklärt hatte und er sie bittet, doch mich wenigstens für einige Zeit aufzunehmen, haben sie sich dann zu einem Familienrat zurückgezogen, haben die gesagt, das machen sie, und er meinte dann auch, wenn sie einen Weg finden, mich ganz zu behalten, wäre das natürlich für mich die größte Chance, die ich vielleicht im Leben habe. Er hat sich dann verabschiedet, und diese Verabschiedung war für mich … Das war das zweite Mal, dass ich mich von einem Menschen verabschieden musste. Zuerst von meiner Großmutter, die deportiert wurde, und dann von ihm, wo ich nicht gedacht habe, dass ich sie lebend wiedersehe, und ich alleine in einer fremden Umgebung, in einer fremden Kultur muss man schon sagen, die ich natürlich durch meine bürgerliche Erziehung nicht gewöhnt war und mich da zurechtfinden musste. Ich habe es aufgrund der großen Liebe zu Tieren geschafft, mich dort wohlzufühlen, sodass nach 45 der Wunsch in mir hochkam, nie mehr nach München zurückzukehren, um nicht all die Leute wiederzutreffen, die uns eine solche Behandlung, wie ich sie teilweise geschildert habe, zugedacht und auch durchgeführt haben. Die Leute, die mich aufgenommen haben, wussten auch noch nicht momentan, was sie mit mir anfangen sollten und wie sie das händeln sollten, aber da hat die Dorfbevölkerung das ihrige dazu getan. Ich schätze, dass unter den großen Wundern, dass mein Vater und ich überlebt haben, die uns zuteilwurden, weil es ist einfach nicht nachzuvollziehen, dass eine Dorfgemeinschaft, die mich gesehen haben, sofort mich in einen Zusammenhang gebracht haben – der Fehltritt meiner Beschützerin, die aus Nürnberg kam, ich kannte sie durch meinen Onkel – und gedacht haben, ich bin ihr außereheliches Kind. Sie ist zwar bekannt als sehr fromme, sehr religiöse Katholikin, und das war natürlich für die Dorfbevölkerung eine sehr interessante Diskussion, dass gerade sie einen Bankert mitbringt – so wurde ich dann hinter meinem Rücken genannt.

Wentzien: Das war und ist die Rettung im Land der Mörder, die Sie gerade beschrieben haben. Frau Knobloch, war irgendwann mal die Rede davon, mit Ihrer Großmutter, mit Ihrem Vater, dass Sie das Land verlassen? War irgendwann mal ernsthaft erwogen worden, dass Sie gehen? Ihr Onkel, den Sie gerade benannt haben, der war bereits in den Vereinigten Staaten. Wurde ernsthaft das erwogen, aus dem Land zu gehen und das Land zu verlassen?
Knobloch: Mein Onkel hat alles getan, um seinen Bruder, seine Mutter und auch mich in die Vereinigten Staaten zu holen. Er hat ein Affidavit bekommen, aber nicht für seine Mutter, die war für die Aufnahme in die Vereinigten Staaten zu alt, sodass mein Vater natürlich den Beschluss gefasst hat, seine Mutter nicht allein zu lassen, seine und meine Einreise also abgelehnt hat. Das ist natürlich ein Thema, das ich heute immer wieder mit den ganzen Flüchtlingsthemen in meinen Erinnerungen an vorderster Front habe, dass es auch damals schon Länder gegeben hat – das waren nicht nur die Vereinigten Staaten, es gab auch andere Staaten –, die sich geweigert haben, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen und dass die Menschen halt so sind, wie sie sind, ganz egal, ob sie Politiker sind oder Straßenkehrer.
Wentzien: Samuel Knobloch und Sie haben dann in München gelebt und haben auch zwischendurch erwogen, die Koffer aus dem Keller zu holen und zu packen und zu gehen, aber Sie sind dann auch nicht gegangen.
Knobloch: Nein, wir haben sogar gleich, nachdem … Ich habe meinen Mann 1948 kennengelernt. Ich habe in der Zeit zwischen '45 und '48 meinem Vater keine Ruhe gegeben, zu meinem Onkel nach Amerika auszuwandern. Das war von mir ein Wunsch, weil ich die Leute alle gesehen habe. Die waren ja nicht verschwunden, die waren ja alle da, haben zwar ihre Meinung dann 100 Prozent geändert, haben sie gesagt, aber es war eine sehr ungute Situation für Opfer wie für Täter oder für diejenigen, die die Täter unterstützt haben. Als ich meinen Mann kennenlernte, der auch schon seine Auswanderung betrieben hat und wir dann heirateten, dann waren wir sehr interessiert, sofort in die Vereinigten Staaten auszuwandern, haben alle Voraussetzungen geschaffen. Erst als sich dann das erste Kind angemeldet habe, haben wir den Beschluss gefasst, dass wir abwarten. In ein fremdes Land ohne Sprache mit einem kleinen Kind, das war doch für uns zu gefährlich, und dann hat sich das zweite Kind angemeldet, und damit war das Thema erledigt, aber die Koffer waren da! Wir versuchten, uns eine Zukunft aufzubauen, aber immer auch mit dem Hintergedanken, vielleicht doch mal den Schritt zu wagen, weil es gab auch in den Nachkriegszeiten Themen, die uns an diese Vergangenheit, die wir erlebt haben, sehr gut erinnerten.
Knobloch: Dieser Adolf Hitler, der nie ein Wahnsinniger war, sondern ein Verbrecher, den darf man in Hinblick auf die Zukunft in unserem Land nie aus den Augen lassen.
An der Spitze des Zentralrats der Juden, streitbare Übergangslösungen, kein Verharren in der Vergangenheit, und die Jugend im Blick.
Wentzien: Wenn wir jetzt Charlotte Knobloch im Gefüge des Zentralrats der Juden sehen und ihre Geschichte bedenken, dann ist für mich ganz entscheidend, dass Sie sich selber nicht als Mahnerin sehen. Sie sagen, nein, das bin ich nicht, ich bin eine Verteidigerin, und mahnen will ich nicht, sondern ich will herausfordern. Ich würde jetzt ergänzen, beharrlich herausfordern. Frau Knobloch, als Sie gewählt wurden, haben Sie damals gesagt, ich bin eine Übergangslösung, denn nach mir sollen auch jüngere Generationen kommen. Warum waren Sie da, wenn ich das als Frau sagen darf zu Charlotte Knobloch als Frau, so bescheiden? Das hat vor Ihnen niemand gesagt und auch kein Mann nach Ihnen auf diesem Posten. Warum haben Sie sich selber als Übergangslösung gesehen?
Knobloch: Wissen Sie, ich habe in meiner ganzen politischen Karriere nie den Ehrgeiz gehabt, eine Führungsposition zu übernehmen. Das war bereits 1985, als ich zur Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde München gewählt wurde, das habe ich nie angestrebt und bin dann also gefragt worden und habe dann zugesagt. Ich bin gerne tätig, ich arbeite gerne, ich helfe Menschen gerne, aber dass ich die Top-Positionen angestrebt hätte, dass das in meiner Zukunft gelegen wäre, das war nie mein Fall. Als man mich auch damals fragte, ob ich die Position im Zentralrat übernehmen würde, habe ich mir auch gedacht, na gut, momentan ist vielleicht das noch das Beste, ich bin noch eine der letzten, die die furchtbare Zeit erlebt haben, aber dann soll die Jugend nachkommen, sollen die neuen Generationen nachkommen, und das war dann auch der Fall, es hat sich dann auch jemand gefunden. Damit war das Thema für mich erledigt. Ich habe mich da schon von Anfang an als Übergangslösung gesehen. Man muss natürlich auch das Alter ansprechen.
Wentzien: Dieter Graumann, Ihr Nachfolger im Amt als erster Vorsitzender hat gesagt: "Wir müssen auch ein Stück heraus aus der Nische des Holocausts und mitten hinein ins Leben, wir Juden dürfen uns nicht über die Opferrolle definieren, und wir dürfen uns nicht reduzieren lassen auf eine trübsinnige Trauergemeinschaft, auf eine düstere Opfergemeinschaft, das wäre ganz und gar verkehrt." Ist das ein Ziel aus Ihrer Sicht, und ist Graumann und Nachfolgern das gelungen? Was meinen Sie?
Knobloch: Schauen Sie, da bin ich eigentlich, nur anders ausgedrückt, mit Dieter Graumann einer Meinung gewesen und heute noch. Ich habe immer gesagt, wir Juden in Deutschland dürfen uns nicht über den Holocaust definieren. Das war immer mein Credo sozusagen, der hat auch nichts anderes gesagt, aber wir können und wir dürfen uns aber auch nicht aus der Vergangenheit lösen. Das dürfen wir nicht tun, schon in Hinblick auf die vielen Menschen, die diese grauenvolle Zeit nicht überlebt haben, auf die vielen, vielen Opfer nicht nur auf jüdischer Seite, sondern dieser Adolf Hitler, der nie ein Wahnsinniger war, sondern ein Verbrecher, den darf man im Hinblick auf die Zukunft in unserem Land nie aus den Augen lassen und nie aus den Köpfen vertreiben, sondern wir müssen und sollen mit der Vergangenheit auch leben. Nicht, dass sie uns täglich belastet, weil Vergangenheit kann belastend sein, und das ist auch belastend, was wir erlebt haben, aber wir müssen an unsere Zukunft denken, wir müssen an die jungen Menschen denken, die heutzutage sehr interessiert sind an der Vergangenheit in unserem Land, denen aber auch gesagt werden muss – und das war eine Zeit lang nicht der Fall und darum waren da große Diskrepanzen zwischen jungen Menschen und den Älteren. Sie haben die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, sie sind aber frei von Schuld, aber sie müssen aufgefordert werden, eben diese Zukunft so zu gestalten, dass das, was passiert ist, dass man nie geglaubt hätte, dass so ein kultiviertes Land wie Deutschland sich so in der Mehrheit als Mörder nicht nur bezeichnen konnte, sondern das auch durchgeführt haben. Dass dieses Land sich in einen solchen Abgrund gestürzt hat, das müssen die jungen Menschen wissen, damit sie stark genug sind, verschiedenen Tendenzen entgegenzusteuern, damit diese oder andere Dinge nicht mehr auf dieses Land zukommen und dieses Land wieder in einer Form darstellen, das es nicht verdient hat. Ich bin heute noch der Ansicht und denke darüber nach, was Menschen Menschen antun können, dass es doch unverständlich ist, dass man den Nachbarn plötzlich nicht nur als Fremden, sondern als Auswurf bezeichnet hatte, als nicht mehr akzeptablen Menschen, der jahrelang mit dir zusammengelebt hat. Das sind Dinge und das sind Themen, die die jungen Menschen, die unsere Zukunft auch dann gestalten, wissen müssen, damit diese Vorkommnisse in der Vergangenheit bleiben und nicht mehr in der Zukunft auf dieses Land zukommen.

Wentzien: Sie machen sich auch ungeheuer viele Gedanken über die Vermittlung dieses Wissens, wie man zum Beispiel künftige Generationen erreicht. Sie machen sich ganz viele Gedanken darüber, wie man auch neue möglicherweise Gesprächsrunden findet oder Gesprächsformate. Ich würde Sie auch gerne danach fragen, weil Sie so viel auch in Schulen unterwegs sind, weil Sie sich umtun: Brauchen wir, wenn Sie an die nächsten Generationen denken, neue oder andere Zugänge? Ich möchte das illustrieren mit einem Beispiel: Peter Steinbach, der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte deutscher Widerstand, sagt, Jugendliche heute, wenn sie zum Beispiel Bilder sehen von Schutzhaftlagern oder anderen, haben andere Assoziationen als vorherige Generationen, kommen möglicherweise in der Jetztzeit eher auf Guantanamo als auf Konzentrationslager. Wie geht man jetzt mit diesen Generationen um, und wie vermittelt man ihnen diese so wesentliche Geschichte dieses Landes?
Knobloch: Das ist ein großes Thema, das mich auch belastet. Die Zeit der Zeitzeugen, die noch aus ihrem eigenen Erleben erzählen können, die geht dem Ende zu – das müssen wir ganz klar sehen –, sodass wir heutzutage an die jungen Menschen den Stab der Erinnerung weitergeben müssen, den Stab des Gedenkens. Das ist natürlich etwas schwierig, wenn du die Geschichte nur lesen oder von dem Gelesenen auch hören kannst und nicht gewisse Fragen stellen kannst, die dir das beweisen. Wenn ich heute ein junger Mensch bin, das merke ich doch, wenn ich da in Schulen bin, und die Fragen, die an mich gestellt werden, wo die jungen Menschen sich dann überlegen können, das ist etwas, dem ich mich zuwenden kann. Ich sage immer, ihr müsst nicht die Vergangenheit und das Gedenken täglich mit euch rumtragen, aber ihr müsst euch engagieren für euer Land. Ihr lebt in einem Land, dem ihr dankbar sein müsst. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch heute gar nicht vorstellen, wie das war, als eure Großväter oder Großmütter oder wer auch immer dieses Land vorgefunden haben nach diesem Vernichtungskrieg, den dieser Hitler angezettelt und auch durchgeführt hat, dass dieses Land zerbrochen war. Das war am Boden gelegen, es war in Trümmern, man hat dem Land nie mehr eine Zukunft zugetraut, und schaut mal, wo ihr heute lebt, wo ihr stolz sein könnt auf dieses Land. Es ist mit aufgenommen worden in die Weltgemeinschaft, es wird respektiert. Das war jahrelang nicht der Fall. Es ist heute vorhanden, führt das weiter, macht das, meldet euch, geht in die Politik und arbeitet für dieses Land. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Es ist so mein Ausdruck, wenn ich sie so dastehen sehe und sie schauen mich so an, dass ich sie in die Verantwortung nehme, dass sie nicht nur ihr Land kritisieren, sondern dass sie auch, wenn sie Kritik haben, auch Alternativlösungen vorbringen. Sie sind heute alle sehr gebildet, sie sind gescheit. Ich meine, ich freue mich: Ich habe Vergleiche von jungen Menschen vor 20 Jahren und heutzutage. Das ist ein großer Unterschied.
Wentzien: Was hat sich geändert, was macht es aus? Kommen da andere Fragen auf Sie zu?
Knobloch: Vorher sind gelangweilt drin gesessen, haben auf die Uhr geschaut, haben teilweise geschlafen und waren froh, dass der Pflichtunterricht vorbei war. Jetzt sind sie gut vorbereitet. Man merkt, sie sind interessiert. Sie wollen die Geschichte kennenlernen. Ich kann, Gott sei Dank, Positives berichten aus meiner Geschichte. Das Überleben bei mir ist, Gott sei Dank, positiv. Ich kann ihnen auch zeigen, es hat auch andere Menschen gegeben, aber ich habe natürlich auch Verschiedenes erlebt, wo ich ihnen auch Mitteilungen machen kann, wie die Menschen sich damals dargestellt haben. Da sehe ich, sie sind heute viel gebildeter und viel interessierter an der Vergangenheit dieses Landes, sodass ich auch hoffe, dass sie die Verantwortung dann auch für die Zukunft übernehmen.
Wentzien: Sie haben immer gesagt, ich bin keine Politikerin, ich bin nicht als Politikerin geboren, aber man wächst – haben Sie auch immer gesagt – an seinen Aufgaben.
Knobloch: Stimmt!
Wentzien: Und Sie wollen allen nur raten, wenn man so öffentliche Ämter übernimmt, solle man sich ja nicht vom Imponiergehabe ins Bockshorn jagen lassen. Wenn Sie Ihre Aufgaben seither mit diesen vielen Aufgaben, Repräsentanz, dann auch Aufreger und Anreger als Zentralratschefin, immer wieder Botschafterin, Augenzeugin, Zeitzeugin in Schulen, wenn Sie all diese Aufgaben rekapitulieren und im Nachgang anschauen, haben Sie das alles in der Wucht so erwartet, wie das auf Sie eingeprasselt ist mit der Übernahme dieses Postens damals als Vorsitzende des Zentralrats?
Knobloch: Gut, ich meine, ich war schon lange Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in München, auch da schon im Zentralrat tätig. Also die Wucht als solche, die habe ich durch meine damaligen Tätigkeiten schon gekannt. Die Themen, die ich heute sehe, sind noch viel dramatischer als damals. Ich meine, ich bin eine Kämpferin, habe damals auch schon mich dementsprechend zu Wort gemeldet, was ich auch heute tue, nur heute ist es noch viel drastischer als damals. Wir sind heute in einer ganz anderen Situation. Der Antisemitismus, Rechtsradikalismus, die Fremdenfeindlichkeit, die sind heute an der Tagesordnung, und zu meinen Zeiten war das noch etwas im Hintergrund. Es war vorhanden, also der latente Antisemitismus war auch damals schon vorhanden, aber heute wird er offen ausgesprochen, was damals noch nicht der Fall war. Ich bin sehr bestürzt, muss ich sagen, wenn ich sehe, wie heute die Justiz verschiedene Themen behandelt und jeder sich auf Gesetze beruft, die natürlich demokratischen Hintergrund haben, aber trotzdem in verschiedenen Bereichen doch nicht in der Form angewendet werden müssen, dass also die Versammlungsfreiheit und all die Erleichterungen, die eine Demokratie mit sich bringen kann, dass die in verschiedenen Bereichen doch nicht anwendungsfähig sind, die Gesetze dafür meine ich.
Knobloch: Man muss beides einbinden in das Leben in ihrer neuen Heimat, aber es immer wieder auch verbinden mit der alten Heimat, damit sie sich nicht so fremd fühlen. Das Fremdsein ist ein Thema, das man nicht aufkommen lassen darf.
Helfen, anzukommen: Die Integration jüdischer Zuwanderer, neue Herausforderungen mit Ankommenden, der Antisemitismus, und alte Dämonen.
Wentzien: Charlotte Knobloch in München hat sich vor allen Dingen auch, und dann auf Bundesebene, eingesetzt für die Integration der jüdischen Zuwanderer der Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Diese Aufgabe ist eine immense Aufgabe, die ist auch noch nicht zu Ende. Sie wünschen sich, dass aus diesem Miteinander auch Normalität wird, aber man kann beobachten, dass die jüdischen Gemeinden dadurch eine ungeheure Frische bekommen haben, einen Zuwachs auch bekommen haben. Eine Aufgabe immenser Art war, möglicherweise war es auch eine doppelte, nämlich eine Integration ins Judentum, aber auch eine Integration nach Deutschland, weil viele von diesen Kontingentflüchtlingen lernten ihren Glauben erst hier auch kennen, der ihnen die Ausreise ermöglichte. Wenn Sie diese kleine Aufgabe – und gleich kommen wir auf die Gegenwart dieses Landes und die Zukunft zu sprechen – mal nehmen, Frau Knobloch, wäre das ein Muster für die Integration von Flüchtlingen möglicherweise heutzutage?
Knobloch: Ich sehe, es wird doch nicht in allen Bereichen aus dem Vergangenen Lehren gezogen. Wir sind in dieselbe Situation gekommen wie heute die Regierungen sind. Wir waren total überrascht, wir hatten keine Infrastruktur, wir hatten keine Ordnungsmöglichkeiten, die Leute waren da, sie haben darauf gepocht, sie sind Eingeladene geworden. Es war damals dieselbe Situation.
Wentzien: Aber überraschend, beileibe.
Knobloch: Überraschend, ja, für uns total überraschend, und wir haben uns zusammengenommen, muss ich schon sagen, um vor allem den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie hier herzlich willkommen sind. Also alles Dinge, die man in der heutigen Zeit hier auch erlebt hat und auch noch wahrscheinlich erleben wird. Wir hatten auch dieselben Sprachprobleme. Es war alles in kleinerem Format und in Kleinstformat gegenüber den Zahlen, mit denen man heute zu tun hat, vorhanden, und wir haben zusammen dann auch – am Anfang war das nicht der Fall, weil es waren ja alle überrascht –, wir haben dann auch zusammen mit der öffentlichen Hand versucht, die Menschen gewissermaßen ordentlich unterzubringen. Es war damals dieselbe Wohnungsnot wie heute, sie lebten auch in Containern. Es ist so ähnlich. Das persönliche Engagement und die Möglichkeiten auch, sich mit den Menschen und den Problemen auseinanderzusetzen, die haben wir dann in die Hand genommen. Ich glaube, es ist uns gelungen dadurch auch – und es ist sehr, sehr wichtig, das habe ich gesehen: Man darf ihnen ihre Kultur nicht wegnehmen. Ich war immer sehr interessiert, dass man sie in die Gesellschaft einbindet. Ich mag das Wort Integration nicht. Für mich ist das eine Einbindung in die Gesellschaft –,
Wentzien: Klingt so technisch, ja.
Knobloch: – eine Einbindung in das Judentum, und das haben wir versucht, wie gesagt, in beiden Bereichen. Es ist uns zum großen Teil gelungen, es ist nicht alles gelungen, weil man braucht auch das Ja der Gegenseite, dass die Menschen das auch wollen. Es gab welche, die das Judentum als Religion nicht interessiert hat. Sie wollten ihr Leben, ihre Zukunft aufbauen. Man kann niemanden zwingen. Wir hatten damals noch die Schwierigkeiten, dass ab, ich glaube, ab '65 war das damals, da hatten die älteren Leute kein Deutschunterricht mehr, dann mussten wir zum Beispiel selbst dann aufbauen. Ich sage nur, so kleine Probleme, die wir hatten, aber die uns natürlich dann auch gelungen sind. Wir haben das alles dann auf die Reihe gebracht, und es kamen dann immer mehr und immer mehr. Zuerst konnte man noch persönlich mit dem Einzelnen sich unterhalten, was sehr wichtig ist, es ist aber dann nicht mehr gelungen. Wir hatten dann auch Mitarbeiter, die dann auch das mit übernommen haben. Heutzutage kann ich sagen, dass die Integration, die uns vorgegeben wurde, für mich mehr eine Einbindung in die Gesellschaft, in das Judentum, dass das uns gelungen ist, aber nur bei denjenigen, die das auch akzeptiert haben und das auch wollten. Es war für mich immer sehr wichtig, dass sie auch wissen mussten, dass wir hier Gesetze haben, die sehr unterschiedlich sind zu den Gesetzen ihrer Heimat und dass sie auch mit den Werten, die hier im Vordergrund stehen, mit denen wir leben, mit denen sie auch zu leben haben, für uns selbst sehr wichtig sind, dass sie auch das akzeptieren. Es kommt immer drauf an, in welcher Form man das macht. Die Kultur ist ihnen das Wichtigste bis zum heutigen Tage, und sie kriegen ihre Veranstaltungen, sie sind sehr interessiert an Musik, sie sind sehr interessiert an ihrer russischen Literatur. Man muss beides einbinden in das Leben in ihrer neuen Heimat, es immer wieder aber auch verbinden mit der alten Heimat, damit sie sich nicht so fremd fühlen. Das Fremdsein ist ein Thema, das man nicht aufkommen lassen darf. Es ist natürlich, wenn sie dann in die Öffentlichkeit gehen schon manchmal der Fall, aber dann müssen sie schon einen Ruhepol auffinden. Also wie gesagt, wichtig ist, dass sie wissen, dass sie eine neue Heimat gefunden haben und dass die neue Heimat sie auch gerne aufnimmt beziehungsweise auch für ihre Zukunft eintritt und sorgt. Ich sehe heute an den zweiten und dritten Generationen, die jetzt schon da sind, dass das hervorragend geglückt ist. Es sind tolle junge Leute, die wir heute haben, die hier dann schon geboren sind, die aber immer noch mit ihren Eltern und mit ihrer ehemaligen Heimat, die sie oft gar nicht kannten, aber mit ihrer russischen Sprache verbunden sind, aber das sollte man auch unterstützen.

Wentzien: Wenn wir es jetzt konkret machten, Frau Knobloch: Die Kanzlerin, Herr Altmaier, die Kanzlerin Angela Merkel, Peter Altmaier als Chef des Kanzleramtes und der Spiritus rector der Flüchtlingsthemen, rufen an und sagen, Frau Knobloch, schicken Sie uns mal ein Paket mit Vorschlägen, Handlingsmöglichkeiten, wie haben Sie das damals hinbekommen bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen und deren Eingliederung hier in das Land. Könnten Sie da was rüberreichen, was man jetzt gebrauchen könnte? Sie waren eben eigentlich sehr positiv gestimmt.
Knobloch: So ein Thema kannst du nur positiv beginnen, da kannst du nichts Negatives … Wenn du es auch siehst, wenn es auch vorhanden ist, wenn du auch angesprochen wirst in der Richtung – ich meine, es ist nicht alles Gold, was glänzt, das muss man schon sagen, aber da muss man Ruhe bewahren, da muss man sehr intensiv sich mit den Menschen befassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich in den Massen, die jetzt vorhanden sind, ein schwieriges Unternehmen. Drum bin ich auch dafür, dass man jetzt mal das, was vorhanden ist, hervorragend in die Tat umsetzen wird. Die Frage ist, kann man das? Das ist natürlich ein großes Thema, und man muss aber darauf achten, dass man in ein Zimmer nicht nur eine oder zwei Personen leben lässt – ich will das jetzt übertragen auf ganz andere Dinge, nicht auf Wohnmöglichkeiten –, sondern dass in diesem Raum, der für ein oder zwei Personen vorhanden ist, nicht drei oder vier Familien hineinpresst, sondern dass man sich genau überlegt, wie kann ich die Menschen, die jetzt bei mir sind, wie kann ich die am besten für mich und für unser Land vertraut machen, wie kann ich das tun, und muss genau wissen, welche Möglichkeiten ich habe und nicht noch immer wieder mehr und mehr Leute hier ankommen lassen, die dann eigentlich jahrelang hier rumsitzen. Die Konsequenzen daraus möchte ich hier nicht im Einzelnen anbringen. Es ist wichtig, dass man die Dinge übersehen kann, dass man die Dinge in der Hand behalten kann und dass man den Menschen eine Heimat bieten kann, aber da gibt es natürlich auch Grenzen, die geleistet werden können, und das sollte man genau beachten.
Wentzien: Sehr nachdenklich haben wir das Wort Antisemitismus schon mal kurz erwähnt, und das müssen wir an dieser Stelle bitte auch. Sie haben gesagt, die Menge dieses politischen Hassgefühls ist größer geworden, die sich auch artikuliert. Sie sagen auch beispielsweise jetzt gerade im Januar, sie waren zu Gast im sächsischen Landtag und haben dort gesprochen am Holocausttag, wir Demokraten sind das Volk, wir müssen aufstehen, wir müssen auch sagen, was "Wir" an dieser Stelle heißt, und Sie sagen, der Judenhass ist in Teilen des Nahen Ostens Staatsräson, wo Menschen jetzt in unser Land kommen, und das natürlich im Gepäck haben. Wie damit umgehen, Frau Knobloch, was sagen Sie den Nachgeborenen oder was schreiben Sie denen ins Stammbuch?
Knobloch: Ich meine, das wird eine der schwierigsten Fragen sein, die man zu beantworten hat. Man kann das nicht mit einem gewissen Druck machen, sondern man muss ihnen aber auch klar sagen, sie haben sich entschlossen, aus ihrer Heimat wegzugehen, eine neue Heimat zu suchen, und da muss man schon auch das ganz klar zum Ausdruck bringen, und sie haben sich auch nach den neuen Gegebenheiten zu richten. Sie müssen natürlich Informationen haben, sie kennen ja nur die eine Seite. Das, was ihnen eingebläut wurde, der Judenhass, die ganze Problematik des Nahen Ostens, diese Problematik, die ihnen natürlich auch nicht in der Form, wie sie tatsächlich vorhanden ist, geschildert wurde, es ist ein Thema, das wahrscheinlich sehr schwierig sein wird. Diese Menschen, die nichts anderes gehört haben als wie, dass Juden Mörder sind – ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen –, dass man die davon überzeugt, dass sie hier Menschen zum Opfer gefallen sind, die politische Zwietracht zwischen der freien Welt und ihrer Welt, in der sie gelebt haben, natürlich auch in den Vordergrund gestellt haben.
Wentzien: Dieser Antisemitismus ist zu benennen, und es gibt auch den immer lauter, immer dreister, immer offener und offensiver werdenden Antisemitismus der Neonazis im Land, der ein Rechtsextremismus ist, der geradezu auch terroristisch auszuwachsen droht. Das ist die andere antisemitische Kraft, wenn man so will. An der Stelle gibt es viele Erwähnungen von Ihnen, nachdenkenswerte, Frau Knobloch, unter anderem die, dass sie sich auch mehr Engagement der muslimischen Gemeinden beispielsweise in Deutschland wünschten.
Knobloch: Eigentlich habe ich dieses Thema leider Gottes schon aufgeben müssen, weil die muslimischen Gemeinden sich zu all den Fragen, die wir jetzt auch in dem Interview besprochen haben, überhaupt nicht äußern. Es wäre schon angebracht, dass sie sich auch mit diesen Themen vielleicht befassen, weil sie vielleicht diejenigen sind, auf die man eher hört als auf einen nichtmuslimischen Sprecher oder Sprecherin. Ich bin enttäuscht darüber, dass da überhaupt nichts verlautbart wird und dass sie im Gegenteil das, was wir schon länger feststellen konnten, dass die jungen Muslime, die zum Teil auch schon in Deutschland geboren sind, diesen Judenhass in sich tragen, obwohl sie nicht aus den Ländern kommen, wo es Staatsräson war, der Judenhass, sondern sie sind hier in den Hinterhofmoscheen von ihren Imamen in die Richtung unterrichtet worden. Da sind wir alle dran, nicht nur die jüdische Gesellschaft: "Tod den Nichtgläubigen" ist die Überschrift des Unterrichts, den sie täglich hören. Die Thematik des Nahen Ostens wird natürlich ihnen auch in einer Art und Weise beigebracht, die nicht den Tatsachen entspricht.
Wentzien: Wenn Sie sagen, Ihr Land, Deutschland, unser Land, Frau Knobloch, ist da fahrlässig im Moment, also sollten wir da mehr hinschauen, sollten wir dem mehr nachgehen?
Knobloch: Schauen Sie, die Fahrlässigkeit habe ich nicht nur in diesem Bereich in all den Jahren angemerkt beziehungsweise auch immer wieder angesprochen. Ich meine, die Neonazis sind auch jetzt nicht vom Himmel gefallen, die haben sich schon seit ein, zwei Jahrzehnten ganz deutlich in den Vordergrund gestellt. Sie sind da und waren da, und jetzt natürlich haben sie noch mehr Zuspruch bekommen als wie es in der Vergangenheit war. Die Fahrlässigkeit als solche, die habe ich immer angekreidet, und jetzt haben wir die Rechnung dafür.
Wentzien: An einer Stelle in Ihren Erinnerungen haben Sie geschrieben, und zwar damals in Bezug auf die deutsche Einheit, und das wäre dann auch meine Schlussfrage: "Historische Momente fragen nicht nach der Bereitschaft. Auf Umwälzung ist man nie hinreichend vorbereitet." Haben wir gerade einen historischen Moment?
Knobloch: Ja, wir haben beides, einen historischen Moment, und wir haben eine Umwälzung, an die man nicht in der Form, wie wir es im Moment erleben, geglaubt hat. Vielleicht bin ich zu viel Optimist. Es ist eine Umwälzung, die eine enorme Herausforderung in vielen Bereichen, nicht nur in den sogenannten Integrationsbereichen, sondern in allen Bereichen, auch in Bereichen, die uns selbst betreffen … Ich meine jetzt nicht uns als Personen, sondern uns als diejenigen, die Deutschland als unsere Heimat schon längst gesehen haben, aber die heutzutage herausgefordert wird in einer Art und Weise, wo wir uns das nicht vorgestellt haben. Wir wollen erhoffen und wünschen, dass viele nachdenken und zur Einsicht kommen, dass dies ein wunderbares Land ist, in dem wir leben, dass wir dieses Land in verschiedenen Bereichen und diese Stimmung, die in unserem Land einmal im Vordergrund war, nicht gefährden dürfen und dass wir nicht in der Gegenwart leben dürfen, sondern wir müssen die Zukunft gestalten, und die Zukunft dahingehend, dass alle, die hier leben wollen und leben sollen, dass die auch sich mit unseren Werten verbunden fühlen, mit diesen Werten leben wollen, in unserer Gesellschaft aufgehen wollen, ihre Kultur behalten sollen, aber dazu beitragen, dass dieses Land seine Blüte und seine Grundlagen weiterhin behält. Das erwarten wir von denen, die zu uns kommen.
In unserer Reihe "Zeitzeugen" hörten Sie Birgit Wentzien im Gespräch mit Charlotte Knobloch.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.