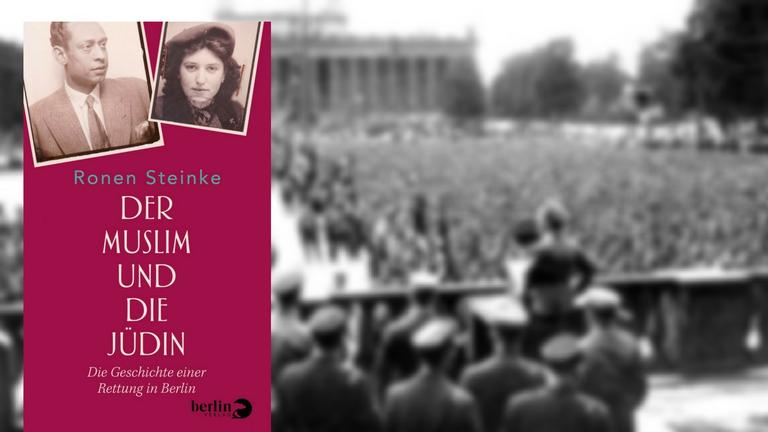Eine breite, schattige Allee mit mächtigen Johannisbrotbäumen. Vor einem von ihnen steht ein alter Herr, der den knorrigen Stamm liebevoll umfasst. Diese immergrünen Bäume säumen die "Allee der Gerechten unter den Völkern" in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem.
Irena Steinfeldt, Leiterin der Abteilung "Gerechte unter den Völkern in "Yad Vashem":
"Für uns ist es etwas, das wir machen müssen, um unseren Dank den Rettern auszudrücken. In den ersten Jahren wurden Bäume gepflanzt."

Und zwar in Anerkennung der Nichtjuden, die während der Schoah ihr Leben einsetzten, um Juden zu retten. Die Namen der Geehrten sind in ein kleines Metallschild vor dem Baum eingraviert:
Gertruda Babilińska.
Geboren 1902 in Preußisch Stargard.
Gestorben 1995 in Israel.
Geboren 1902 in Preußisch Stargard.
Gestorben 1995 in Israel.
Der alte Herr, Michael Stolowitzky, kommt einmal im Jahr aus New York nach Yad Vashem, um an diesem Ort jener Frau zu gedenken, der er sein Leben verdankt: Gertruda Babilińska, dem katholischen Dienstmädchen in seinem Elternhaus in Warschau.
"Die Retter haben bewiesen, was man machen konnte."
Und was viele andere eben nicht gemacht haben, sagt Irena Steinfeldt, Leiterin der Abteilung "Gerechte unter den Völkern" in Yad Vashem.
"Das Wichtige ist, dass wir diese Geschichten weitererzählen."
Unter Einsatz ihres Lebens
Geschichten wie die von Michael Stolowitzky: Der wird 1936 in eine großbürgerliche Familie in Polen geboren. Auf einer Geschäftsreise nach Paris 1940 fällt sein Vater den deutschen Besatzern in die Hände. Er kehrt nie mehr zurück, wird deportiert und später in Auschwitz ermordet. Kurz danach stirbt Michaels Mutter an einem Schlaganfall. Auf dem Sterbebett verspricht ihr das Dienstmädchen Gertruda, sich um das Kind zu kümmern. Sie gibt es als ihr eigenes aus und schafft es immer wieder - mit gefälschten Papieren und unter Einsatz ihres Lebens - den Kleinen aus drohender Todesgefahr zu retten. Um den letzten Wunsch der Mutter zu erfüllen, geht Gertruda nach dem Krieg mit Michael ins britische Mandatsgebiet Palästina. Nach Gründung des Staates Israel leben die beiden in Jaffa. Gertruda arbeitet als Putzfrau, um Michael durchzubringen und ihm eine Ausbildung zu ermöglichen. Am 4. Juni 1963 erhält sie die Auszeichnung "Gerechte unter den Völkern."

Als sie 1995 im Sterben liegt, ist Michael bei ihr:
"Ich sagte zu ihr: Wir werden uns da oben wiedersehen. Ich sah das Lächeln in ihren blauen Augen und wusste, sie hatte mich verstanden. Dann starb sie. Sie war 93 Jahre alt."
Geschichten von unverbrüchlicher Treue
Der Augsburger Kulturhistoriker Friedrich Georg Friedmann hat solche Geschichten gesammelt - Geschichten von der unverbrüchlichen Treue christlicher Dienstmädchen zu "ihren" jüdischen Familien. Er selbst hat auch diese Erfahrung gemacht - mit Marie Weber, dem christlichen Dienstmädchen in seinem Elternhaus:
"Ich erinnere mich an Marie Weber sehr gut, weil sie mehr oder weniger ein Mitglied unserer Familie war, obgleich sie aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Augsburg kam und natürlich katholisch war, während wir eine jüdische Familie waren. Als Bub habe ich sie oft geneckt, indem ich ganz leise in die Küche ging und das Licht ausgedreht habe oder ihr die Schürzenschleifen aufgedreht habe oder Ähnliches. Später, nachdem ich Deutschland verlassen hatte und sehr viel in der Welt herumgekommen war und sie wiedergesehen habe nach dem Krieg, etwa 1960, war sie für mich das einzige überlebende Mitglied unserer Familie. Ein Neffe der Marie Weber erzählte mir nachher, wie er als Soldat der Marie Dinge zu essen gab, die sie dann meinen Eltern zuschmuggete, obwohl das damals natürlich eine gefährliche Sache war."
Die eigenen Erfahrungen und die Neugier des Wissenschaftlers motivierten Friedmann zu einer ungewöhnlichen Aktion: In den 1990er-Jahren appellierte er per Zeitungsannonce an emigrierte deutsche Juden in aller Welt, ihm von ihren christlichen Dienstboten zu berichten:
"Aus ganz normaler Dankbarkeit unserer Marie gegenüber. Und als Denkmal für Marie Weber habe ich dann in einigen kleinen Zeitschriften von Emigranten in Israel, England und in Amerika eine kleine Notiz hineingesetzt."
Jüdische Liebesaffäre mit deutscher Kultur?
Mit seinen Erinnerungen an Marie Weber wollte Friedmann aber auch eine Theorie widerlegen: die des jüdischen Religionsgelehrten Gershom Scholem. Der nämlich hatte erklärt, die oft gepriesene deutsch-jüdische Symbiose sei nichts als Augenwischerei gewesen, eine ganz und gar einseitige Beziehung, in der nur die eine, die jüdische Seite gegeben und die andere - nur unwillig - genommen habe. Die vielzitierte "jüdische Liebesaffäre mit der deutschen Kultur" möge existiert haben, jedoch, so Scholems These, sei diese Liebe immer unerwidert geblieben.
Doch Friedrich Friedmann hatte in seinem langen Leben andere Erfahrungen gemacht, Erfahrungen, die für ihn Ausnahmen zu Scholems These darstellten. Eine davon sah er im Verhältnis von jüdischen Familien und ihrem christlichen Hauspersonal in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Friedmann kam der Gedanke, zu beweisen, dass Scholem sich irrte. Das war der Anlass für seinen Zeitungsaufruf:
"Daraufhin bekam ich 64 Briefe, von denen 62 ungefähr das Gleiche sagten: nämlich von den ganz engen Beziehungen zwischen christlichen Dienstboten und jüdischer Familien."
Es waren Briefe wie dieser, den Anna Ullmann aus Oak Lawn, Illinois schrieb:
"Wir lebten im Haus der Urgroßeltern in Vreden, Westfalen. Es waren stets zwei Mädchen engagiert. Sie kamen mit 14 Jahren nach Abschluss der Volksschule zu uns und blieben bis sie heirateten. In der NS-Zeit haben sie uns nicht verlassen, sondern dienten uns treu bis zur letzten Minute."
"Unsere Anna - man müsste ihr ein Denkmal setzen"
Oder der Brief von Dorothea Hirschfeld aus Rio de Janeiro:
"Unsere Anna - man müsste ihr ein Denkmal setzen. Sie war viele Jahre unser Dienstmädchen. Sie paukte mit uns französische und englische Vokabeln und lehrte uns sogar Klavierspielen. Uns Kinder liebte sie abgöttisch."
Doch was waren das für Menschen - diese Mädchen, die meist vom Land kamen und Anna, Minna, Trine oder Stine hießen? Mädchen, ohne die der deutsche Haushalt jahrhundertelang nicht denkbar war? Ein ganzes Leben verbrachten viele von ihnen "in Stellung", also in den Häusern fremder Menschen.
Sie kochten, putzten, wuschen, spülten, bügelten und kauften ein. Sie schimpften über Schmutzschuhe auf dem Teppich, zählten Wäschestücke und lamentierten tagelang über den fehlenden geblümten Kissenbezug. Sie kochten Marmelade ein, fischten den Silberlöffel aus dem Katzenfutter, harkten die Gartenwege und zogen die Kinder groß. Manchmal drohten sie mit Kündigung und - blieben dann doch!
Behandelt wurden sie oft schlecht. Im Jahr 1937 bekam ein Dienstmädchen 30 bis 60 Mark im Monat. Ein Nachmittag in der Woche und jeder zweite Samstag waren frei; 14 Tage Urlaub gab es im Jahr. Oft wurden sie schikaniert, ausgenutzt und wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag? Festgelegte Arbeitszeiten? Tariflohn? Daran dachte damals kaum jemand - am wenigsten die Mädchen selbst.
Seltsam nur - eine Kategorie von Dienstboten gab es, mit denen es das Schicksal oft besser meinte: diejenigen, die in jüdischen Häusern arbeiteten. In einem Brief, den Ella Reimann aus Kiron in Israel nach Friedmanns Aufruf schrieb, heißt es:
"Eine christliche Freundin meiner Mutter, bei der sich ein Dienstmädchen vorstellte, das zuvor in einem jüdischen Haus Dienst getan hatte, sagte zu dem Mädchen: "Es tut mir leid, Fräulein, aber Mädchen, die in jüdischen Familien gedient haben, nehme ich prinzipiell nicht! Die sind mir zu verwöhnt."
Dienstmädchen in jüdischen Familien "verwöhnt"
Zu diesen "Verwöhnten" zählte auch Hildegard Jockisch. Sie stammte aus Oberschlesien und trat 1933 ihren Dienst in der Familie eines jüdischen Textilfabrikanten in Berlin an:
"Familie Israel, die in der Kaiserallee in Berlin gewohnt hat. Das war eine riesige Wohnung und dort war ich eben als Hausangestellte. Dort wurde ich gehalten wie eine Tochter. Also, die Frau Israel war wirklich, man kann sagen, ein Engel. Und auch der Herr Israel war sehr nett gewesen... Sie hatten zwei Söhne und für die Söhne war eine Kindergärtnerin da. Und ich hab mein Zimmer gehabt, das war nicht allzu groß, aber es war alles drin, was nötig war. Die Israels waren sehr sozial eingestellt."
Dazu gehörte auch, dass die Religionsausübung der Mädchen respektiert wurde:
"Als ich hinkam, sagte ich eben: 'Da ich ja katholisch bin, möchte ich auch in die Kirche gehen.' Da sagte sie: 'Ja, selbstverständlich können Sie gehen.'"
Die Mädchen lernten schnell Formen und Rituale jüdischen Lebens kennen. Bis heute erinnern sich einige Familien daran, dass ihre christlichen Dienstmädchen etwa Mazzeknödel von unübertroffener Qualität zubereiten konnten. Grundsätzliche theologische Missverständnisse blieben manchmal dennoch nicht aus:
"Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf unser Dienstmädchen Selma richten, das ab 1919 im Haus meiner Eltern Dienst tat…"
Schrieb etwa Joseph de Haas, Sohn des ehemaligen Oldenburger Landesrabbiners Dr. Philipp de Haas, in seinem Brief:
"Selma betrachtete meinen Vater als heilige Person. Sie war jedoch um seine Erlösung besorgt, da er ja in ihren Augen ein "Heide" war. Ich erinnere mich noch an den Kondolenzbesuch des katholischen Bischofs, nachdem mein Vater gestorben war. Der Bischof erkundigte sich, ob wir eine Bedienstete namens Selma Gress beschäftigten. Unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit erzählte er uns dann folgende Geschichte: Da Selma einerseits überzeugt war, dass mein Vater ein gottesfürchtiger Mann war, andererseits aber um sein Seelenheil fürchtete, war sie zu ihrem Pfarrer gegangen und hatte ihm einen Teil ihrer Ersparnisse gegeben, damit einige Messen für den verstorbenen Rabbiner Dr. de Haas gelesen werden konnten. Der Pfarrer leitetet die Bitte an den Bischof weiter, der in seiner Weisheit die Erlaubnis dazu gab."
"Als wäre ich keine Angestellte gewesen"
Hildegard Jockisch starb 2014 im Alter von 103 Jahren. Sie erinnerte sich an "ihre" Frau Israel so:
"Wenn ich gebügelt hab, da hat sie Kaffee gemacht und sie hat mir was zugesteckt. Oder - ich hab damals so ein bisschen geraucht, da hat sie mir die Zigarette angesteckt. Wie gesagt, es ging ganz zwanglos zu. Ich weiß, dass ich mal sehr erkältet war und da musste ich heiß baden und dann hat mich Frau Israel in ein Badetuch gestopft und mir Tee gebracht... Es war überhaupt nicht, als ob ich eine Angestellte gewesen wäre."
Diese Beziehung überstand auch jene kleinen Katastrophen, die in jedem Haushalt vorkommen:
"Mal musste ich ein Ragout machen - Kalbsragout - und tags vorher war ich in einem Film "Quo vadis?" und da hab ich vergessen, auf das Fleisch zu achten und als dann der Herr Israel nach Hause kam, da sagte sie: "Heute gibt es Ragout à la Ben Hur. Da ist nämlich Gulasch draus geworden. Mir war das natürlich peinlich, aber Frau Israel hat gelacht."
Was Hildegard Jockisch hier erlebte, galt für so zahlreiche Mädchen in jüdischen Häusern, dass man annehmen darf, dass es sich hier nicht um eine seltene Ausnahme handelte.
Katholische Dienstmädchen riskierten ihr Leben
Aber auch die Dienstmädchen, die in jener Zeit überwiegend katholisch waren, taten das Ihre dazu, um aus dieser Beziehung zwischen Herrschaft und Dienerschaft, die von ihrer Konstellation her ja durchaus Zündstoff für Konflikte bot, ein Verhältnis zu machen, das von Vertrauen, Zuneigung und Loyalität gekennzeichnet war. Und manchmal riskierten sie dabei auch ihr Leben.
Das weiß Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des "Zentralrats der Juden in Deutschland" aus eigener Erfahrung.

"Die Zenzi", Kreszentia Hummel, war das Dienstmädchen von Charlotte Knoblochs Onkel in Nürnberg. Charlottes Vater bat sie, sich der Sechsjährigen anzunehmen, als das Leben der Familie in München immer mehr in Gefahr geriet und die Deportation drohte. Kreszentia stimmte ohne Zögern zu und nahm die kleine Charlotte 1942 mit in ihr fränkisches Heimatdorf:
"Die Zenzi war eine sehr fromme katholische Frau. Und sie wusste nicht, wie der Dorfklatsch meine Anwesenheit aufnimmt. Ich glaub, da hat sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und dieser Dorfklatsch hat innerhalb eines Tages mich als außereheliche Tochter dieser sehr frommen Frau dargestellt. Man hat auch gleich über sie gelacht - sie, die fromme Frau - das war ja damals fast wie ein Verbrechen, wenn eine junge Frau ein außereheliches Kind hatte. Sie hat das auf sich genommen. Und sie hat immer große Sorgen gehabt, dass ich mich vielleicht in irgendeiner Form verplappern würde."
Dennoch gab es einen Menschen, der Bescheid wusste:
"Der Pfarrer im Ort. Das war der Einzige, der meine richtige Identität kannte. Und der hat dichtgehalten. Und ihr Cousin, das war damals der Ortsbauernführer. Da ist sie mit mir hingegangen und hat gesagt, sie braucht für mich Lebensmittelkarten und der hat höhnisch gelacht und gesagt: "Ja, ja, hab’s schon gehört, für dein Balg brauchst du das alles. Aber das war die Rettung, denn wie hätte ich sonst dort existieren können?"
Unbeugsamer Gerechtigkeitssinn
Es konnte passieren, dass Dienstmädchen, die zumeist völlig unpolitisch und ganz sicher keine Widerstandskämpferinnen waren, mit den Schergen des NS-Staates aneinandergerieten - immer mit dem Ziel, ihre Herrschaft zu schützen. Es waren sicher naive und unüberlegte Versuche, aber sie geschahen aus Mitleid, aus Empörung und aus einem untrüglichen und unbeugsamen Gerechtigkeitssinn heraus.
Edith Brosh-Schwarz aus Haifa schrieb:
"Ich weiß noch, dass unsere Lina während einer Haussuchung drei stämmigen Nazis mit einem großen Küchenmesser entgegentrat und sie anbrüllte: 'Was haben Sie in unserem Haus verloren?'"
Professor Friedrich Friedmann:
"Ich erinnere mich an einen Fall, wo jemand von der SA kam, um für die Winterhilfe zu sammeln und wo dann die - wie immer sie hieß - zu dem Mann gesagt hat: 'Wir geben nix, wir sind jüdisch.'"
Ähnlich resolut verfuhr auch Lina, die bei der Familie Ruhmann in Wien Dienst tat. Der Sohn Fritz Ruhmann erinnerte sich, dass eines Tages ein neuer Briefträger vor der Tür stand, der markig mit "Heil Hitler" grüßte. Umgehend stellte Lina klar:
"Sie, solche Faxn kennans mit Ihre Freinderln im Postamt moch’n, aber net hier…!"
Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurde die Beschäftigung sogenannter "arischer" Dienstboten unter 45 Jahren in jüdischen Haushalten untersagt.
Das war der Zeitpunkt, an dem auch Hildegard Jockisch Abschied von "ihrer" Familie Israel nehmen musste:
"Als mir Frau Israel eröffnete, dass ich weggehen müsste, weil ja diese Verordnung kam, dass keine jungen Angestellten da sein durften, da sagte sie: Hildchen, ich muss mal mit Ihnen sprechen. Dann haben wir im Wohnzimmer gesessen und sie hat mir die Sachlage geschildert. Wir haben beide geweint und Frau Israel hat mich umarmt."
"Christliche und jüdische Tradition sind sich sehr ähnlich"
Die genauen Gründe für diese in Deutschland so außergewöhnlich glückliche christlich-jüdische Beziehung sind bis heute nicht exakt wissenschaftlich erforscht, so Professor Friedrich Friedmann:
"Ich würde sagen, ein Element ist wahrscheinlich, dass es sich in beiden Fällen, also in der katholischen dörflichen Kultur und in der jüdischen Kultur, die ja auch eine relativ geschlossene war, um überschaubare Gebilde handelte, dass diese Überschaubarkeit ein Element ist, das die Menschen humanisiert. Da würde ich sagen, ist die alte christliche Tradition und die alte jüdische Tradition, wenn sie recht gelebt werden - sind sie sehr ähnlich."
Dennoch bleiben viele Fragen offen: Hatten die Erfahrungen in jüdischen Familien die Dienstmädchen gegen den vorherrschenden Antisemitismus in der Gesellschaft resistent gemacht? Hatten diese Erfahrungen einen immunisierenden Effekt? Und woraus resultierte jenes Zugehörigkeitsgefühl, das viele Mädchen veranlasste, im Dritten Reich, in Zeiten höchster Bedrohung ihr Leben für das ihrer Herrschaft aufs Spiel zu setzen?
Denn das tat nicht nur Zenzi Hummel, das taten auch andere Mädchen, als sie versuchten, auch dann noch in jüdischen Häusern zu arbeiten, als das längst verboten war. Das taten sie, als sie auf ihr Gehalt verzichteten, um bleiben zu können. Das taten sie, als sie heimlich von ihren Ersparnissen Rechnungen ihrer Arbeitgeber bezahlten, als deren wirtschaftliche Lage immer verzweifelter wurde. Und das taten sie, als sie den Antrag stellten, mit "ihren" jüdischen Familien in die Deportation zu gehen, wie in zwei Fällen aus den Jahren 1941 und 1942, die aus Köln und Berlin überliefert sind.
Und weil sie all das taten, sahen sich manche dieser einfachen und rechtschaffenen Landmädchen, die nie im Leben daran gedacht hätten, gegen Gesetze zu verstoßen, plötzlich gezwungen, sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen. Denn da mussten plötzlich Menschen versteckt oder Unterkünfte für sie gesucht werden, da mussten Familienmitglieder auf dem Land eingeweiht, Lebensmittelkarten gestohlen oder auch Papiere gefälscht werden. Und die Gefahr, entdeckt zu werden, war groß: Jeder Briefträger, jede Portiersfrau, jeder Nachbar an der Ecke konnte ein Denunziant sein.
Manche Mädchen wagten sich in die Höhle des Löwen
Manche Mädchen, die zuvor nie auf den Gedanken gekommen wären, freiwillig eine Amtsstube zu betreten, wagten sich sogar in die Höhle des Löwen, wenn sie fanden, dass das Maß voll sei. Dazu schrieb Erna Eckstein-Schlossmann aus Cambridge:
"Am 1. April 1933, dem Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte, traf eine Bekannte unsere Minna ganz aufgeregt in der Stadt. Auf die Frage, was denn los sei, erklärte Minna: 'Ich will zum Gauleiter! Es ist ja eine Gemeinheit, was hier vorgeht.'"
Dieselbe Minna folgte der inzwischen emigrierten Herrschaft 1936 kurzentschlossen in die Türkei, nachdem der elfjährige Sohn ihr von dort einen Brief geschrieben hatte, in dem stand, der Familie gehe es schlecht und ob Minna nicht kommen könne.
Doch solche glücklichen Wiedersehen waren selten. Häufiger waren Abschiede, bei denen alle wussten: Es würden Abschiede für immer sein. Einen solchen Abschied erlebte Ruth Becker aus Forest Hills im US-Bundesstaat New York:
"Als wir Deutschland verließen, folgte unsere Anna uns bis Köln. Es war der 19. Oktober 1939. Am Abend ging sie in den Dom und zündete eine Kerze für uns an. Am nächsten Tag begleitete sie uns bis zum Bahnsteig… Meiner Schwester schenkte sie einen Ring und mir einen Teddybären. Dann drehte sie sich wortlos um und ging fort."