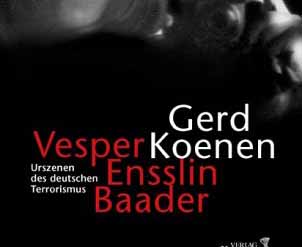Karin Fischer: "Sie war ein radikalisiertes Verfallsprodukt der engagierten Studentenbewegung und zur Gewalt motiviert." Das schreibt der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum über die RAF. Im Originalton hört sich das von heute aus merkwürdig an. Andreas Baader möchte den Stammheim-Prozess 1976 gerne nämlich umdefinieren. Gegenstand des Verfahrens müsste eigentlich sein, so Baader:
"Nämlich die totale Bestimmung, Kontrolle und Verfügung dieses Staates nach innen und außen, für die Weltinnenpolitik, des Hegemonialen, des US-Kapitals. Das heißt, die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches und militärisches Subzentrum des amerikanischen Imperialismus, hier entwickelt, an seine Funktion, erstens, für die offene Aggression gegen die Völker der Dritten Welt konkret an Vietnam und zweitens die verdeckte Aggression gegen die Staaten der westeuropäischen Peripherie."
Das Revolutionssprech von damals ist längst abgelöst worden, zuerst vom Mythos RAF, der sogar modetauglich wurde und dann von einer reichlich ahistorischen Rede von den Gewaltverbrechern, die nur die eigenen Idiosynkrasien pflegten. Heute kommt "Der Baader Meinhof Komplex" in die Kinos, der medial auch schon groß begleitet wurde. Und einer, der sich dem Hype diesmal verweigert, ist der Historiker und Publizist Gerd Koenen, der 2001 das Buch "Das rote Jahrzehnt" und 2003 ein Buch über die RAF-Terroristen vorgelegt hat. Ich habe ihn gefragt, warum?
Koenen: Ich erwarte mir nichts Neues von dem Film. Das Buch von Stefan Aust war eine saubere journalistische Recherche. Stefan Aust liebt keine Psychologie. Er ist aber auch kein Zeithistoriker, was ich zum Beispiel bin.
Fischer: Er beruft sich auf Dokumente?
Koenen: Ja klar, die Dokumente gibt es. Es gibt die Personen, es gibt ein paar Linien der Zusammenhänge. Das wissen wir ja alles und haben auch das ganze letzte Jahr schon über die RAF diskutiert. Das fällt ja irgendwie in dieser Intensität nun langsam irgendwie auch unter die Rubrik der deutschen Selbstfaszination. Exportwirtschaftlich betrachtet, bevor man den Film gesehen hat, ist er schon Oscar-Kandidat. Irgendwie sind es die deutschen Exportthemen mit der deutschen Geschichte, der Bunker oder der Bunker von Stammheim. Ich finde, das ist ein Wiederholungsspiel. Interessant sind drei Dinge. Es können die Personen wirklich interessant sein, aber dann braucht man auch etwas Psychologie. Deswegen habe ich mich mit der Vorschichte, wie kamen sie überhaupt zu dem Punkt, beschäftigt. Und da sieht das alles überhaupt nicht so eindeutig aus, wie dieses Gudrun-Ensslin-Zitat: Das ist die Generation von Auschwitz, da braucht man Waffen - was sie angeblich schon 67 gesagt haben soll - dann suggeriert. Das ist eine allzu gerade Linie.
Fischer: Herr Koenen, Sie spielen an auf Ihr Buch "Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus". Was müsste eine Betrachtung über die RAF oder ein RAF-Film heute liefern?
Koenen: Erstens mal muss man es schon ein bisschen gesellschaftsgeschichtlich einordnen. Dieser ganze RAF-Hype, auch in den 70er Jahren, war überhaupt nicht zu verstehen ohne eine tiefe Selbstunsicherheit der gesamten deutschen Gesellschaft. Das war nicht einfach nur eine Geschichte von ein paar Durchgeknallten dort am äußersten linken Rand. Das war ein gesamtgesellschaftliches Hysterikum. Der liberale und linke Teil der Gesellschaft, der ja eigentlich gerade an die Macht gekommen war sozusagen mit Willy Brandt, misstraute dem konservativen, eher rechten Teil. Und der rechte Teil, die "Bild-Zeitung", sagte, schaut mal, wo da hinführt, zum Terrorismus. Und alle operierten mit dem Gespenst des Faschismus. Auch die "Bild-Zeitung". Immer Faschismus. Faschismus hin, Faschismus her. Und wenn man nicht dieses gesamtgesellschaftliche Spiel im Blick hat, dann ist das Ganze schon sehr eng angesetzt. Was die Personen angeht und die Bewegung, aus der sie kamen, muss man es tatsächlich dann auch im Medium dieser größeren Bewegung sehen, dieser 68er-, Nach-68er-Bewegung. Das geschieht dort natürlich auf irgendeine Art und Weise, aber wie ich eben jedenfalls beim Studium auch dieser Protagonisten herausgefunden habe, war das alles alles andere als ein gerade Weg.
Fischer: Machen Sie es mal an einem Beispiel fest, bitte.
Koenen: Ja. Schauen Sie, Gudrun Ensslin ist im Jahr - die ist wirklich die treibende Figur, meines Erachtens - ist im Jahr 67, während des 2. Juni noch die sorgende Mutter eines kleinen Sohnes. An so was denkt sie nicht einmal von Ferne. Sie ist noch nicht mal ganz besonders links. Sie kommt an den Andreas Baader. Es entsteht so ein existenzialistischer Drang, etwas zu tun aus einer noch sehr protestantisch gefärbten moralischen Empörung. Kaufhausbrandstiftung. Noch immer ist Terrorismus weit entfernt. Es ist so ein leichtsinniges Spiel mit dem Feuer buchstäblich. 69 geraten sie beide in so eine Drift mit diesem Fürsorgezögling. Aber selbst, als sie abtauchen, nachdem sie wieder die Haft antreten sollen, hat das Ganze noch etwas Spielerisches, Suchendes, Unklares. Und selbst die Baader-Befreiung wird erst dadurch so dramatisch, weil dann plötzlich, und zwar aus reinem Dilettantismus, ein Mensch angeschossen auf dem Boden liegt. Und dann sind sie auf der Flucht und dann müssen sie eine Rote Armee Fraktion gründen. Und die ganze Gesellschaft spielt aber mit.
Fischer: Glauben Sie, dieser Film könnte Schaden anrichten in einem geschichtspolitischen Sinne?
Koenen: Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich vermute mal, die einen werden es empfinden, dass die Figuren, die ja wirklich von tollen Schauspielern dargestellt werden, irgendwie doch dadurch sympathisch und idealisiert werden und andere werden es vielleicht gerade so sehen, dass sie dadurch dämonisiert werden, einfach als so eine Horde von Durchgeknallten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich macht der Film beides. Das ist ja genau die Wiederholung dieses gesellschaftlichen Spiels, von dem ich gesprochen habe. Und das hat auch schon fast was von einer Endlosschleife. Nein, ich erwarte nichts Schlimmes davon, dass man sich diesen Film anschaut. Ich werde ihn mir auch anschauen. Ich erwarte nur nichts Neues, keinen wirklichen Aufschluss davon.
Fischer: Das war der Historiker, Schriftsteller und Publizist Gerd Koenen mit Einschätzungen zur RAF und zum filmischen Umgang mit der RAF.
"Nämlich die totale Bestimmung, Kontrolle und Verfügung dieses Staates nach innen und außen, für die Weltinnenpolitik, des Hegemonialen, des US-Kapitals. Das heißt, die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches und militärisches Subzentrum des amerikanischen Imperialismus, hier entwickelt, an seine Funktion, erstens, für die offene Aggression gegen die Völker der Dritten Welt konkret an Vietnam und zweitens die verdeckte Aggression gegen die Staaten der westeuropäischen Peripherie."
Das Revolutionssprech von damals ist längst abgelöst worden, zuerst vom Mythos RAF, der sogar modetauglich wurde und dann von einer reichlich ahistorischen Rede von den Gewaltverbrechern, die nur die eigenen Idiosynkrasien pflegten. Heute kommt "Der Baader Meinhof Komplex" in die Kinos, der medial auch schon groß begleitet wurde. Und einer, der sich dem Hype diesmal verweigert, ist der Historiker und Publizist Gerd Koenen, der 2001 das Buch "Das rote Jahrzehnt" und 2003 ein Buch über die RAF-Terroristen vorgelegt hat. Ich habe ihn gefragt, warum?
Koenen: Ich erwarte mir nichts Neues von dem Film. Das Buch von Stefan Aust war eine saubere journalistische Recherche. Stefan Aust liebt keine Psychologie. Er ist aber auch kein Zeithistoriker, was ich zum Beispiel bin.
Fischer: Er beruft sich auf Dokumente?
Koenen: Ja klar, die Dokumente gibt es. Es gibt die Personen, es gibt ein paar Linien der Zusammenhänge. Das wissen wir ja alles und haben auch das ganze letzte Jahr schon über die RAF diskutiert. Das fällt ja irgendwie in dieser Intensität nun langsam irgendwie auch unter die Rubrik der deutschen Selbstfaszination. Exportwirtschaftlich betrachtet, bevor man den Film gesehen hat, ist er schon Oscar-Kandidat. Irgendwie sind es die deutschen Exportthemen mit der deutschen Geschichte, der Bunker oder der Bunker von Stammheim. Ich finde, das ist ein Wiederholungsspiel. Interessant sind drei Dinge. Es können die Personen wirklich interessant sein, aber dann braucht man auch etwas Psychologie. Deswegen habe ich mich mit der Vorschichte, wie kamen sie überhaupt zu dem Punkt, beschäftigt. Und da sieht das alles überhaupt nicht so eindeutig aus, wie dieses Gudrun-Ensslin-Zitat: Das ist die Generation von Auschwitz, da braucht man Waffen - was sie angeblich schon 67 gesagt haben soll - dann suggeriert. Das ist eine allzu gerade Linie.
Fischer: Herr Koenen, Sie spielen an auf Ihr Buch "Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus". Was müsste eine Betrachtung über die RAF oder ein RAF-Film heute liefern?
Koenen: Erstens mal muss man es schon ein bisschen gesellschaftsgeschichtlich einordnen. Dieser ganze RAF-Hype, auch in den 70er Jahren, war überhaupt nicht zu verstehen ohne eine tiefe Selbstunsicherheit der gesamten deutschen Gesellschaft. Das war nicht einfach nur eine Geschichte von ein paar Durchgeknallten dort am äußersten linken Rand. Das war ein gesamtgesellschaftliches Hysterikum. Der liberale und linke Teil der Gesellschaft, der ja eigentlich gerade an die Macht gekommen war sozusagen mit Willy Brandt, misstraute dem konservativen, eher rechten Teil. Und der rechte Teil, die "Bild-Zeitung", sagte, schaut mal, wo da hinführt, zum Terrorismus. Und alle operierten mit dem Gespenst des Faschismus. Auch die "Bild-Zeitung". Immer Faschismus. Faschismus hin, Faschismus her. Und wenn man nicht dieses gesamtgesellschaftliche Spiel im Blick hat, dann ist das Ganze schon sehr eng angesetzt. Was die Personen angeht und die Bewegung, aus der sie kamen, muss man es tatsächlich dann auch im Medium dieser größeren Bewegung sehen, dieser 68er-, Nach-68er-Bewegung. Das geschieht dort natürlich auf irgendeine Art und Weise, aber wie ich eben jedenfalls beim Studium auch dieser Protagonisten herausgefunden habe, war das alles alles andere als ein gerade Weg.
Fischer: Machen Sie es mal an einem Beispiel fest, bitte.
Koenen: Ja. Schauen Sie, Gudrun Ensslin ist im Jahr - die ist wirklich die treibende Figur, meines Erachtens - ist im Jahr 67, während des 2. Juni noch die sorgende Mutter eines kleinen Sohnes. An so was denkt sie nicht einmal von Ferne. Sie ist noch nicht mal ganz besonders links. Sie kommt an den Andreas Baader. Es entsteht so ein existenzialistischer Drang, etwas zu tun aus einer noch sehr protestantisch gefärbten moralischen Empörung. Kaufhausbrandstiftung. Noch immer ist Terrorismus weit entfernt. Es ist so ein leichtsinniges Spiel mit dem Feuer buchstäblich. 69 geraten sie beide in so eine Drift mit diesem Fürsorgezögling. Aber selbst, als sie abtauchen, nachdem sie wieder die Haft antreten sollen, hat das Ganze noch etwas Spielerisches, Suchendes, Unklares. Und selbst die Baader-Befreiung wird erst dadurch so dramatisch, weil dann plötzlich, und zwar aus reinem Dilettantismus, ein Mensch angeschossen auf dem Boden liegt. Und dann sind sie auf der Flucht und dann müssen sie eine Rote Armee Fraktion gründen. Und die ganze Gesellschaft spielt aber mit.
Fischer: Glauben Sie, dieser Film könnte Schaden anrichten in einem geschichtspolitischen Sinne?
Koenen: Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich vermute mal, die einen werden es empfinden, dass die Figuren, die ja wirklich von tollen Schauspielern dargestellt werden, irgendwie doch dadurch sympathisch und idealisiert werden und andere werden es vielleicht gerade so sehen, dass sie dadurch dämonisiert werden, einfach als so eine Horde von Durchgeknallten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich macht der Film beides. Das ist ja genau die Wiederholung dieses gesellschaftlichen Spiels, von dem ich gesprochen habe. Und das hat auch schon fast was von einer Endlosschleife. Nein, ich erwarte nichts Schlimmes davon, dass man sich diesen Film anschaut. Ich werde ihn mir auch anschauen. Ich erwarte nur nichts Neues, keinen wirklichen Aufschluss davon.
Fischer: Das war der Historiker, Schriftsteller und Publizist Gerd Koenen mit Einschätzungen zur RAF und zum filmischen Umgang mit der RAF.