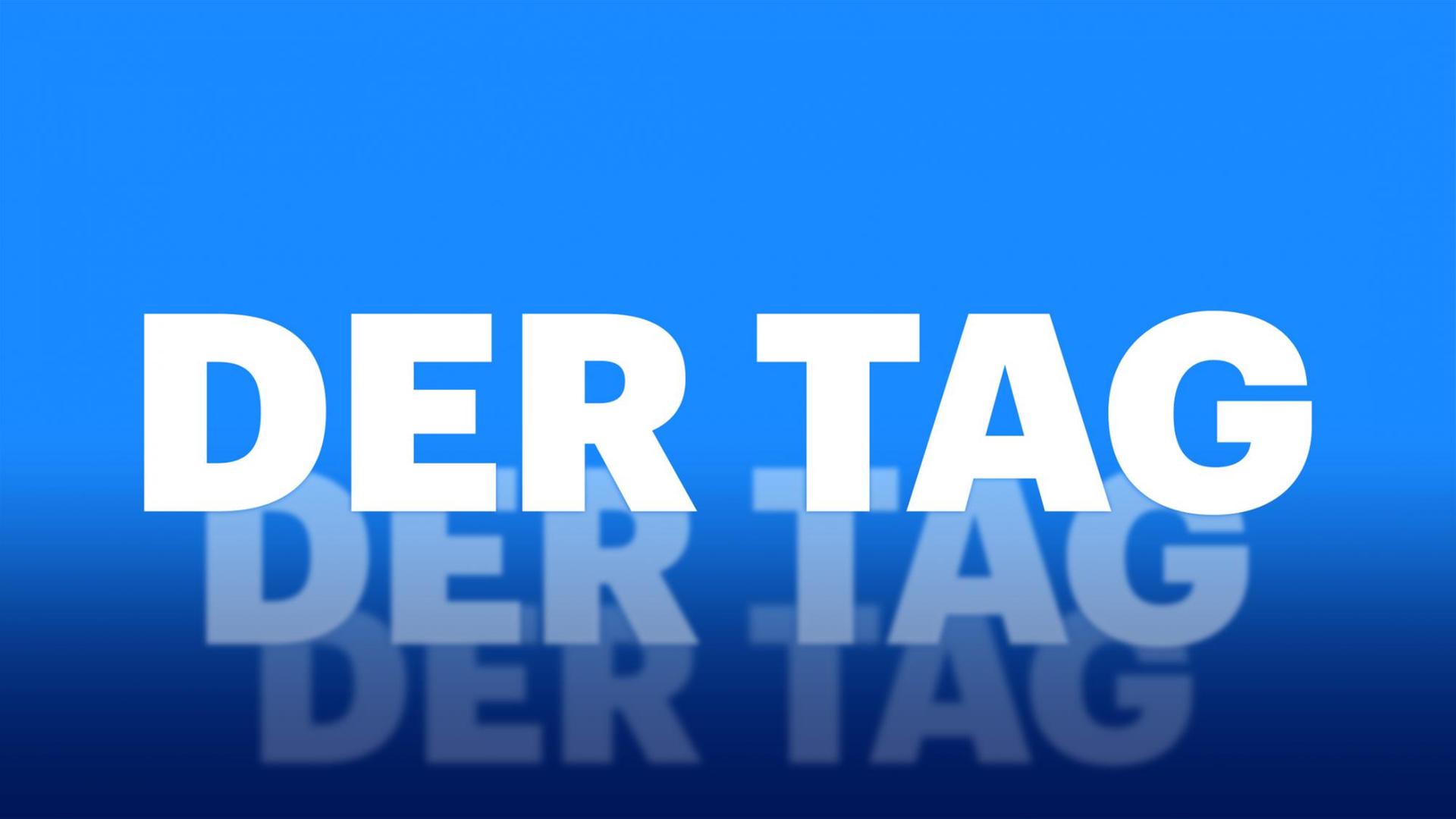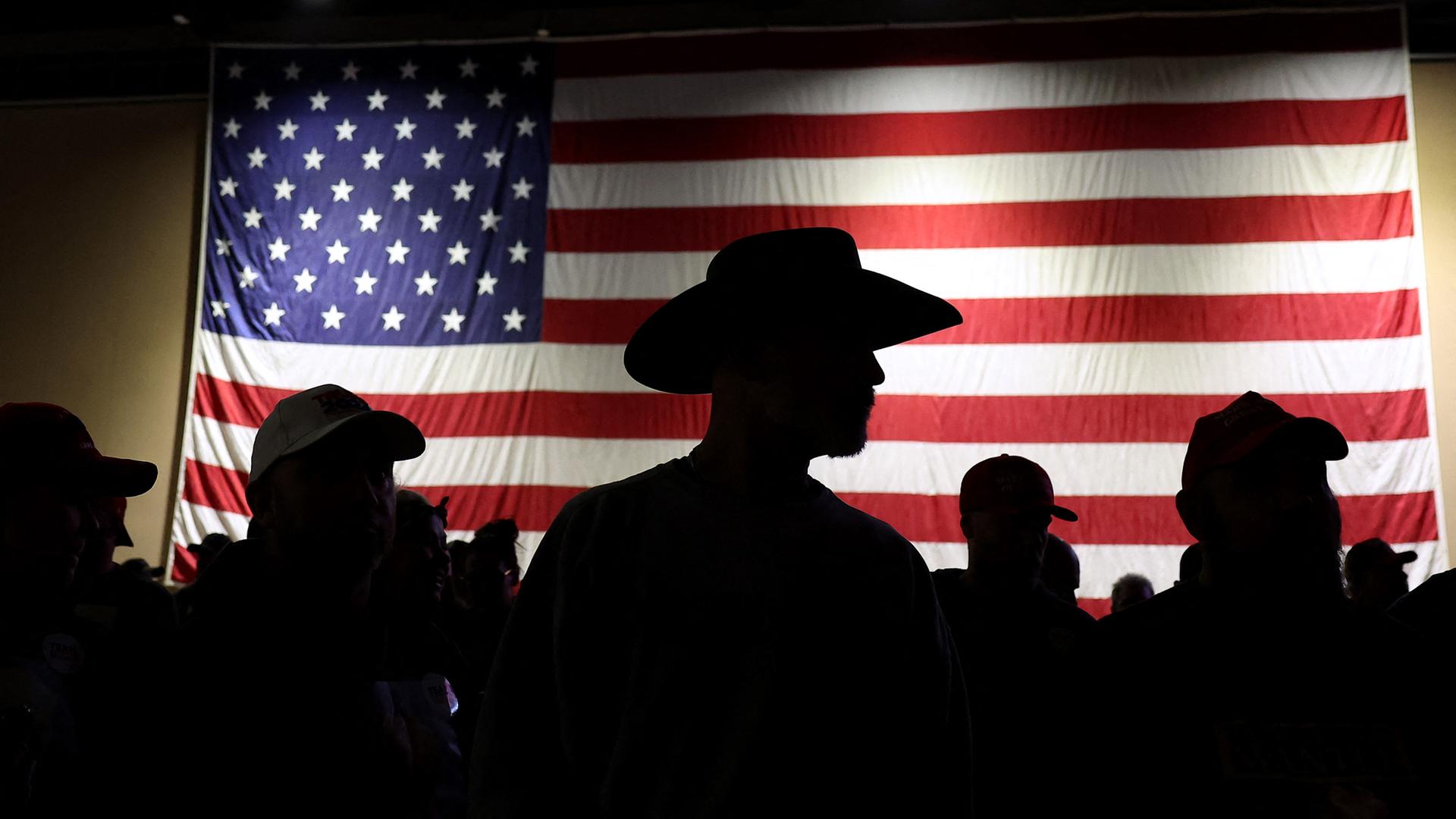Vereinbart wurde eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen. Im Beschlusstext ist von einem "Globalen Umsetzungsbeschleuniger" die Rede, also einer Plattform auf freiwilliger Basis für Länder, die beim Klimaschutz Tempo machen wollen. Zur Arbeit dieser Initiative soll den Teilnehmern der Weltklimakonferenzen Bericht erstattet werden.
Geld für Anpassung an den Klimawandel
Reiche Staaten sollen ihre Klimahilfen an ärmere Länder zur Anpassung an die Folgen der Erderwärmung deutlich erhöhen. Im Beschluss wird nun zu einer Verdreifachung der Zusagen von 2019 bis zum Jahr 2035 aufgerufen. Damals hatten die Industrieländer eine Aufstockung dieser Hilfen auf 40 Milliarden Dollar versprochen. Da dieses Versprechen aber dieses Jahr voraussichtlich nicht eingehalten wird, warnen Entwicklungsorganisationen, dass am Ende nicht die erhoffte Summe von jährlich 120 Milliarden Dollar für die Anpassung zusammenkommt. Die Organisation "Brot für die Welt" kritisierte, auch die Bundesregierung habe in dem Punkt zu den Bremsern gehört.
Geld für den Regenwald
Gestartet wurde von Brasilien ein neuer Fonds zum Schutz der Regenwälder. Mehr als eine Milliarde Hektar Regenwald in über 70 Ländern soll durch die sogenannte Tropical Forest Forever Facility (TFFF) erhalten werden. Norwegen hat über die nächsten zehn Jahre eine Summe von drei Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Brasilien und Indonesien beteiligen sich mit jeweils einer Milliarde Dollar. Aus Deutschland soll über die nächsten zehn Jahre eine Milliarde Euro fließen.
Der Fonds soll neben öffentlichen Gebern auch Geld von privaten Investoren einwerben und Gesamtsumme am Kapitalmarkt angelegt werden. Mit einem Teil der erwirtschafteten Erträge sollen Länder, die ihre Regenwälder erhalten, belohnt werden. Im Raum stehen jährlich vier Dollar für jeden Hektar Regenwald, der erhalten wird. Umgekehrt sollen Strafzahlungen für jeden zerstörten Hektar Wald gezahlt werden.
Einen konkreten "Waldaktionsplan", um die Zerstörung von Wald einzudämmen, beschloss die Konferenz hingegen nicht. Es wird lediglich an einen früheren Beschluss erinnert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen."
Handelsmaßnahmen
Beim Thema der Handelsmaßnahmen soll erstmals ein Dialog unter Einbeziehung von Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO gestartet werden. Dies geht auf Vorwürfe von Schwellen- und Entwicklungsländern zurück, dass sich einige klimapolitische Handelsmaßnahmen der EU wie etwa der Grenzausgleichsmechanismus CBAM unverhältnismäßig negativ auf sie auswirken. Dabei handelt es sich um eine CO2-Abgabe auf klimaschädlich produzierte Güter. In dem Abschlusspapier wurde daher ein dreijähriger Dialog beschlossen, um solche Probleme zu bearbeiten.
Kein Fahrplan für Abkehr von fossilen Energien
Die internationale Gemeinschaft ist weit davon entfernt, gemäß dem Pariser Klimaabkommen die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Inzwischen geht die Wissenschaft davon aus, dass dieses Ziel mindestens befristet überschritten wird, und zwar schon spätestens zu Beginn der 2030er Jahre. Die Folgen wären mehr und heftigere Stürme, Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen.
Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels standen eigentlich nicht auf der offiziellen Aufgabenliste dieser COP, wurden dennoch viel diskutiert. Brasiliens Präsident Lula hatte kurz vor Konferenzbeginn überraschend einen Fahrplan für den globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorgeschlagen. Mehr als 80 Staaten unterstützten diesen, darunter Deutschland und seine EU-Partner. Allerdings stemmten sich Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland dagegen. Auch China und Indien wollten nicht mitmachen. In dem achtseitigen Abschlusspapier kommt das Thema nur indirekt vor, mit einem Verweis auf den Beschluss der Weltklimakonferenz vor zwei Jahren in Dubai. Damals einigten sich die Teilnehmer auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen – ohne zu präzisieren, wann und wie dies geschehen soll.
Reaktionen auf die Ergebnisse
Nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Guterres hat die COP30 wohl viele enttäuscht, insbesondere junge Menschen, indigene Völker und alle, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Ähnlich äußerte sich Bundesumweltminister Schneider (SPD) und warf den Ölstaaten eine Blockadetaktik vor. Weitere Reaktionen fassen wir hier zusammen.
Nächste Weltklimakonferenz in der Türkei
Die nächste Weltklimakonferenz soll vom 9. bis 20. November im türkischen Badeort Antalya stattfindet. Die Türkei stellt den COP-Präsidenten, Australien wird den Vize-COP-Vorsitz übernehmen und den Vorsitz der Verhandlungen. Beide Länder hatten um die Ausrichterrolle konkurriert. Hätten sie sich nicht bis zum Fristende am Freitag geeinigt, hätte die Weltklimakonferenz kommendes Jahr automatisch in Bonn stattgefunden, dem Sitz des UNO-Klimasekretariats.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.