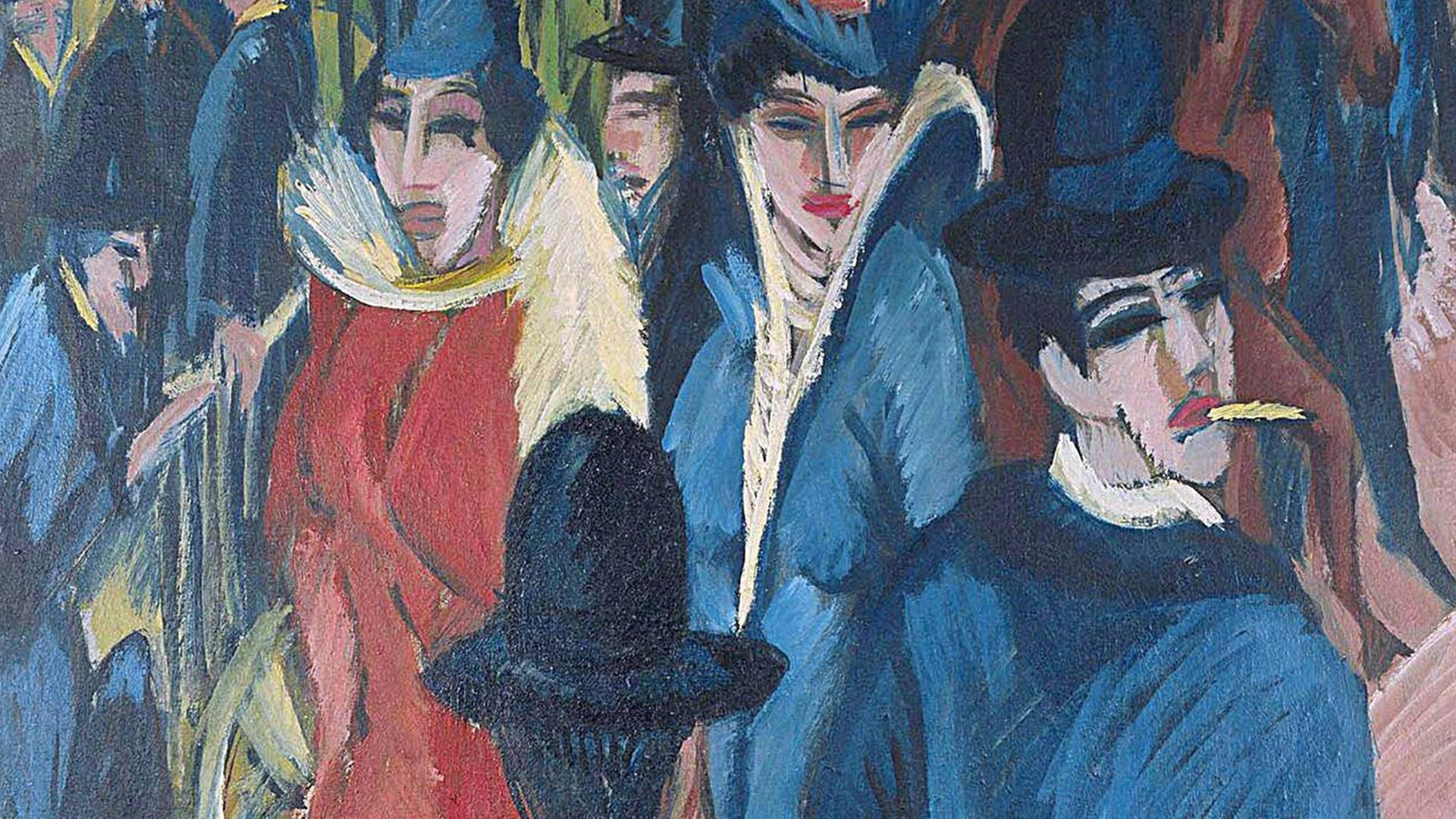
Zur Versachlichung der Debatte soll sie beitragen, nach den bisweilen schrillen Tönen in Berlin um die Rückgabe des Kirchner-Gemäldes, die Konferenz in Potsdam. Doch zu Beginn gießt der ehemalige Bundeskulturminister Michael Naumann Öl ins Feuer - mit einer Medienschelte und einem Rundumschlag gegen all jene, die die Rückgabe des Kirchner-Gemäldes an die Erben der früheren jüdischen Eigentümer kritisiert hatten. Ihnen wirft der SPD-Politiker historische Unkenntnis vor - und verschwindet nach seinem Vortrag, ohne dass die Gescholtenen eine Möglichkeit zur Verteidigung haben. Michael Naumann wörtlich:
"Über die Ausmaße und historischen Begründungen moralischen Handelns zu räsonieren setzt nicht nur juristisch schwer zu definierenden Anstand, sondern auch zumindest umrisshafte Kenntnisse der deutschen Geschichte des Dritten Reiches. Und daran sollte es bisweilen in deutschen Museen, in denen Provenienzforschung nur ein Nebenfach war und ist, durchaus mangeln. "
Einig sind sich die Konferenzteilnehmer - Kunsthändler, Museumsdirektoren, Rechtsanwälte, Kunsthistoriker, Vertreter jüdischer Organisationen - in einem Punkt: die Verfahren zur Rückgabe von Raubkunst müssen transparenter werden. Georg Heuberger, Repräsentant der Jewish Claims Conference in Deutschland:
"Transparenz ist ein Wort, da sind sich alle einig, jeder will sie und befürwortet sie, aber sie wird nicht praktiziert. Es gibt keine Transparenz in den Museen und Organisationen, jeder führt mehr oder weniger Provenienzforschung durch, man weiß nicht, welche Restitutionsforderungen gestellt werden an die Museen. "
Denn die Museen folgen einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, ihre Bestände nach Raubkunst zu untersuchen und diese Objekte gegebenenfalls an die rechtmäßigen Eigentümer beziehungsweise deren Erben zurückzugeben.
"Das hat den Nachteil, dass es keine rechtsstaatliche Kontrolle gibt dieser Entscheidungen, die sind sehr intransparent, der Mauschelei wird Tür und Tor geöffnet, es ist nämlich nicht justiziabel, nicht überprüfbar, es ist ein freiwilliges Softlaw, ein freiwilliges Procedere, "
sagt der Rechtsanwalt Hans Hartung, der sich auf internationales Kunstrecht spezialisiert hat. Er wünscht sich klare Gesetze und Verjährungsfristen bei NS-Raubkunst. Der Repräsentant der Jewish Claims Conference widerspricht. Neue Gesetze seien nicht nötig, wichtig sei ein klares Verfahren, das die jüdischen Opfer beziehungsweise deren Erben beteiligt.
"Selbst eine Institution wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die vorbildlich Provenienzforschung betreibt und die auch restituiert hat, hat nur die Entscheidung des Präsidenten im Einzelfall vorgesehen, gegen die keine Möglichkeit des Widerspruchs oder irgend eines Verfahren möglich sind. "
Heuberger fordert alle deutschen Museen auf, sich stärker als bislang der Provenienzforschung zu widmen, ihre Depots und Archive nach NS-Raubkunst zu durchsuchen. Ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung ist dies nicht zu leisten, widerspricht Martin Roth, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
"Was dazu kommt ist, dass die Museen relativ stark alleine gelassen worden sind. Natürlich war es ein politischer Anspruch, aber recherchiert haben nur die Museen, natürlich war es ein politischer Anspruch, aber Geld aufgetrieben haben nur die Museen, natürlich ist zum Schluss politisch entschieden worden, an den Museen vorbei. Und bis zu diesem Zeitpunkt standen wir alleine da. "
Provenienzforschung sei unglaublich aufwendig, sagt Martin Roth. Viele ostdeutsche Museen wüssten überhaupt nicht, was alles in ihren Depots lagere, von der Herkunft der Kunstobjekte ganz zu schweigen.
"Über die Ausmaße und historischen Begründungen moralischen Handelns zu räsonieren setzt nicht nur juristisch schwer zu definierenden Anstand, sondern auch zumindest umrisshafte Kenntnisse der deutschen Geschichte des Dritten Reiches. Und daran sollte es bisweilen in deutschen Museen, in denen Provenienzforschung nur ein Nebenfach war und ist, durchaus mangeln. "
Einig sind sich die Konferenzteilnehmer - Kunsthändler, Museumsdirektoren, Rechtsanwälte, Kunsthistoriker, Vertreter jüdischer Organisationen - in einem Punkt: die Verfahren zur Rückgabe von Raubkunst müssen transparenter werden. Georg Heuberger, Repräsentant der Jewish Claims Conference in Deutschland:
"Transparenz ist ein Wort, da sind sich alle einig, jeder will sie und befürwortet sie, aber sie wird nicht praktiziert. Es gibt keine Transparenz in den Museen und Organisationen, jeder führt mehr oder weniger Provenienzforschung durch, man weiß nicht, welche Restitutionsforderungen gestellt werden an die Museen. "
Denn die Museen folgen einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, ihre Bestände nach Raubkunst zu untersuchen und diese Objekte gegebenenfalls an die rechtmäßigen Eigentümer beziehungsweise deren Erben zurückzugeben.
"Das hat den Nachteil, dass es keine rechtsstaatliche Kontrolle gibt dieser Entscheidungen, die sind sehr intransparent, der Mauschelei wird Tür und Tor geöffnet, es ist nämlich nicht justiziabel, nicht überprüfbar, es ist ein freiwilliges Softlaw, ein freiwilliges Procedere, "
sagt der Rechtsanwalt Hans Hartung, der sich auf internationales Kunstrecht spezialisiert hat. Er wünscht sich klare Gesetze und Verjährungsfristen bei NS-Raubkunst. Der Repräsentant der Jewish Claims Conference widerspricht. Neue Gesetze seien nicht nötig, wichtig sei ein klares Verfahren, das die jüdischen Opfer beziehungsweise deren Erben beteiligt.
"Selbst eine Institution wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die vorbildlich Provenienzforschung betreibt und die auch restituiert hat, hat nur die Entscheidung des Präsidenten im Einzelfall vorgesehen, gegen die keine Möglichkeit des Widerspruchs oder irgend eines Verfahren möglich sind. "
Heuberger fordert alle deutschen Museen auf, sich stärker als bislang der Provenienzforschung zu widmen, ihre Depots und Archive nach NS-Raubkunst zu durchsuchen. Ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung ist dies nicht zu leisten, widerspricht Martin Roth, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
"Was dazu kommt ist, dass die Museen relativ stark alleine gelassen worden sind. Natürlich war es ein politischer Anspruch, aber recherchiert haben nur die Museen, natürlich war es ein politischer Anspruch, aber Geld aufgetrieben haben nur die Museen, natürlich ist zum Schluss politisch entschieden worden, an den Museen vorbei. Und bis zu diesem Zeitpunkt standen wir alleine da. "
Provenienzforschung sei unglaublich aufwendig, sagt Martin Roth. Viele ostdeutsche Museen wüssten überhaupt nicht, was alles in ihren Depots lagere, von der Herkunft der Kunstobjekte ganz zu schweigen.