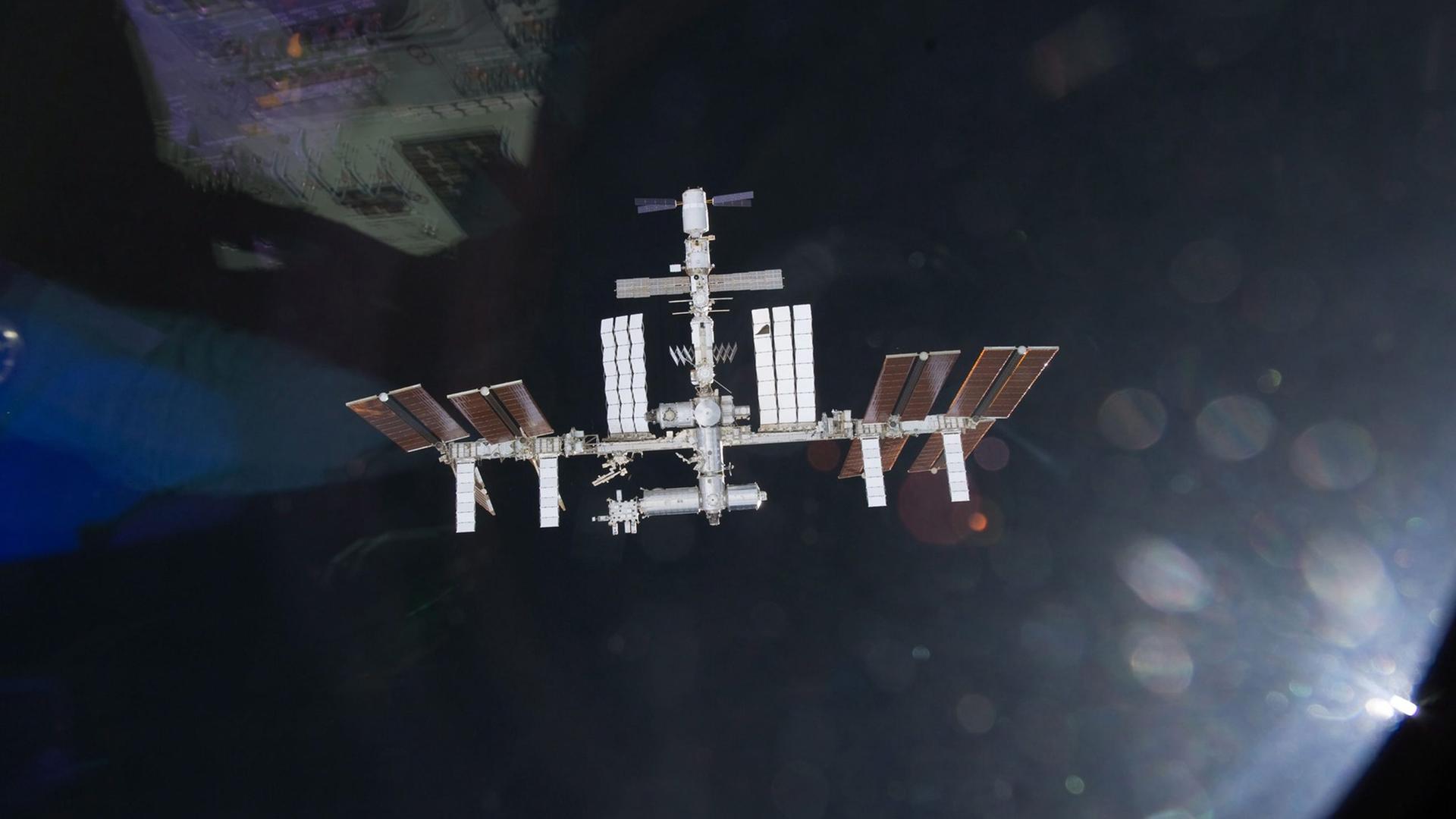Die Raumfahrt hat ein großes Problem: Sie erstickt in ihrem eigenen Müll. Bestimmte Umlaufbahnen sind bereits stark mit alten Raketenstufen, ausgefallenen Satelliten und Trümmerstücken verschmutzt. Das sorgt auch Jan Wörner, den Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. "Man schätzt etwa 600.000 Teilchen von einer Größe von mehr als einem Zentimeter. Und wenn man überlegt, dass die alle mit einer Geschwindigkeit von mehr als 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde sausen, dann ist das natürlich eine Gefahr für andere Systeme, seien sie nun robotisch oder astronautisch."
Damit die Trümmer ihren eigenen Satelliten nicht in die Quere kommen, muss die ESA die Umlaufbahnen des Weltraummülls möglichst genau kennen. Momentan ist die ESA dazu nur mit der Hilfe des US-amerikanischen Militärs in der Lage. Eine der wenigen europäischen Überwachungsstationen für Weltraumschrott steht in Wachtberg südlich von Bonn: eine riesige weiße Kuppel, in der lieblichen Hügellandschaft der Voreifel.
Kontrollraum wie bei den Fluglotsen
"Betreten des Innenraums nur mit Helm." Ludger Leushacke ist Leiter des TIRA-Radars. Er führt unter die Radom-Kuppel, in der sich eine 34 Meter große Radarschüssel dreht, hoch wie ein zwölfgeschossiges Gebäude. Betreiber verschiedener Satelliten aus aller Welt nutzen regelmäßig ihre Dienste. "Im Fall von abstürzenden Satelliten, im Fall von drohenden Kollisionen von Satelliten, bei Beschädigungen von Satelliten, bei der Erfassung von wirklich kleinen Raumfahrttrümmern."
Der Kontrollraum von TIRA sieht aus wie der Arbeitsplatz eines Fluglotsen. Von hier verfolgen die Ingenieure die vorbeiziehenden Satelliten. Das Radar kann Bilder schießen, sogar eine Filmsequenz liefern, wenn ein Satellit im All unkontrolliert taumelt. Doch immer liefert TIRA nur eine Momentaufnahme eines kleinen Himmelsausschnitts. Für eine umfassende Kartierung aller Trümmer im Orbit eignet es sich nicht. Deswegen entwickelt das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, zu dem TIRA gehört, derzeit ein neues Radar namens GESTRA. "Mit dem sollen all die Dinge getestet werden, um zu einem sogenannten Katalog zu kommen. Das heißt, zu einer jederzeit aktuellen Datenbank von Bahnen aller größeren Objekte."
Deutsches Radar ohne die ESA
GESTRA besteht, anders als die große Radarkuppel, nicht aus einer einzelnen Antenne, sondern aus mehreren kleinen, die zusammengeschaltet werden. Würde man sie an günstige Standorte über Europa verteilen, könnte der Antennenverbund einmal helfen, die Abhängigkeit von den amerikanischen Überwachungsdaten zu überwinden. Das jedenfalls hofft Holger Krag, der bei der ESA für die Weltraumüberwachung verantwortlich ist. "Worauf wir hinaus wollen, ist ein System, mit dem man ohne Vorkenntnisse neue Objekte entdecken kann, systematisch nachverfolgen kann, mehrere male pro Tag und das idealerweise bis hinunter zu einer Größe von etwa einem Fußballdurchmesser und die in einem Katalog halten."
GESTRA ist allerdings kein europäisches Projekt: Der Name steht für "German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar", beauftragt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und betrieben von der Bundeswehr. In einer Pressemitteilung zum Start des Projekts heißt es, die Radardaten würden "Forschungseinrichtungen in Deutschland zur Verfügung gestellt". Das heißt, selbst die ESA könnte zunächst einmal außen vor bleiben. Generaldirektor Jan Wörner will darin zumindest langfristig aber kein Problem sehen. Denn ein kontinent-überspannendes Überwachungssystem würde viele Milliarden Euro kosten und könnte ohnehin nur gemeinsam aufgebaut werden. "Natürlich gibt es immer auf der nationalen Ebene immer irgendwelche Grenzen, die man zu beachten hat, aber ich glaube schon, dass das Verständnis da ist, dass man das zusammentut."