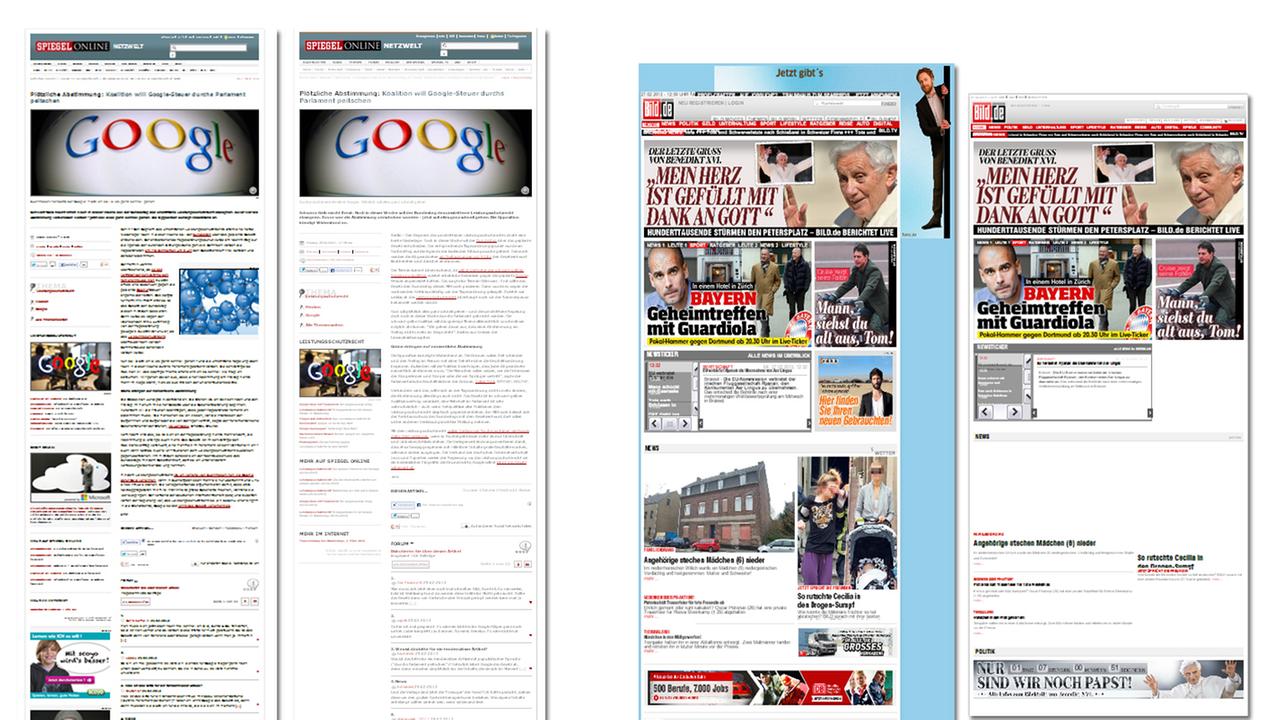
Manchmal wirkt Onlinewerbung heutzutage fast schon unheimlich – und das nicht nur wegen der wild blinkender Werbebanner, erzählt Florian Glatzner, Internetexperte vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
"Ich schau mir in einem Onlineshop ein gewisses Paar Schuhe an und entscheide mich doch dagegen es zu diesem Zeitpunkt zu kaufen. Jetzt surfe ich weiter durch das Web und bin auf ganz anderen Seiten. Und plötzlich wird mir da dann genau Werbung für diese Schuhe, die ich mir gerade angeschaut habe, eingeblendet."
Das ist möglich, weil Werbebanner nur selten auf demselben Computer gespeichert sind, wie die eigentliche Webseite. Meist kommen sie aus den Rechenzentren einiger weniger sogenannter Werbevermarkter oder Werbenetzwerke, die Millionen Webseiten gleichzeitig mit Anzeigen beliefern.
Beim Aufrufen einer Webseite schicken diese Netzwerke nicht nur ihre blinkenden Werbebanner zum Nutzer – sondern auch einen so genannten Cookie, eine kleine Datei, die im Browserspeicher abgelegt wird. Mit so einem Cookie kann die Werbefirma den Nutzer auf jeder Webseite, die von ihr mit Anzeigen beliefert wird eindeutig wiedererkennen. Und mit jedem eingeblendeten Werbebanner erfährt die Firma mehr über den Nutzer - und legt und nach und nach ein genaues Interessen-Profil an: Welche Nachrichten liest er? Was für Artikel schaue er sich in Onlineshops an? Was für Anzeigen zu was für Produkten hat er in der Vergangenheit schon einmal angeklickt? Dieses so genannte "Tracking" – zu Deutsch etwa "Verfolgen" des Nutzers - passiert im Hintergrund beim Laden der Webseite. Der Nutzer bemerkt davon in der Regel nichts.
Kleine Zusatzprogramme können die Schnüffelcookies allerdings sichtbar machen. Tatsächlich sammeln auf vielen Webseiten sogar mehrere Werbenetzwerke gleichzeitig Daten.
"Ich hab jetzt hier mal die Adresse eines Onlineshops eingegeben und sehe, dass mir dort 53 Drittanbieter-Cookies auf den Rechner gespielt werden. Also 53 Cookies von irgendwelchen Drittunternehmen, die mich eben anhand dieses Cookies identifizieren wollen und mich dann über das Netz weiterverfolgen."
Aus Sicht der Webseiten-Betreiber sind Werbe-Cookies und Benutzerprofile sogar eine Art Wohltat für die Nutzer. Schließlich bekommt er dadurch Werbung zu Themen und Produkten, die ihn höchstwahrscheinlich auch interessieren. Auch Jens Ihlenfeld, Geschäftsführer beim Computer-Nachrichtenportal Golem.de verteidigt die Datensammlung auf der eigenen Webseite.
"Da kommt man schon deshalb nicht komplett drum rum, weil man ja dem Nutzer nicht immer die gleiche Werbung anzeigen möchte. Ich möchte ja zum Beispiel mitbekommen, ob ein Nutzer eine Werbung vielleicht schon fünfmal gesehen hat, und die ihm vielleicht nicht zum sechsten bis zehnten Mal vorsetzen, weil sie vermutlich keinen Erfolg mehr haben wird oder der Leser davon nur genervt ist."
Außerdem würden die Daten bei Golem und den allermeisten anderen deutschen Webseiten nur pseudonymisiert gesammelt, betont Ihlenfeld. Das heißt, der Werbeanbieter kennt zwar vielleicht die Interessen eines Nutzers und kann deshalb möglichst zielgenaue Werbeanzeigen einblenden. Die E-Mail-Adresse, den Namen oder die Anschrift übermitteln die die Webseitenanbieter aber nicht. Technisch ist es jedoch überhaupt kein Problem, die gesammelten Daten später beispielsweise mit Informationen aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google Plus zu verknüpfen. Nach europäischem Datenschutzrecht ist das zwar nicht erlaubt. Allerdings sitzen einige der größten Werbevermarkter ohnehin außerhalb Europas. Und selbst europäische Werbenetzwerke arbeiten zumindest teilweise in einem juristischem Graubereich, warnt Verbraucherschützer Glatzner.
"Die Sicherheit, dass die Daten nicht missbraucht werden gibt es nicht. Und wir wissen auch nicht, was da genau passiert. Der Verbraucher kann nicht genau überblicken, welche Daten jetzt zu welchem Zweck wohin übertragen werden und ob sie möglicherweise mit anderen Daten zusammengeführt werden."
Allerdings können sich die Nutzer gegen die heimlich Datensammlung auch wehren. So lassen sich in den meisten Browsern die Cookies von den so genannten "Drittanbietern" deaktivieren und mit kleinen Zusatzprogrammen oder "Add-Ons" auch einige weitere Tracking-Schnüffel-Techniken blockieren.
"Ich schau mir in einem Onlineshop ein gewisses Paar Schuhe an und entscheide mich doch dagegen es zu diesem Zeitpunkt zu kaufen. Jetzt surfe ich weiter durch das Web und bin auf ganz anderen Seiten. Und plötzlich wird mir da dann genau Werbung für diese Schuhe, die ich mir gerade angeschaut habe, eingeblendet."
Das ist möglich, weil Werbebanner nur selten auf demselben Computer gespeichert sind, wie die eigentliche Webseite. Meist kommen sie aus den Rechenzentren einiger weniger sogenannter Werbevermarkter oder Werbenetzwerke, die Millionen Webseiten gleichzeitig mit Anzeigen beliefern.
Beim Aufrufen einer Webseite schicken diese Netzwerke nicht nur ihre blinkenden Werbebanner zum Nutzer – sondern auch einen so genannten Cookie, eine kleine Datei, die im Browserspeicher abgelegt wird. Mit so einem Cookie kann die Werbefirma den Nutzer auf jeder Webseite, die von ihr mit Anzeigen beliefert wird eindeutig wiedererkennen. Und mit jedem eingeblendeten Werbebanner erfährt die Firma mehr über den Nutzer - und legt und nach und nach ein genaues Interessen-Profil an: Welche Nachrichten liest er? Was für Artikel schaue er sich in Onlineshops an? Was für Anzeigen zu was für Produkten hat er in der Vergangenheit schon einmal angeklickt? Dieses so genannte "Tracking" – zu Deutsch etwa "Verfolgen" des Nutzers - passiert im Hintergrund beim Laden der Webseite. Der Nutzer bemerkt davon in der Regel nichts.
Kleine Zusatzprogramme können die Schnüffelcookies allerdings sichtbar machen. Tatsächlich sammeln auf vielen Webseiten sogar mehrere Werbenetzwerke gleichzeitig Daten.
"Ich hab jetzt hier mal die Adresse eines Onlineshops eingegeben und sehe, dass mir dort 53 Drittanbieter-Cookies auf den Rechner gespielt werden. Also 53 Cookies von irgendwelchen Drittunternehmen, die mich eben anhand dieses Cookies identifizieren wollen und mich dann über das Netz weiterverfolgen."
Aus Sicht der Webseiten-Betreiber sind Werbe-Cookies und Benutzerprofile sogar eine Art Wohltat für die Nutzer. Schließlich bekommt er dadurch Werbung zu Themen und Produkten, die ihn höchstwahrscheinlich auch interessieren. Auch Jens Ihlenfeld, Geschäftsführer beim Computer-Nachrichtenportal Golem.de verteidigt die Datensammlung auf der eigenen Webseite.
"Da kommt man schon deshalb nicht komplett drum rum, weil man ja dem Nutzer nicht immer die gleiche Werbung anzeigen möchte. Ich möchte ja zum Beispiel mitbekommen, ob ein Nutzer eine Werbung vielleicht schon fünfmal gesehen hat, und die ihm vielleicht nicht zum sechsten bis zehnten Mal vorsetzen, weil sie vermutlich keinen Erfolg mehr haben wird oder der Leser davon nur genervt ist."
Außerdem würden die Daten bei Golem und den allermeisten anderen deutschen Webseiten nur pseudonymisiert gesammelt, betont Ihlenfeld. Das heißt, der Werbeanbieter kennt zwar vielleicht die Interessen eines Nutzers und kann deshalb möglichst zielgenaue Werbeanzeigen einblenden. Die E-Mail-Adresse, den Namen oder die Anschrift übermitteln die die Webseitenanbieter aber nicht. Technisch ist es jedoch überhaupt kein Problem, die gesammelten Daten später beispielsweise mit Informationen aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google Plus zu verknüpfen. Nach europäischem Datenschutzrecht ist das zwar nicht erlaubt. Allerdings sitzen einige der größten Werbevermarkter ohnehin außerhalb Europas. Und selbst europäische Werbenetzwerke arbeiten zumindest teilweise in einem juristischem Graubereich, warnt Verbraucherschützer Glatzner.
"Die Sicherheit, dass die Daten nicht missbraucht werden gibt es nicht. Und wir wissen auch nicht, was da genau passiert. Der Verbraucher kann nicht genau überblicken, welche Daten jetzt zu welchem Zweck wohin übertragen werden und ob sie möglicherweise mit anderen Daten zusammengeführt werden."
Allerdings können sich die Nutzer gegen die heimlich Datensammlung auch wehren. So lassen sich in den meisten Browsern die Cookies von den so genannten "Drittanbietern" deaktivieren und mit kleinen Zusatzprogrammen oder "Add-Ons" auch einige weitere Tracking-Schnüffel-Techniken blockieren.