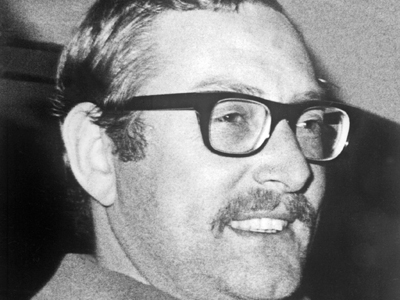Eric Leimann: Im ersten Teil dieses Dokumentarfilms erfährt man, dass die Mehrheit der Briten in den 60er-Jahren klar aufseiten der Verbrecher stand. Wie konnte das geschehen?
Nick Reynolds: Als der Zugüberfall passierte, befand sich die Nation in einer Art Schockzustand. Gerade war die Affäre unseres Kriegsministers mit einem Callgirl aufgeflogen, das gleichzeitig etwas mit einem hohen Offizier der sowjetischen Marine hatte. Eine mögliche Agentin also. In England war man zu dieser Zeit unglaublich prüde. Die Leute hätten die Regierung am liebsten einfach weggejagt, ihnen fehlten nur die Mittel dazu. Nach dem Überfall auf den Zug sah man die Räuber als eine Art verlängerten Arm des Volkes. Bildlich gesprochen kann man sagen: Das Establishment hatte die Hosen herunter gelassen und die Räuber gaben ihnen nun einen kräftigen Tritt in den entblößten Hintern. Im Namen des Volkes! Auch die Presse war damals nicht gut auf die Regierung zu sprechen. Sie nahmen den Zugüberfall dankend an und machten daraus eine Kriminal-Seifenoper. Die läuft nun seit 50 Jahren. Wahrscheinlich haben die Medien sehr viel mehr Geld mit diesem Thema verdient, als die Täter damals erbeuteten.
Leimann: Wie alt waren Sie, als Sie begriffen, wie groß diese ganze Geschichte war - und dass Sie weit über ihr persönliches Leben hinausreichte?
Reynolds: Das war recht spät. Ich war vielleicht 14. Bis dahin wusste ich, dass mein Vater in einer Gang gewesen ist und sie Geld gestohlen hatten. Darüber hinaus hatte diese Geschichte wenig mit meinem eigenen Leben zu tun. Meine Mutter und ich erzählten niemanden davon, es war ein Geheimnis zwischen uns. Als ich 14 war, erschien ein Buch, das auch als Serie in einer großen Zeitung abgedruckt wurde. Mein Vater saß damals noch im Knast, aber die bereits frei gelassenen Bandenmitglieder erzählten darin ihre Geschichte. Bis dahin hatte mich das alles kaum interessiert - es war schon so lange her. Diese Geschichte hatte mir meinen Vater für zehn Jahre weggenommen, auch deshalb hatte ich keine große Lust, mich damit zu beschäftigen. Das änderte sich mit 14. Ich war sehr aufgeregt und wollte Leuten davon erzählen, aber ich durfte nicht.
Leimann: Wie hat diese Erkenntnis ihr Leben verändert? Sie haben ja zunächst mal etwas sehr Staatstreues getan und sind Marinesoldat geworden...
Reynolds: Die Geschichte klebt seitdem förmlich an mir. Ich habe versucht sie abzuschütteln - aber sie kommt immer wieder zurück. Damals ging ich zur Navy, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Es hieß, mein Vater wird aus der Haft entlassen. Während er im Gefängnis war, hatte ich ihn einmal pro Monat für eine Stunde besuchen dürfen. Da machte er immer große Pläne, was wir alles tun würden, wenn er erst draußen sei. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst vor der Situation und ging deshalb zum Militär. Um mir erst mal Zeit und Raum zu erkaufen. Es war eine seltsame Sache. Mein Vater sollte frei sein, also machte ich mich zum Gefangenen. Ich denke, es war eine Art stille Würdigung. Ich erzählte zum ersten Mal jemandem, wer mein Vater ist, da war ich schon in meinen Zwanzigern.
Leimann:. Wie alt waren Sie, als Ihr Vater entlassen wurde?
Reynolds: Ich war 17, als er rauskam. Ich glaube, dieses Navy-Ding machte ich auch deshalb, um den Namen Reynolds wieder sauber zu waschen. Mein ganzes Leben lang war ich immer sehr ehrlich und aufrichtig. Es ist ein Klischee, dass man selbst zum Verbrecher wird, nur weil dein Vater ein bekannter Verbrecher ist. Ich habe mich sehr bemüht, immer das komplette Gegenteil dieses Klischees zu sein.
Leimann: Sie sagen im Film, dass Ihr Vater ihr bester Freund war. Das ist eine erstaunliche Nähe, wenn man bedenkt, welch schwierige Geschichte Sie beide haben. Immerhin waren Sie durch das Gefängnis zehn Jahre getrennt, davor waren Sie als Kind auf der Flucht. All das scheint Ihr Verhältnis kaum belastet zu haben?
Reynolds: Nein, das hat unser Verhältnis stärker gemacht. Es gibt dieses alten Jesuiten-Spruch, der lautet: Gebt mir einen Jungen für sieben Jahre und ich zeige euch den Mann. Bevor mein Vater geschnappt wurde, verbrachte ich in meinen ersten sieben Lebensjahren sehr viel Zeit mit ihm. Ich sah ihn öfter als jedes andere Kind, weil wir ja zusammen auf der Flucht waren. Ich machte den ganzen Tag irgendwelche Sachen mit ihm. Er kam nie müde und übellaunig von der Arbeit nach Hause - so wie andere Väter: am Abend, kurz bevor die Kinder ins Bett müssen.
Unsere Beziehungen wurde jedoch noch intensiver, als er im Gefängnis saß. Er schrieb sehr schöne Briefe. Jede Woche bekam ich einen Umschlag, darin befand sich ein Brief von vier oder fünf Seiten. Dabei lagen auch Zeichnungen und kleine Cartoons. Er schrieb über Filme, weil er das Programm des Gefängnis-Kinos auswählte. Dazu gab es Postkarten mit Bildern berühmter Kunstwerke. Auf der Rückseite schrieb er etwas über das Kunstwerk und den Künstler. So erklärte er mir Kubismus oder Surrealismus. Mein Vater erzog mich vom Gefängnis aus. Jeder seiner Briefe war wie ein Weihnachtsgeschenk und selbst eine Art Kunstwerk.
Leimann: Wie hat sich ihr Vater in den zehn Jahren Gefängnis verändert?
Reynolds: Er hat sich komplett verändert. Als er ins Gefängnis ging, war er ein wütender Mann, der gegen das Establishment war. Im Knast las er unheimlich viel, er beschäftige sich intensiv mit Soziologie. In dieser Zeit lernte er, dass er mit vielem Unrecht hatte. Er lernte, dass andere Dinge im Leben wichtig sind, als er zuvor glaubte. Er ging in den Knast als berühmter Krimineller und kam als Ex-Krimineller heraus. Mein Vater hat sein Wertesystem komplett verschoben während dieser zehn Jahre. Als er dann frei war, wollte er vor allem schreiben. Außerdem kümmerte er sich sehr liebevoll um meine Mutter, die eine angeschlagene psychische Gesundheit hatte.
Leimann: Im Falle Ihres Vaters hat das Gefängnis also einen Mann verändert. Ein Prozess, den sich unser System so zwar wünscht, der in der Praxis jedoch eher selten ist...
Reynolds: Das Gefängnis hat auch ziemlich wenig zu dieser Entwicklung beigetragen. Mein Vater setzte sich einfach hin und überlegte, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen wollte. In seiner Kindheit wünschte er sich, der größte Räuber aller Zeiten werden. Das hatte er geschafft. Im Knast wurde ihm klar, dass er nun mit meiner Mutter und mir zusammen sein wollte. Er wusste, das ging nur, wenn er ein ehrliches Leben führt.
Leimann: Der zweite Teil des Films konzentriert sich auf die Familiengeschichten der Bandenmitglieder in den Jahren und Jahrzehnten nach der Tat. Fast hat man den Eindruck, die Zugräuber von 1963 seien im Grunde ihres Herzens vor allem Familienmenschen gewesen. Wie sehen Sie diesen Teil des Films?
Reynolds:Ja, das ist ein sehr typischer Zug für Londoner aus den 60-ern. Abseits ihres Jobs als Kriminelle, waren diese Kerle zu Hause wie jeder andere Mann auch. Sie saßen im Wohnzimmer, sahen fern und sprachen mit ihren Kindern über Fußball. Die Bande meines Vaters, das waren keine Monster, sondern normale Mitglieder der Arbeiterklasse. Familie war ein wichtiger Wert im England der damaligen Zeit. Wäre meinem Vater die Familie nicht so wichtig gewesen, hätte er alleine flüchten können. Als einzelner Mann ist man sehr viel beweglicher als mit Frau und kleinem Kind. Er hätte es ohne uns sehr viel leichter gehabt. Auch die anderen Bandenmitglieder sind mit ihren Familien geflohen.
Leimann: Glauben Sie, dass eine Geschichte wie diese heute noch einmal passieren könnte, oder ist sie doch eher zeittypisch?
Reynolds: Die Geschichte ist für alle Zeiten untypisch, weil sie einmalig ist. Ein Verbrechen wie dieses wird es nicht noch einmal geben. Der Film macht es am Ende deutlich: Heute kann man mit legalen Verbrechen, zum Beispiel am Finanzmarkt, sehr viel mehr Geld verdienen, als die Zugräuber damals. Man kann viele Millionen stehlen, ohne einmal vom Computer aufstehen zu müssen. Dazu kommt das Flair des Jahres 1963: die Regierungskrise, der Medienhype, die Beatles. Es gab Überfälle nach dem meines Vaters, bei denen mehr Geld erbeutet wurde. Die sind einen Tag in der Zeitung und dann wieder verschwunden. Heute sind solche Transporte schwer gesichert, sie werden unglaublich bewacht. Der Zugraub von 1963 steht dagegen wie eine Ikone für das besondere Flair dieser Zeit. Es ist eine Zeit, die vor allem in England sehr gefeiert wird. Das ist sicher auch der Grund, warum dieser Kriminalfall dort heute noch so populär ist - weil man ihn voller Nostalgie betrachten kann.
Leimann: Wie blickte Ihr Vater in seinen letzten Lebensjahren auf seine Tat zurück?
Reynolds: Wenn man ihn fragte, ob er alles noch mal genauso machen würde, sagte er in der Regel: ja. Er setzte allerdings voraus, dass er noch einmal genauso jung und auf dem gleichen Wissensstand von damals gewesen wäre. Er verstand sein Handeln von damals, auch wenn er es später bereute. Er hat sich nie für seine Tat geschämt. Es war einfach etwas, das er getan hatte, als er jung war. Wenn man ihn fragte, warum er den Überfall geplant und ausgeführt hatte, sagte er immer: ,Weil ich verrückt war.‘ Ich glaube, es ging ihm weniger ums Geld, als um die Herausforderung. Er plante die Tat aus dem gleichen Grund, warum andere Menschen die Eigernordwand hochklettern, um dort in einem Zelt zu schlafen (lacht).
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Programmtipp:
Heute zeigt "arte" um 20:15 Uhr die Dokumentation Die Gentlemen baten zur Kasse über den spektakulären Postzug-Überfall 1963 in Großbritannien.
Nick Reynolds: Als der Zugüberfall passierte, befand sich die Nation in einer Art Schockzustand. Gerade war die Affäre unseres Kriegsministers mit einem Callgirl aufgeflogen, das gleichzeitig etwas mit einem hohen Offizier der sowjetischen Marine hatte. Eine mögliche Agentin also. In England war man zu dieser Zeit unglaublich prüde. Die Leute hätten die Regierung am liebsten einfach weggejagt, ihnen fehlten nur die Mittel dazu. Nach dem Überfall auf den Zug sah man die Räuber als eine Art verlängerten Arm des Volkes. Bildlich gesprochen kann man sagen: Das Establishment hatte die Hosen herunter gelassen und die Räuber gaben ihnen nun einen kräftigen Tritt in den entblößten Hintern. Im Namen des Volkes! Auch die Presse war damals nicht gut auf die Regierung zu sprechen. Sie nahmen den Zugüberfall dankend an und machten daraus eine Kriminal-Seifenoper. Die läuft nun seit 50 Jahren. Wahrscheinlich haben die Medien sehr viel mehr Geld mit diesem Thema verdient, als die Täter damals erbeuteten.
Leimann: Wie alt waren Sie, als Sie begriffen, wie groß diese ganze Geschichte war - und dass Sie weit über ihr persönliches Leben hinausreichte?
Reynolds: Das war recht spät. Ich war vielleicht 14. Bis dahin wusste ich, dass mein Vater in einer Gang gewesen ist und sie Geld gestohlen hatten. Darüber hinaus hatte diese Geschichte wenig mit meinem eigenen Leben zu tun. Meine Mutter und ich erzählten niemanden davon, es war ein Geheimnis zwischen uns. Als ich 14 war, erschien ein Buch, das auch als Serie in einer großen Zeitung abgedruckt wurde. Mein Vater saß damals noch im Knast, aber die bereits frei gelassenen Bandenmitglieder erzählten darin ihre Geschichte. Bis dahin hatte mich das alles kaum interessiert - es war schon so lange her. Diese Geschichte hatte mir meinen Vater für zehn Jahre weggenommen, auch deshalb hatte ich keine große Lust, mich damit zu beschäftigen. Das änderte sich mit 14. Ich war sehr aufgeregt und wollte Leuten davon erzählen, aber ich durfte nicht.
Leimann: Wie hat diese Erkenntnis ihr Leben verändert? Sie haben ja zunächst mal etwas sehr Staatstreues getan und sind Marinesoldat geworden...
Reynolds: Die Geschichte klebt seitdem förmlich an mir. Ich habe versucht sie abzuschütteln - aber sie kommt immer wieder zurück. Damals ging ich zur Navy, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Es hieß, mein Vater wird aus der Haft entlassen. Während er im Gefängnis war, hatte ich ihn einmal pro Monat für eine Stunde besuchen dürfen. Da machte er immer große Pläne, was wir alles tun würden, wenn er erst draußen sei. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst vor der Situation und ging deshalb zum Militär. Um mir erst mal Zeit und Raum zu erkaufen. Es war eine seltsame Sache. Mein Vater sollte frei sein, also machte ich mich zum Gefangenen. Ich denke, es war eine Art stille Würdigung. Ich erzählte zum ersten Mal jemandem, wer mein Vater ist, da war ich schon in meinen Zwanzigern.
Leimann:. Wie alt waren Sie, als Ihr Vater entlassen wurde?
Reynolds: Ich war 17, als er rauskam. Ich glaube, dieses Navy-Ding machte ich auch deshalb, um den Namen Reynolds wieder sauber zu waschen. Mein ganzes Leben lang war ich immer sehr ehrlich und aufrichtig. Es ist ein Klischee, dass man selbst zum Verbrecher wird, nur weil dein Vater ein bekannter Verbrecher ist. Ich habe mich sehr bemüht, immer das komplette Gegenteil dieses Klischees zu sein.
Leimann: Sie sagen im Film, dass Ihr Vater ihr bester Freund war. Das ist eine erstaunliche Nähe, wenn man bedenkt, welch schwierige Geschichte Sie beide haben. Immerhin waren Sie durch das Gefängnis zehn Jahre getrennt, davor waren Sie als Kind auf der Flucht. All das scheint Ihr Verhältnis kaum belastet zu haben?
Reynolds: Nein, das hat unser Verhältnis stärker gemacht. Es gibt dieses alten Jesuiten-Spruch, der lautet: Gebt mir einen Jungen für sieben Jahre und ich zeige euch den Mann. Bevor mein Vater geschnappt wurde, verbrachte ich in meinen ersten sieben Lebensjahren sehr viel Zeit mit ihm. Ich sah ihn öfter als jedes andere Kind, weil wir ja zusammen auf der Flucht waren. Ich machte den ganzen Tag irgendwelche Sachen mit ihm. Er kam nie müde und übellaunig von der Arbeit nach Hause - so wie andere Väter: am Abend, kurz bevor die Kinder ins Bett müssen.
Unsere Beziehungen wurde jedoch noch intensiver, als er im Gefängnis saß. Er schrieb sehr schöne Briefe. Jede Woche bekam ich einen Umschlag, darin befand sich ein Brief von vier oder fünf Seiten. Dabei lagen auch Zeichnungen und kleine Cartoons. Er schrieb über Filme, weil er das Programm des Gefängnis-Kinos auswählte. Dazu gab es Postkarten mit Bildern berühmter Kunstwerke. Auf der Rückseite schrieb er etwas über das Kunstwerk und den Künstler. So erklärte er mir Kubismus oder Surrealismus. Mein Vater erzog mich vom Gefängnis aus. Jeder seiner Briefe war wie ein Weihnachtsgeschenk und selbst eine Art Kunstwerk.
Leimann: Wie hat sich ihr Vater in den zehn Jahren Gefängnis verändert?
Reynolds: Er hat sich komplett verändert. Als er ins Gefängnis ging, war er ein wütender Mann, der gegen das Establishment war. Im Knast las er unheimlich viel, er beschäftige sich intensiv mit Soziologie. In dieser Zeit lernte er, dass er mit vielem Unrecht hatte. Er lernte, dass andere Dinge im Leben wichtig sind, als er zuvor glaubte. Er ging in den Knast als berühmter Krimineller und kam als Ex-Krimineller heraus. Mein Vater hat sein Wertesystem komplett verschoben während dieser zehn Jahre. Als er dann frei war, wollte er vor allem schreiben. Außerdem kümmerte er sich sehr liebevoll um meine Mutter, die eine angeschlagene psychische Gesundheit hatte.
Leimann: Im Falle Ihres Vaters hat das Gefängnis also einen Mann verändert. Ein Prozess, den sich unser System so zwar wünscht, der in der Praxis jedoch eher selten ist...
Reynolds: Das Gefängnis hat auch ziemlich wenig zu dieser Entwicklung beigetragen. Mein Vater setzte sich einfach hin und überlegte, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen wollte. In seiner Kindheit wünschte er sich, der größte Räuber aller Zeiten werden. Das hatte er geschafft. Im Knast wurde ihm klar, dass er nun mit meiner Mutter und mir zusammen sein wollte. Er wusste, das ging nur, wenn er ein ehrliches Leben führt.
Leimann: Der zweite Teil des Films konzentriert sich auf die Familiengeschichten der Bandenmitglieder in den Jahren und Jahrzehnten nach der Tat. Fast hat man den Eindruck, die Zugräuber von 1963 seien im Grunde ihres Herzens vor allem Familienmenschen gewesen. Wie sehen Sie diesen Teil des Films?
Reynolds:Ja, das ist ein sehr typischer Zug für Londoner aus den 60-ern. Abseits ihres Jobs als Kriminelle, waren diese Kerle zu Hause wie jeder andere Mann auch. Sie saßen im Wohnzimmer, sahen fern und sprachen mit ihren Kindern über Fußball. Die Bande meines Vaters, das waren keine Monster, sondern normale Mitglieder der Arbeiterklasse. Familie war ein wichtiger Wert im England der damaligen Zeit. Wäre meinem Vater die Familie nicht so wichtig gewesen, hätte er alleine flüchten können. Als einzelner Mann ist man sehr viel beweglicher als mit Frau und kleinem Kind. Er hätte es ohne uns sehr viel leichter gehabt. Auch die anderen Bandenmitglieder sind mit ihren Familien geflohen.
Leimann: Glauben Sie, dass eine Geschichte wie diese heute noch einmal passieren könnte, oder ist sie doch eher zeittypisch?
Reynolds: Die Geschichte ist für alle Zeiten untypisch, weil sie einmalig ist. Ein Verbrechen wie dieses wird es nicht noch einmal geben. Der Film macht es am Ende deutlich: Heute kann man mit legalen Verbrechen, zum Beispiel am Finanzmarkt, sehr viel mehr Geld verdienen, als die Zugräuber damals. Man kann viele Millionen stehlen, ohne einmal vom Computer aufstehen zu müssen. Dazu kommt das Flair des Jahres 1963: die Regierungskrise, der Medienhype, die Beatles. Es gab Überfälle nach dem meines Vaters, bei denen mehr Geld erbeutet wurde. Die sind einen Tag in der Zeitung und dann wieder verschwunden. Heute sind solche Transporte schwer gesichert, sie werden unglaublich bewacht. Der Zugraub von 1963 steht dagegen wie eine Ikone für das besondere Flair dieser Zeit. Es ist eine Zeit, die vor allem in England sehr gefeiert wird. Das ist sicher auch der Grund, warum dieser Kriminalfall dort heute noch so populär ist - weil man ihn voller Nostalgie betrachten kann.
Leimann: Wie blickte Ihr Vater in seinen letzten Lebensjahren auf seine Tat zurück?
Reynolds: Wenn man ihn fragte, ob er alles noch mal genauso machen würde, sagte er in der Regel: ja. Er setzte allerdings voraus, dass er noch einmal genauso jung und auf dem gleichen Wissensstand von damals gewesen wäre. Er verstand sein Handeln von damals, auch wenn er es später bereute. Er hat sich nie für seine Tat geschämt. Es war einfach etwas, das er getan hatte, als er jung war. Wenn man ihn fragte, warum er den Überfall geplant und ausgeführt hatte, sagte er immer: ,Weil ich verrückt war.‘ Ich glaube, es ging ihm weniger ums Geld, als um die Herausforderung. Er plante die Tat aus dem gleichen Grund, warum andere Menschen die Eigernordwand hochklettern, um dort in einem Zelt zu schlafen (lacht).
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Programmtipp:
Heute zeigt "arte" um 20:15 Uhr die Dokumentation Die Gentlemen baten zur Kasse über den spektakulären Postzug-Überfall 1963 in Großbritannien.