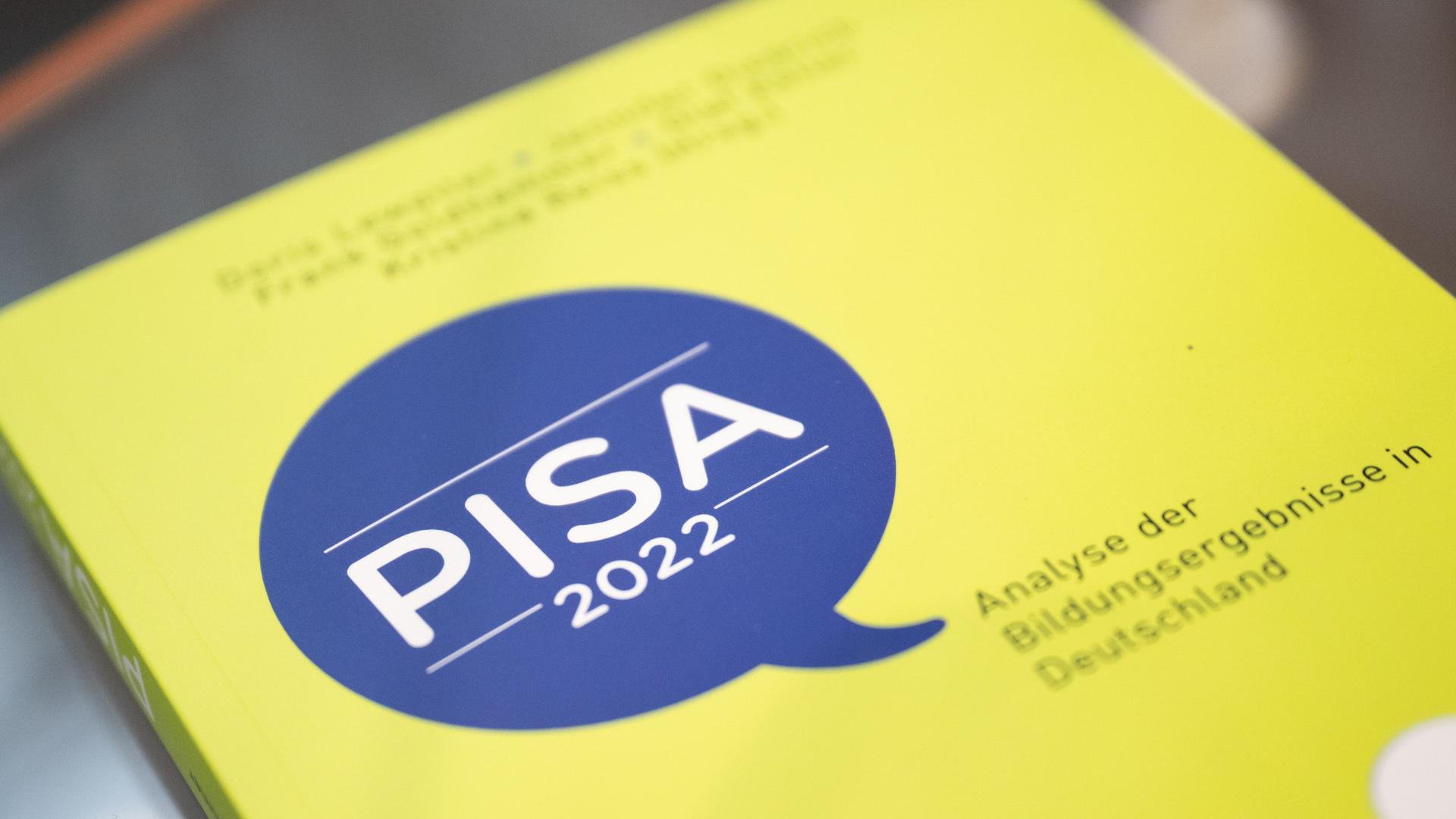
Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor, wie die RHEINISCHE POST aus Düsseldorf hervorhebt: "Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handelt es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals gemessen wurden. Zusammengefasst: Das Ergebnis ist nicht mehr mit ausreichend zu bewerten, sondern mit mangelhaft bis ungenügend. Es ist eine Schande für das reiche Deutschland. Die Schulschließungen während der Corona-Pandemie waren ein Fehler, auch das hat man nun schwarz auf weiß. Dies mag noch entschuldbar sein, weil man keine Erfahrungen im Umgang mit einer Pandemie hatte. Für den zweiten Grund aber trägt allein die Politik die Verantwortung: Die sogenannte Heterogenität der Schüler. Das Migrationsproblem wird in Deutschland an die Schulen verlagert, Lehrer, Rektoren, Eltern und vor allem die Schüler müssen es ausbaden", urteilt die RHEINISCHE POST.
Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg betont: "Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Klassen hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf 26 Prozent verdoppelt - das überfordert viele Schulen. Nicht zuletzt spielt der teils massive Lehrermangel eine gewichtige Rolle. Die Studie ist ein Weckruf. Die Politik muss Bildung endlich zur ernsthaften Chefsache machen - und zwar schon ab dem Spracherwerb in der Kita. Andernfalls droht Pisa 2023 zum Fanal für den Abstieg zu werden", mahnt die VOLKSSTIMME.
Die DITHMARSCHER LANDESZEITUNG aus Heide beobachtet: "Es ist nicht erst seit Pisa, sondern gefühlt seit ewigen Zeiten so, dass das notwendige Investment in die Schul- und Ausbildung das Nachsehen hat gegen politisch besser verkaufbare Waren wie 'Herdprämie' oder 'Rente mit 63'. Das waren Wahlkampfschlager, die im Kern eine Hypothek für die Generationen darstellen, denen gleichzeitig die bestmöglichen Bildungsvoraussetzungen fast schon systematisch verweigert werden. Und das liegt nicht etwa an den Lehrern, auf denen gern herumgehackt wird. Da gibt es genauso viele oder wenige schwarze Schafe wie in allen anderen Berufsbildern. Der Bildungsweg eines jeden – egal, wohin er führt, ob in eine Lehre oder an die Uni – muss für jeden frei von Finanzierungssorgen sein", verlangt die DITHMARSCHER LANDESZEITUNG.
Das HANDELSBLATT stellt fest: "Unser Schulsystem schafft es nicht, Kinder so zu fördern, wie es nötig und möglich wäre. Darauf weisen Experten schon lange hin. Unser System hat bereits 20 Prozent Schulversager 'produziert', die nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können, als der Migrantenanteil noch bei einem Zehntel lag. Und exakt diese Unfähigkeit wirkt sich mit den vielen Zuwanderern noch mehr aus. Denn diese brauchen allein wegen der Sprachprobleme besondere Unterstützung", notiert das HANDELSBLATT.
Die FRANKFURTER RUNDSCHAU kritisiert auch die Bundesbildungsministerin: "Stark-Watzinger hat eine gute Gelegenheit verstreichen lassen, um ihre vor Monaten angekündigte Initiative wiederzubeleben und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Bildungspolitik voranzubringen. Doch die FDP-Politikerin blieb lieber unsichtbar. Das ist alles andere als ein gutes Zeichen. Denn seit Jahren geht der Trend schulischer Leistungen beim Nachwuchs nach unten. Und Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Pisa-Studie zeigt auch, dass andere Länder die schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie geschickter managten. Sie haben mit digitalen Angeboten die Krise besser überstanden. Ein Hinweis auf ein weitere Schwierigkeit", vermerkt die FRANKFURTER RUNDSCHAU.
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG geht ein auf die laufenden Verhandlungen der Ampel-Koalition zum Haushalt für das nächste Jahr: "Während sich jetzt alle melden, um zu erklären, warum in ihrem Bereich auf gar keinen Fall gespart werden kann, läuft es ohne Schuldenbremse genau andersherum. Dann sind der Kreativität für Mehrausgaben allerorten keine Grenzen gesetzt. Es gibt gute Argumente dafür, die Schuldenregel auch 2024 noch einmal auszusetzen. Aber es birgt eben auch jene Risiken, auf die die FDP nicht müde wird hinzuweisen. Bei der Expertenanhörung zum Nachtragshaushalt 2023, für den mit Verweis auf die Energiekrise zu Beginn des Jahres nun doch noch die Schuldenregel ausgesetzt wird, gab die Mehrheit der Experten grünes Licht für den Schritt. Für 2024 ließe sich mit dem anhaltenden Ukraine-Krieg womöglich eine weitere Notlage rechtfertigen. Dann aber steht zu befürchten, dass es keine Haltelinien mehr gibt", unterstreicht die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.
Die WIRTSCHAFTSWOCHE bemerkt zum wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, der bei der Schuldenbremse zu einer "goldenen Regel" rät: "Künftig sollten kreditfinanzierte Investitionsausgaben beim Schuldendeckel des Grundgesetzes herausgerechnet werden – sofern es um Nettoinvestitionen geht, die erstmalig vorgenommen werden und die volkswirtschaftliche Substanz des Landes verbessern. Unter all den schlechten Vorschlägen, dem Staat die Politik auf Pump zu erleichtern, mag das der am wenigsten schlechte sein. Doch auch er krankt an einem alten Problem, das schon in den Jahrzehnten vor Einführung der Schuldenbremse offenkundig war: Der Investitionsbegriff ist nicht eindeutig definiert und daher äußerst dehnbar. Dies führt im Zweifel dazu, dass die Politik mit großer Kreativität ihren Ausgabewünschen einen wie auch immer gearteten investiven Anstrich zu geben versucht. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass SPD-Vertreter dann selbst das Bürgergeld – als Investition in Humankapital – notfalls über Kredite finanzieren würden", lesen wir in der WIRTSCHAFTSWOCHE.
Das STRAUBINGER TAGBLATT fragt: "Warum nicht ein Sondervermögen 'Transaktionskosten' einrichten? Dies bedürfte, ebenso wie eine Änderung der Schuldenbremse, einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Aber genau dies wäre die Missbrauchsbremse. Auf diese Weise wäre eine zusätzliche Kreditaufnahme möglich, aber nur, wenn dies eine breite Mehrheit für notwendig erachtet. Damit wäre der Griff in die Schuldenkiste bei jeglichem Bedarf für jede Regierung ausgeschlossen, die Finanzierung von dringlichen Zukunftsaufgaben aber gewährleistet", vermutet das STRAUBINGER TAGBLATT.
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG äußert sich zum ungarischen Ministerpräsidenten Orbán, der die beiden Hauptbeschlüsse zur Unterstützung der Ukraine von der Tagesordnung des EU-Gipfels Mitte Dezember streichen lassen will: "Er verhält sich wie ein informeller Statthalter Putins im westlichen Lager; selbst Erdogan positioniert sich ausgewogener. Den Zeitpunkt für seinen kleinen Aufstand in Brüssel hat Orbán vermutlich sorgfältig gewählt. Da derzeit auch in Washington weitere Finanz- und Militärhilfe für die Ukraine blockiert wird, ist der potentielle Schaden für Kiew maximal. Dass das zu den Interessen eines kleinen, nicht zuletzt vom EU-Handel abhängigen Landes passt, dessen Nachbar überfallen wurde, ist zweifelhaft. Da die ungarischen Wähler diese Politik aber erst vergangenes Jahr wieder bestätigt haben, muss die EU das Beste daraus machen", folgert die F.A.Z.
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG argumentiert, die anderen EU-Staaten könnten die Milliarden für die Ukraine sicher allein stemmen und spekuliert mit Blick auf die EU-Betrittsgespräche: "Vielleicht wird sogar das Undenkbare geschehen und die Geste, die der Start von Verhandlungen mit Kiew vor allem bedeuten würde, verschoben werden; den Imageschaden hätte in diesem Fall Orbán, Putins Handlanger in Budapest. Aber das wäre nur der Anfang einer Kette von Problemen, die der Ukraine existenzieller zusetzen würden als der EU: militärische und finanzielle Hilfe – auf Dauer abhängig von kleinen Autokraten wie Orbán und Möchtegern-Autokraten wie vielleicht demnächst Trump? Das wäre Putins erster Sieg von vielen", gibt die SZ zum Ende der Presseschau zu bedenken.
