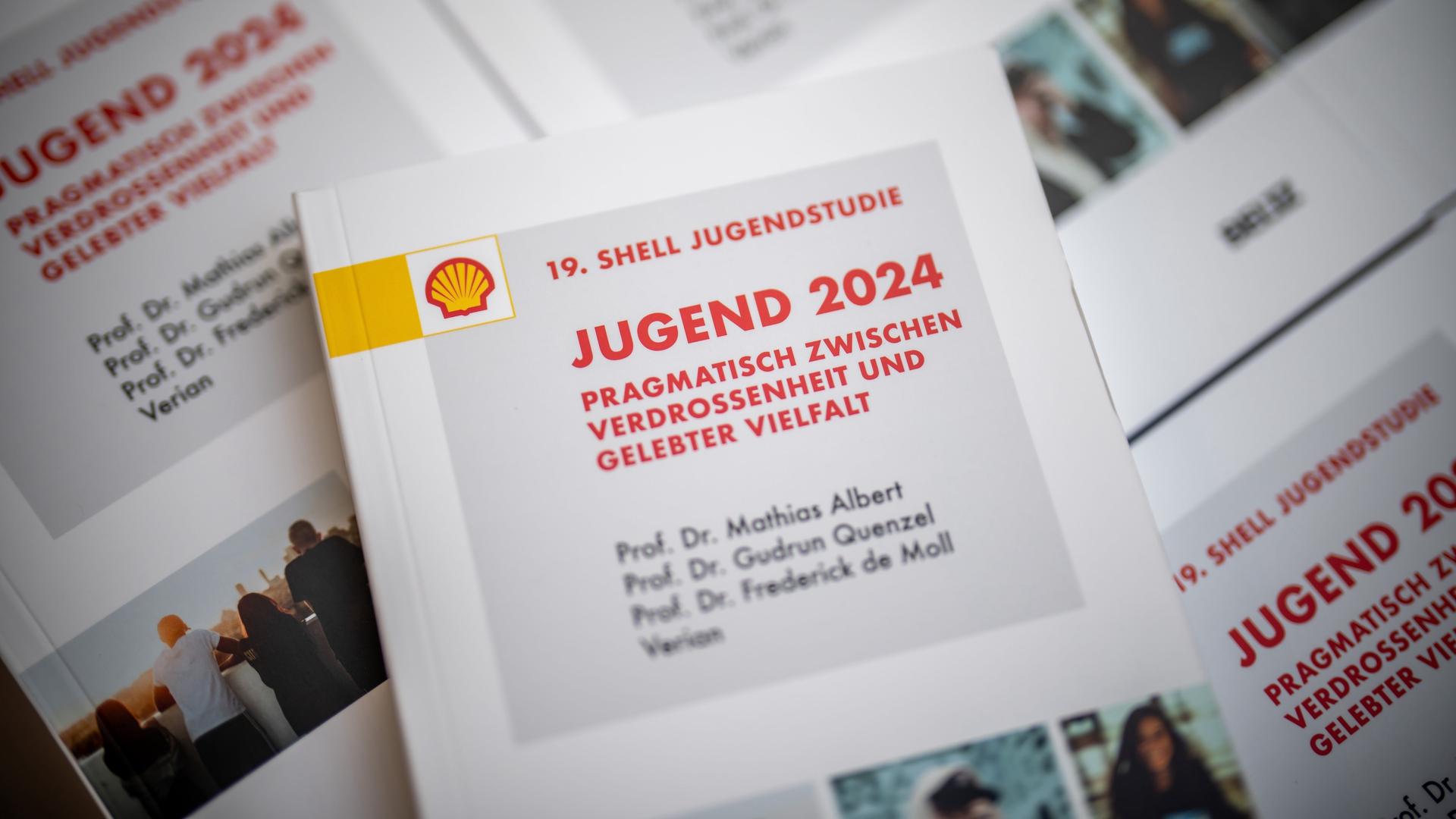
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG fasst zusammen: "Die große Mehrheit der Jugend von heute blickt optimistisch in die Zukunft. Man hätte anderes erwarten können. Doch ausgerechnet jene Jugendliche zwischen 12 und 25, die etwa in der Corona-Pandemie besonders stark unter (rückblickend falschen) Eingriffen wie Schulschließungen und Ausgehverboten zu leiden hatten, hat diese Erfahrung in der großen Mehrheit nicht zu Montagsdemonstranten und Verschwörungserzählern gemacht, sondern im Gegenteil davon überzeugt, dass Staat und Gesellschaft große Krisen meistern können", beobachtet die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.
"Junge Menschen interessieren sich so stark für Politik wie zuletzt kurz nach der Wiedervereinigung", freut sich die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: "Nach eigenem Bekunden informieren sich junge Menschen in Deutschland heute öfter über politische Themen als früher, sie sind auch häufiger zu politischem Engagement bereit. Das alles sind Merkmale einer lebendigen Zivilgesellschaft. Dass sie so hoch im Kurs stehen, ist gut und wichtig. Doch Interesse allein genügt nicht, um eine Demokratie am Leben zu erhalten. Um sie gegen Angriffe zu verteidigen, gilt es, entsprechend zu handeln."
Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN gehen näher auf das Ergebnis der Studie ein, dass sich mittlerweile rund ein Viertel der jungen Männer als politisch "eher rechts" verortet: "Ziemlich klar dürfte sein, dass junge Menschen heutzutage dort politisiert werden, wo sie viel Zeit verbringen – in den sozialen Internetmedien. Dort tummelt sich mit großem Eifer, man weiß es mittlerweile, die AfD. Die anderen Parteien holen auf, tun aber noch immer nicht genug, um ihre Botschaften so zu formulieren und digital zu verbreiten, dass sie auf TikTok und Co. funktionieren", kritisieren die NÜRNBERGER NACHRICHTEN.
Die RHEIN-ZEITUNG verlangt ein Gegensteuern durch die Politik: "Die Regierung muss mit den Ländern daran arbeiten, das Bildungssystem zu stärken, damit es aufgeklärte Menschen hervorbringt, die sich eben nicht zufriedengeben mit allzu einfachen Botschaften auf TikTok. Es braucht eine Sozialpolitik, die generationengerecht ist und trotz der Babyboomer-Herausforderungen in den Sozialsystemen die Arbeitskräfte von morgen nicht bei Beiträgen überfordert. Das sind die Mammutaufgaben, denen die nächste Bundesregierung sich stellen muss", findet die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz.
Themenwechsel: Die TAGESZEITUNG befasst sich mit den Überlegungen des polnischen Ministerpräsidenten Tusk, das Asylrecht vorübergehend auszusetzen: "Tusks Schritt ist ein symptomatisches Verhalten für die Parteien der Mitte in diesen Tagen: Der Wunsch nach Asyl-Verschärfungen findet kein Ende, auch wenn die Zahlen stark sinken – wie hierzulande – oder schon sehr niedrig sind, wie in Polen. Besonders absurd ist dabei, dass Polens Maßnahme sich gegen 'instrumentalisierte' Flüchtende richtet, die über Belarus ankommen. Für solche Fälle sieht das 2023 beschlossene Asylsystem Geas eigene Sonderklauseln vor. Doch die reichen heute auch den Scharfmachern nicht mehr, die sie einst selbst reinverhandelt haben, sie setzen das Asylrecht lieber gleich komplett aus", notiert die TAZ, die in Berlin erscheint.
"Der im Frühjahr von den EU-Staaten mühsam ausgehandelte Asylkompromiss ist nicht mehr viel wert", konstatiert die STUTTGARTER ZEITUNG: "Ungarn und die Niederlande haben bereits angekündigt, aus dem Vertrag aussteigen zu wollen. Und selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht noch vor dessen Inkrafttreten die Notwendigkeit nachzubessern. Sie hat einen neuen Gesetzentwurf zur Abschiebung von Migranten angekündigt. Europas moderate Kräfte müssen diesem drohenden Kahlschlag der Asylgesetze und den Alleingängen der Staaten Einhalt gebieten. Denn damit könnte ein Teufelskreis der Radikalisierung in Gang gesetzt werden, der am Ende die gesamte EU gefährdet," befürchtet die STUTTGARTER ZEITUNG.
"Wie findet man zurück zu einem Europa, in dem sich alle wieder an die Regeln halten?", überlegt die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG. "Deutschland kann, seit es ringsum mit seinen Grenzkontrollen sämtliche Nachbarn angerempelt hat, nicht mehr als der große europäische Oberlehrer auftreten. Bundeskanzler Olaf Scholz muss damit rechnen, dass andere EU-Staaten den Wechsel der deutschen Gangart als Gelegenheit sehen, Verschärfungen des Asylrechts voranzutreiben, gegen die sich Berlin bislang gewehrt hat. Aus den anstehenden europäischen Debatten könnte allerdings auch etwas Gutes erwachsen. Die Europäer fangen nicht bei null an, sondern haben mit ihren Konzepten zur gemeinsamen Asylpolitik schon einiges in der Hand, auf dem Papier jedenfalls. Jetzt kommt es darauf an, schneller als geplant aus den neuen Theorien eine neue Praxis werden zu lassen", rät die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG.
Nun zu einem Vorschlag der FDP: Sie möchte die Zahl der Organspender erhöhen, indem sie die Organentnahme schon mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand erlaubt statt wie bisher mit dem Hirntot. Dazu schreibt die FREIE PRESSE: "Gäbe es die Metapher vom Elefanten im Porzellanladen noch nicht, müsste sie eigens für die FDP-Gesundheitspolitiker erfunden werden. Von Menschen zu erwarten, dass sie irgendwo mal schnell ein Kreuz setzen, nach welcher Todesdefinition ihnen im Ernstfall Organe entnommen werden dürfen, ist eine komplette Überforderung des Einzelnen. Das würde nur dazu führen, dass es noch weniger Organspender gibt. In der Coronapandemie ist viel Vertrauen in politische Entscheidungsprozesse verloren gegangen. Wer ethisch komplexe Debatten rabiat führt, verstärkt diesen Prozess", warnt die FREIE PRESSE aus Chemnitz.
Die MEDIENGRUPPE BAYERN, zu der unter anderem die PASSAUER NEUE PRESSE gehört, bezeichnet die Idee einer neuen Todesdefinition als "Bärendienst" an der Sache: "Denn am Ende geht es bei der Organspende um mehr als medizinische Aspekte. Es geht um Vertrauen. Und eine Debatte über Herz- und Hirntod, über unterschiedliche Ansichten von Ärzten schürt zwangsläufig die Ur-Angst vieler Menschen, dass man sie sterben lässt, obwohl es noch ein Fünkchen Hoffnung gegeben hätte. Für die Organspende und die, die darauf angewiesen sind, ist das im Zweifel eine tödliche Debatte. Besser also: Lieber die Idee sterben lassen – und politisch mit Würde beerdigen", findet die PASSAUER NEUE PRESSE.
Für die SCHWÄBISCHE ZEITUNG greift der Vorstoß der Liberalen zu kurz: "Denn alle politischen und medizinischen Diskussionen werden die grundsätzliche Skepsis der Deutschen gegenüber Organspenden nicht beseitigen. Die im Vergleich zu anderen Nationen sehr niedrigen Organspende-Zahlen sind nur anzuheben, wenn auf breiter Basis Aufklärungsarbeit geleistet wird. Emotionen, Ängste, Unwissen und Unsicherheiten um das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über seinen Körper lassen sich nur im Gespräch mit Fachleuten angehen. Und wer sich gegen eine Organspende oder gar nicht entscheidet, verdient ganz sicher: Respekt für diesen höchstpersönlichen Entschluss", unterstreicht die SCHWÄBISCHE ZEITUNG aus Ravensburg.
Die HESSISCHE/NIEDERSÄCHSISCHE ALLGEMEINE legt ein gutes Wort für die Widerspruchslösung ein: "Bei der ist erstmal jeder Spender – es sei denn, man will es nicht sein. In Ländern mit diesem Modell, das sich natürlich mit der Erweiterung der Spenden nach einem Herz-Kreislauf-Tod kombinieren lässt, hat sich gezeigt, dass es einen positiven und selbstverständlicheren Umgang mit dem Thema Organspende gibt. Diese so einfache Lösung, die bisher nie eine Mehrheit im Bundestag fand, sollte daher parteiübergreifend forciert werden. Sie ist unkompliziert und würde mehr Menschenleben retten." Das war ein Zitat aus der HESSISCHEN/NIEDERSÄCHSISCHEN ALLGEMEINEN aus Kassel zum Ende der Presseschau.
