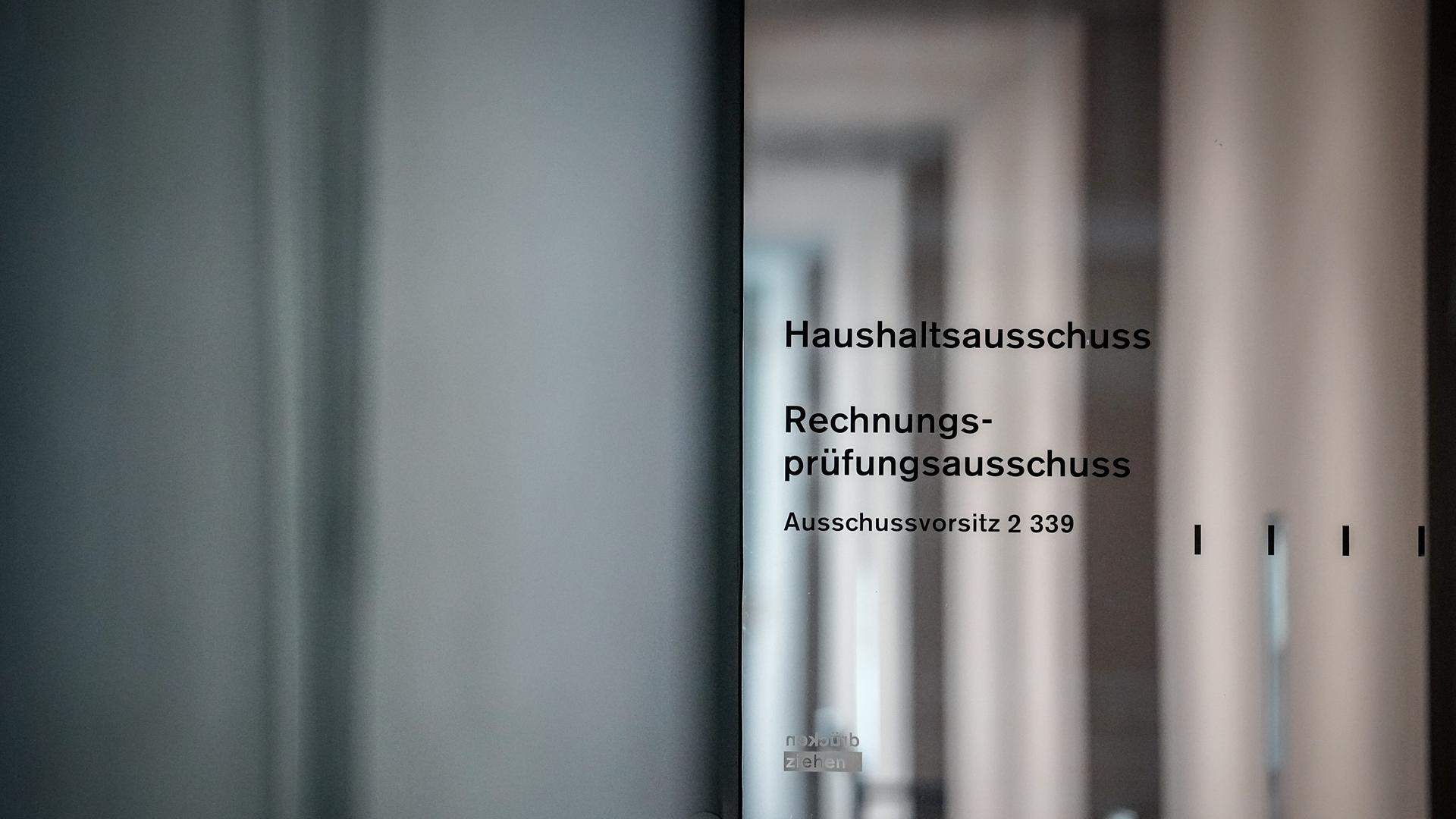
Der Haushaltsausschuss des Bundestag hat den Etat für das laufende Jahr verabschiedet. Die RHEINISCHE POST sieht das Ergebnis skeptisch: "Die dicken Probleme kommen erst noch, für 2027 zeichnet sich eine Finanzlücke von mehr als 30 Milliarden Euro ab. Nie zuvor mussten so gigantische Löcher gestopft werden, notwenige Einsparungen allein werden diese Summe nicht erbringen können. Und so mag es die eine oder andere gute Botschaft mit Blick auf den Haushalt 2025 geben, etwa mehr Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt. Sehr dringend aber braucht es Antworten der Regierung, welche strukturellen Reformen die Finanzmisere beenden können. Und die nächsten Bereinigungssitzungen dürften dann wieder deutlich länger dauern", prognostiziert die RHEINISCHE POST aus Düsseldorf.
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG lobt: "Es ist erstmal eine gute Nachricht. Im Herbst dieses Jahres einigt sich die Koalition auf den Bundeshaushalt 2025, an dessen Aufstellung die Ampel vor bald einem Jahr zerbrochen war. Eine Regierungskrise steht also erstmal nicht ins Haus. Allerdings kann einem bei den neuen Schulden, 140 Milliarden allein für dieses Jahr, schwindelig werden. Und das ist erst der Anfang."
Das STRAUBINGER TAGBLATT rechnet vor: "Im Kernhaushalt stehen neue Kredite von fast 82 Milliarden Euro. Mit den Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur sollen am Ende Schulden von mehr als 140 Milliarden zu Buche stehen. Um diese gewaltigen Summen zu stemmen, hoffen Kanzler Friedrich Merz und sein Finanzminister Lars Klingbeil darauf, dass die lahmende Konjunktur anspringt – während die Wirtschaftsinstitute am Donnerstag erst pessimistische Prognosen dafür abgegeben haben. Ab 2027 könnte es so richtig knackig werden. Dann und in den Folgejahren bis 2029 ist bislang eine Lücke von über 170 Milliarden Euro ungedeckt – trotz aller Kreditspielräume in der Verteidigungspolitik und der kürzlich beschlossenen Aufweichung der Schuldenbremse für Infrastrukturausgaben", erklärt das STRAUBINGER TAGBLATT.
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG merkt an: "Die Regierung schöpft aus dem Vollen, und auch der Verlauf der Bereinigungssitzung ist wieder ein Zeichen dafür, dass sich dagegen wenig Widerstand regt. Doch die Erwartungen aus dem Wahlkampf sind mit diesem Haushalt nicht einfach verschwunden, es sind sogar noch neue hinzugekommen: Dass dieser Staat, dass die Sozialversicherungen, dass die Wirtschaft, dass die Infrastruktur eine Radikalkur erfahren, die Deutschlands Zukunft sichert. Die Beratungen für den Haushalt 2026 haben schon begonnen, und erst damit wird es ernst. Denn alles, was jetzt nicht in Krösus-Manier zugeschüttet werden kann, wird die Koalition politisch noch teuer zu stehen kommen", warnt die F.A.Z.
Die SÜDWEST PRESSE aus Ulm blickt in das kommende Jahr: "Spannender und konfliktreicher wird wohl das Ringen um den Haushalt 2026, in dessen Entwurf noch mal 18 Milliarden Euro mehr vorgesehen sind. Den Nachweis, wie ernst sie es mit der klaren Ausrichtung auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands meint, muss die Bundesregierung dann erbringen. Bislang hat man das Gefühl, die schwarz-rote Koalition möchte die Menschen gern weiterhin in Watte packen."
Hören Sie nun Kommentare zur Kranken- und Pflegeversicherung. Das Nachrichtenportal T-ONLINE vermisst Antworten auf die Frage, wie höhere Beiträge vermieden werden können. "Statt konkret zu werden, lieferte Bundesgesundheitsministerin Warken bei ihrer Pressekonferenz in Berlin lediglich eine Reihe von Plattitüden ab: Man brauche kurzfristige Maßnahmen, langfristige Reformen, die Ausgaben seien hoch, die Lage ernst. All das ist richtig, aber nichts Neues. Und vor allem: keine Lösung."
Die STUTTGARTER ZEITUNG führt aus: "Vor allem die Klinikkosten laufen davon. Das sollte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ein Fingerzeig sein, die durch die Krankenhausreform angestoßenen Strukturveränderungen rasch umzusetzen. Stattdessen hat man den Eindruck, als wolle die Ministerin eher Druck herausnehmen, was fatal wäre. Es gibt nicht so viele Stellschrauben, an denen die Politik drehen kann. Die Regierung muss sich nur in einer Grundsatzfrage ehrlich machen: Sollen die Beitragszahler die Zeche zahlen – durch höhere Beiträge, Leistungskürzungen und mehr Eigenbeteiligungen? Oder sollen die Probleme solidarisch gelöst werden: durch die Heranziehung aller Einkommensarten, durch eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenzen und eine stärkere Steuerfinanzierung? Fragen der Sozialversicherungen sind Gerechtigkeitsfragen", unterstreicht die STUTTGARTER ZEITUNG.
"Der Problemdruck wird größer und größer. Ausgaben und Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung klaffen immer weiter auseinander", schreibt die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt/Oder. "Will man Bürger und Wirtschaft nicht noch mehr schröpfen, was ja offiziell ein Ziel der Regierung ist, müsste etwas geschehen. Und zwar nicht irgendwann, sondern schnell. Ohne Zumutungen, welcher Art auch immer, dürfte es nicht gehen. Das wird für viele schmerzhaft. Aber es geht darum, das System zu erhalten. Nur muss man sich als Politik auch trauen, genau das den Bürgern entsprechend zu erklären", empfiehlt die MÄRKISCHE ODERZEITUNG.
Themenwechsel. Bei einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen wurden Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert. In der Berliner TAGESZEITUNG - kurz TAZ - heißt es: "Laut Frankreichs Präsidenten Macron seien 26 Länder bereit, Truppen in die Ukraine zu schicken, um dort einen Waffenstillstand oder Frieden abzusichern. Was das in der Praxis bedeutet, bleibt diffus. Wie soll dieser Einsatz mandatiert sein? Und welche Rolle, wenn überhaupt, spielen die USA dabei? Einmal abgesehen davon, dass viele Staaten, darunter auch Deutschland, eine Entsendedebatte ohnehin für verfrüht halten."
Die Zeitung DIE ZEIT hält den Standpunkt von Bundeskanzler Merz für nachvollziehbar: "Frei übersetzt bedeutet der: Wenn die Bedingungen stimmen, sei man dabei. Und eine Bedingung muss sein, dass die Amerikaner mit einem starken Kontingent in der Ukraine dabei sind und nicht nur ihrerseits Sicherheitsgarantien für die Friedenstruppe oder die Ukraine geben. Wenn amerikanische GIs Seite an Seite mit deutschen, französischen, britischen, polnischen und skandinavischen Soldaten in der Ukraine in der Nähe der eingefrorenen Frontlinie stehen würden, dann dürfte Russland tatsächlich keinen direkten Angriff wagen", vermutet DIE ZEIT.
Nun in die USA. Dort benennt Präsident Trump das Pentagon in Kriegsministerium um. Die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz schreibt: "Man könnte es spöttisch betrachten. Demnach wäre die Umbenennung lediglich ein erster Schritt in einem umfassenden Prozess der Ehrlichmachung. Präsident Trump könnte demnach schon bald auch dem Gesundheitsressort von Impfkritiker Robert F. Kennedy Junior einen neuen Namen verpassen, etwa: Ministerium für Seuche und Verwesung. Wenn man das Ganze rational betrachtet, ergibt das Wort Krieg in der Ressortbezeichnung allerdings Sinn. In Washington heißt es, man wolle mit der Umbenennung des Ministeriums 'Stärke demonstrieren'. Man weiß nie, ob es bei Worten bleibt", gibt die ALLGEMEINE ZEITUNG zu bedenken.
Der TAGESSPIEGEL aus Berlin sieht Trump in der Defensive: "Im Ukraine-Krieg führt ihn Wladimir Putin Mal um Mal vor. Während der Kremlchef Frist um Frist für eine Waffenruhe verstreichen lässt, verbündet Putin sich noch enger mit China, Nordkorea, dem Iran – und ruft eine neue Weltordnung aus. Trump, so gereizt, reagiert. Auf seine Weise, demonstrativ. Ob neue Stärke durch eine Umbenennung in 'Kriegsministerium' erreicht werden kann, ist zu bezweifeln. Wen soll das beeindrucken? Umso beunruhigender der Gedanke, was sich der Präsident als Nächstes einfallen lässt, um sich neuen 'Respekt' zu verschaffen", notiert der TAGESSPIEGEL.
