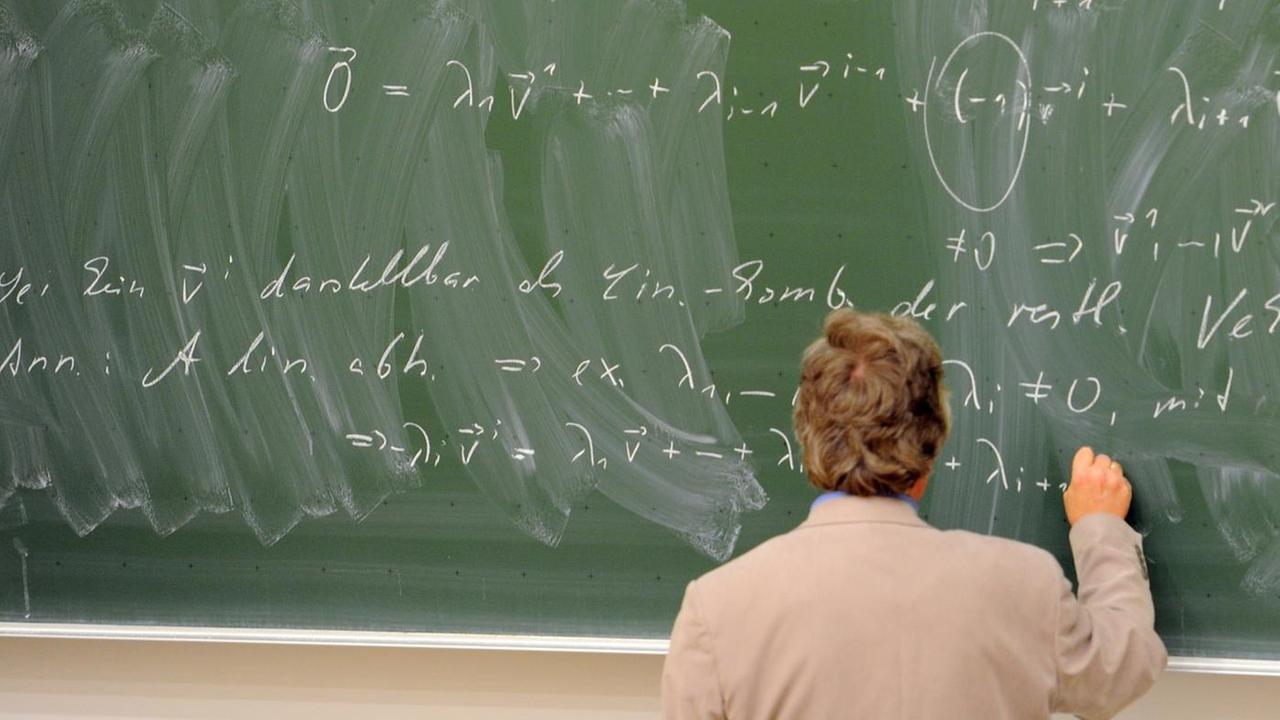Regina Brinkmann: Ob mit oder ohne Abi - immer mehr junge und auch ältere Erwachsene zieht es an die Uni. Einige haben schon Berufserfahrungen, andere sind gerade mal volljährig, wenn sie jetzt zum Beginn des neuen Semesters ihre ersten Vorlesungen besuchen. Diese Heterogenität stellt die Hochschulen vor große Herausforderungen, die auch bei der Tagung des Deutschen Hochschulverbandes in Berlin ein Thema ist. Das greift Dieter Imboden auf, er ist emeritierter Professor der ETH Zürich und referiert dazu auf der Tagung. Herr Imboden, vor welchen Problemen stehen denn Hochschulen konkret, wenn ihre Studierenden ganz unterschiedliche Voraussetzungen für ein Studium mitbringen?
Dieter Imboden: Die entscheidende Frage ist die, dass die Universitäten da ihre Studierenden nicht wählen können. Sie müssen sich das vorstellen, eine Kunstschule, die einfach jeder, der Balletttänzer oder Sängerin oder sonst ein Kunstfach studieren möchte, aufnehmen muss und dann daraus etwas effizientes sowohl für das Individuum als auch für das, was herauskommt, nämlich ausgebildete Kunstfachleute produzieren soll. Die Universität steht in einer Situation, die natürlich vor 50 Jahren ganz anders war, als nur ein paar wenige Prozente mit einem Abitur an die Uni gingen, viel homogener waren, und heute haben wir eine sehr große Inhomogenität in den Erwartungen, den Fähigkeiten der Schüler, die an die Uni kommen oder der Interessenten und eine relativ homogen gebliebene Universitätslandschaft.
Brinkmann: Das heißt, wer muss sich da jetzt bewegen, die homogene Universitätslandschaft vielleicht mal?
Imboden: Ja, richtig. Die Universitäten sollten wegkommen von einem Tabuthema, das in Deutschland und anderswo in Europa immer noch herrscht, nämlich alle Universitäten sind gleich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu diversifizieren, sei es fachlich, von den Voraussetzungen her, wollen sie mehr theoretisch sein, wollen sie forschungsnah sein, wollen sie praxisorientiert sein. Diese Differenzierung wird von den Universitäten nicht wahrgenommen.

"Eine Hochschule bildet nicht für sich selber aus"
Brinkmann: Nun haben wir ja schon die Universitäten und wir haben die Hochschulen, vormals Fachhochschulen. Diese Diversität reicht Ihnen aber offensichtlich nicht.
Imboden: Nein, diese Diversität ist zu schematisch. Es gibt auch unter den akademischen Fächern, die nur an einer universitären Hochschule gelehrt werden, gibt es riesige Unterschiede, wie sie etwas beibringen wollen, wie sie unterrichten. Wir müssen ja daran denken, eine Hochschule bildet ja nicht in erster Linie für sich selber aus. Das ist das, was die Hochschule am besten kann. Jeder denkt, ich bilde eine Person aus, und die wird dann auch mal Professor oder auch mal forschende Person, aber die meisten gehen ja ins Berufsleben, und in dieser Hinsicht ist die Universität zu wenig flexibel. Alle wollen eigentlich das akademische hohe Ziel verfolgen, eine Kombination von Forschung und Lehre, und das entspricht der heutigen Situation nicht mehr.
Brinkmann: Sie haben aber anfangs auch diese Auswahl noch erwähnt. Wäre das auch eine Möglichkeit, die Sie sich wünschen würden, um da vielleicht noch stärker zu differenzieren?
Imboden: Ja. Wenn wir jetzt nach Amerika schauen, wo der Prozentsatz von Leuten, die einen Abschluss haben in der Schule, sodass sie an die Universität gehen, mindestens so groß oder noch größer ist als in Deutschland, aber dort gibt es ein riesiges Spektrum von Universitäten. Es gibt ungefähr 4.000 Universitäten. Würden vielleicht in unserem Maßstab nicht alle als Unis gelten, aber 4.000 Möglichkeiten, und nur ein paar wenige – das sind die, von denen wir immer sprechen, Harvard, Stanford et cetera – sind auf dem höchsten Forschungs- und Lehre-Kombinationsniveau und bieten beispielsweise Doktorandenprogramme, während bei uns eine Hochschule automatisch auch eine Doktorandenausbildung bringt, und von dieser Variabilität haben wir noch gar nicht Gebrauch gemacht. Das setzt aber voraus, dass die Universitäten sich ihre Studierenden wählen, auswählen können.
"Wir haben eine falsch verstandene Egalität"
Brinkmann: Aber da höre ich schon jetzt den Aufschrei, wenn sich da ein Bundesland, eine Hochschule zu durchringen würde, also das auf breiter Ebene anzubieten, Auswahlverfahren, da auch vorab schon viel mehr zu sieben, als es bisher der Fall ist.
Imboden: Das ist ja genau der Punkt, und wenn Sie das Wort sieben verwenden, dann tönt das wie eine Disziplinierung, und darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Fähigkeiten der jungen Menschen und die Ausbildung korrespondieren, und das kann ja nicht sein, dass wenn heute 50 Prozent theoretisch an die Universität gehen können, dass das alles zukünftige Einsteins oder Grundlagenforscherinnen der theoretischen Physik werden. Sie haben ja ganz viele Leute, die machen später etwas im Leben, das weit weg ist von der Forschungsspitze in einem gewissen Fach, und es ist auch für diese jungen Leute viel befriedigender, wenn sie eine Ausbildung bekommen, mit der sie später auch außerhalb der Universität einen Beruf ausüben können.
Brinkmann: Jetzt könnte man aber auch noch mal viel früher ansetzen und sagen, ja, an Schulen wird die allgemeine Hochschulreife vergeben, erwerben die jungen Menschen diese Hochschulreife. Was müsste sich denn da vielleicht noch verbessern oder verändern, dass die jungen Menschen, die dann tatsächlich an eine Hochschule gehen, auch tatsächlich hochschulreif sind?
Imboden: Es ist eine falsch verstandene Chancengleichheit. Natürlich, im alten System, als nur fünf Prozent eine Hochschulreife hatten und an die Uni gehen konnten, war das System nicht gerecht, weil Kinder aus Akademikerfamilien viel größere Chancen hatten als andere. Das war ungerecht. Aber die Chancengleichheit sagt ja nicht, dass alle an die Uni gehen müssen. In diesem Sinne finde ich es schon bedenklich, und wenn mir Universitätskollegen sagen, dass in gewissen Fächern, beispielsweise in der Ökonomie, heute die Voraussetzungen, die die Schulabsolventen mitbringen, so sind, dass sie zuerst einen halbjährigen Einführungskurs machen müssen, beispielsweise in den mathematischen Grundlagen, bis sie das, was sie früher an einer Universität direkt unterrichten konnten, auch unterrichten können. Da haben wir eigentlich eine falsch verstandene Egalität, welche das System ineffizient macht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.