
Frau Meier: "Wir fangen hier an. Hier wird die rohe Schweinegülle gelagert. Wir haben hier ein Ansichtsexemplar."
Ein Schraubdeckelglas, gefüllt mit einer trüben, grünbraunen Brühe.
"Sie sehen hier: In der Schweinegülle hat es auch noch ziemlich viele Feststoffe und große Partikel. Genau, ich kann’s einmal grade rumgeben zum Anschauen. Wer möchte?"
Einer der anwesenden Herren fasst das Glas mit spitzen Fingern an.
"Am besten zulassen. Es riecht nicht so toll. Es ist wirklich Schweinegülle."
Gülle und Mist. Dreihundertzehn Millionen Kubikmeter jährlich in Deutschland. Knapp einhunderttausend olympische Schwimmbecken ließen sich damit füllen. Die Fäkalien landen auf dem Acker, und mit ihnen Unmengen an Kunstdünger. Die Nährstoffe wandern am Ende in Bäche, Flüsse, ins Meer und ins Grundwasser.
"Halt! Entschuldigen Sie bitte, aber hier muss ich unterbrechen! Gestatten Sie, mein Name ist Liebig. Justus von Liebig. Diese Zuspitzung gefällt mir nicht. Dürfte ich an die Zeiten erinnern, bevor sich die Erkenntnisse aus meiner "Agriculturchemie" bei den Bauern auf breiter Linie durchgesetzt hatten? Die Böden waren ausgelaugt, dem Raubbau preisgegeben. Ich habe den Hunger kennen gelernt. Damals, Achtzehnhundertunderfroren. 13 Jahre alt war ich, und dünne Mehlsuppe gab es zu essen. Glauben Sie mir: Der Dünger ist ein großer Segen für die Menschheit. Aber bitte, fahren Sie fort."
Steckbrief:
- Name des Gewässers: Lahn
- Art des Gewässers: Fluss breiter als fünf Meter
- Koordinaten der Probenahmestelle: 50 Grad, 35 Minuten, 24 Sekunden nördlicher Breite. Acht Grad, 40 Minuten, drei Sekunden östlicher Länge
Lutz Breuer: "Ja, wir stehen jetzt hier an der Staustufe in Gießen an der Lahn. Und ich habe mal ein Probenahmefläschchen mitgebracht. Das ist ein Hundert-Milliliter-Plastikfläschchen aus PE, Polyethylen. Und dann ist das ganz unspektakulär eigentlich. Man kniet sich eben ans Gewässer ran, wie ich das jetzt hier auch mal mache."
Steckbrief:
- Nächste Straße: Uferweg
- Farbe des Gewässers: klar/farblos
- Niederschlag: Regen gestern
Lutz Breuer: "Dann spült man zunächst mal das Fläschchen mit dem Wasser aus, was man beproben möchte, und füllt dann eben das Fläschchen ein, bis es fast ganz voll ist." Wo Menschen leben, hinterlassen sie ihre Spuren. In den Flüssen zum Beispiel. "Ja, und dann wird das Ganze wieder zugeschraubt und kommt ab ins Labor."
Wer hier nachforscht, stößt zum Beispiel auf das Schmerzmittel Diclofenac, auf das künstliche Hormon Ethinylestradiol und den Süßstoff Acesulfam. Vor allem aber auf die allgegenwärtigen Verbindungen des Stickstoffs - Reste von Düngemitteln, mit deren Existenz wir uns fast schon abgefunden haben:
"Sie sind im Grundwasser für das Trinkwasser ein sehr großes Problem. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel Brunnen, in denen Trinkwasser gewonnen wird, schließen muss, weil die Konzentrationen für Nitrate zu hoch sind."
HydroCrowd heißt das Projekt, das Lutz Breuer von der Universität Gießen im Oktober des vergangenen Jahres durchführte. Es war der Versuch einer Momentaufnahme - mit Hilfe der Massen. Rund sechshundert Plastikfläschchen wurden verteilt - während der Prüfungen am Ende des Semesters:
"Die Studierenden haben ihre Klausur wieder abgegeben und durften dann freiwillig, ohne dass sie die Note vorher schon wussten, an diesem Projekt eben mitmachen. Sie haben diese Gefäße mit nach Hause genommen. Der Beprobungstermin lag allerdings sehr viel später, nämlich am Tag der Deutschen Einheit, am Dritten Zehnten, weil das eben ein Feiertag ist, an dem wir alle ganz gut erreichen konnten."
Die Teilnehmer waren dazu aufgerufen, an ihrem Heimatort das Fläschchen mit Wasser eines Flusses oder Baches zu füllen und dann zusammen mit einem Datenblatt an das Gießener Institut zu schicken. So kamen Proben aus knapp dreihundert Fließgewässern zusammen, von Kiel bis Oberstdorf, erklärt Breuer:
"Wir haben die Proben klassischerweise vor allem auf Nitrat und Ammonium gemessen. Darüber hinaus haben wir aber auch noch Gesamtstickstoff gemessen."
Nitrat: Fast dreißig Prozent des deutschen Grundwassers zu stark belastet
Vor allem für Nitrat zeigten sich starke Belastungen. Fast die Hälfte aller Messwerte lag unterhalb der Gewässergüteklasse II - dem Zielwert der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für Oberflächengewässer.
Ab 2015 - so verlangt es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie - sollten sich auch die Grundwasserkörper in einem "guten Zustand" befinden. In Bezug auf Nitrat bedeutet das, dass sie eine Konzentration von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nicht überschreiten dürfen. Davon könne aber keine Rede sein, sagt der Gießener Agrarwissenschaftler Martin Bach:

"Es ist leider so, dass in Deutschland fast 30 Prozent der Grundwasservorkommen nicht im guten Zustand sind. Und die Wasserwirtschaftsverwaltung ist aufgefordert, ist verpflichtet gesetzlich, sich Gedanken zu machen, wie man das in den nächsten zehn Jahren ändern kann."
Im April dann verklagte die Europäische Kommission Deutschland vor dem Gerichtshof der EU. Die Schonfrist läuft ab.
"Erlauben Sie mir bitte, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich derjenige war, der erstmals das Wasser von Gießen untersucht hat - in Brunnen innerhalb und außerhalb der Stadt. Dabei konnte ich eine bemerkenswerte Beobachtung machen: In der Stadt lagen die Nitrat-Werte um ein Vielfaches höher als außerhalb. Was ich damals noch nicht wusste: Die Nitrate entstammten den menschlichen Ausscheidungen. Sie gelangten ins Brunnenwasser, weil es keine Kanalisation gab. Und während der Stickstoff in der Stadt akkumulierte, ging er auf dem Land verloren. Denn mit den Feldfrüchten wanderte er stets in nur eine Richtung: Vom Dorf in die Stadt - ein verhängnisvoller Fluss von Nährstoffen."
Besonders empfindlich reagieren Kleinkinder auf hohe Nitratkonzentrationen. Die Substanz kann die sogenannte Blausucht verursachen, indem sie die Aufnahmekapazität des Bluts für Sauerstoff reduziert. Unter dem Einfluss der Magensäure fördert Nitrat die Entstehung von Nitrosaminen, die im Tierversuch Krebs auslösen. Kritisch wird es dann, wenn aus dem Grundwasser Trinkwasser gewonnen wird. An manchen Standorten muss das belastete Wasser mit unbelastetem gemischt werden, um den Grenzwert zu unterschreiten. Martin Bach:
"Man kann das Grundwasser zwar aufbereiten und das Nitrat technisch entziehen. Das sind aber Maßnahmen, die Geld kosten, die den Verbraucher Geld kosten. Das sind auch Maßnahmen, die aus Sicht der Wasserwirtschaft nicht gewünscht sind, weil sie das Grundwasser beziehungsweise Trinkwasser dann auch qualitativ verschlechtern. Manchmal schmeckt man das auch. Grundsätzlich: Es wäre aber nicht nötig, wenn die Landwirtschaft angemessen, das heißt also grundwasserschonend, düngen würde."
Landwirtschaft ist der Hauptverursacher
Ob künstlich hergestellter Mineraldünger oder sogenannter Wirtschaftsdünger, also Gülle und Mist: Landet zu viel davon auf den Äckern und Feldern, können die Pflanzen den darin enthaltenen Stickstoff nicht komplett verwerten. Er verbleibt zunächst im Boden und wandert dann in tiefere Schichten. Die Regionen mit hohen Nitratwerten im Grundwasser und mit intensiver Viehhaltung überschneiden sich in weiten Teilen Deutschlands, so Bach:
"Die Landwirtschaft ist ganz eindeutig bei diesen Problemen der Haupt- und eigentlich der einzige Verursacher und kann sich aus der Verantwortung nicht hinwegstehlen. Und es wäre wünschenswert, dass auch namhafte Landwirtschaftsvertreter in Zukunft sich diesem Problem offener und vorbehaltloser stellen."
Die Kritik geht auch an die Adresse des Deutschen Bauernverbandes in Berlin. Dort führt Bernhard Krüsken die Geschäfte. Hinter der Organisation stehen rund dreihunderttausend Landwirte. Bernhard Krüsken verweist auf das komplizierte Wechselspiel der Stickstoffströme: Nicht immer treibe Überdüngung die Nitratwerte in die Höhe:
"Das kann indirekt mit Landwirtschaft zu tun haben. Das sind relativ komplexe Mechanismen. Die haben zu tun mit der Bodenbeschaffenheit in einer Region, mit Niederschlagsmengen, auch mit Ertragsniveaus und Wirtschaftsdüngereinsatz. Es gibt Messstellen, das ist nicht die Mehrheit, aber sie gibt es auch, es gibt Messstellen, an denen wir höhere Nitratwerte im Grundwasser haben, aber wo wir obendrüber eine extensive Landwirtschaft machen, wo dann auch Biolandwirtschaft stattfindet. Also man muss auch sehr genau hinschauen an einzelnen Messstellen und man muss in die Ursachenforschung einsteigen und dann kriegt man die Probleme auch sehr schnell gelöst."
Die Gülle wartet. In weißen Plastiktanks. Ihre dunkle Farbe schimmert durch die Hülle hindurch, lässt den Füllstand deutlich erkennen. Frau Meier:
"Bevor wir in die Halle reingehen, müssen wir jetzt einfach noch ein paar Sachen klären. Und zwar: Wir arbeiten hier halt wirklich mit richtigen Chemikalien und Drücken und allem Möglichen. Und deswegen: Einfach bisschen vorsichtig sein in der Halle, nichts anfassen, nicht rauchen und bitte auch keine Fotos machen."
"Die Missernten und Hungersnöte meiner Zeit waren eine direkte Folge des Raubbaus, der mit unseren Äckern getrieben wurde. Neben Licht und Wasser brauchen die Pflanzen auch Nährstoffe aus dem Boden. Dabei kommt es auch auf die Mischung an: Natrium, Kalzium, Kalium, Phosphat, Sulfat und Nitrat und derlei mehr im ausgewogenen Verhältnis. Fehlt nur ein einziger der mineralischen Nährstoffe, so nützt es nichts, die anderen im Übermaß zuzugeben. Sie werden ihre Wirkung verfehlen. Viel hilft in diesem Falle wenig."
"Grundwasser ist nicht ohne Grund eine der wichtigen Umweltmedien, die auch für die zukünftigen Generationen zu schützen sind. Es ist ja ein Gewässer, was in tiefen Sedimentschichten lagert, was sich langsam bewegt. Und Grundwasser vergisst nichts. Das heißt, Schutzprinzipien müssen den Eintrag im Fokus haben und nicht, was man dann macht, wenn es zu viel war."
Im Januar 2015 stellte der Sachverständigenrat für Umweltfragen ein Sondergutachten vor. Der SRU berät die Bundesregierung in Fragen des Umweltschutzes. Heidi Foth, Professorin für Toxikologie in Halle an der Saale, war an dem Papier maßgeblich beteiligt:
"Der erste wichtige Schritt ist, in der Düngeverordnung und den Empfehlungen für landwirtschaftliche Produktion die Rahmenbedingungen an diese Anforderungen besser anzupassen."
Die Neufassung der Düngeverordnung dürfte eine Reihe von Verschärfungen mit sich bringen. Stickstoffreiche Gärreste aus Biogasanlagen zum Beispiel tauchten bisher nicht auf in der Kalkulation für die Obergrenze, die ausgebracht werden darf. Das wird sich nun wohl ändern. Die generalüberholte Verordnung dürfte die Landwirte vor allem zu einer strengeren Bilanzierung ihres Stickstoffverbrauchs verpflichten:
"Ja, es ist natürlich eine gemischte Geschichte, denn sie verlangt Landwirten einiges ab. Sie verlangt einiges ab in Sachen Dokumentation, Aufzeichnungspflichten. Aber letzten Endes will ich sagen: Das ist gute fachliche Praxis, die man hier in einer Verordnung geschrieben hat. Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir nach wie vor das Prinzip bedarfsgerechte Düngung hier verankert haben.", so Bernhard Krüsken.
Bedarfsgerechte Düngung: Dahinter verbirgt sich die Idee, nur dort zu düngen, wo die Pflanzen unterversorgt sind. Krüsken: "Denn wenn wir hier darüber reden, dass Nährstoffe präzise und bedarfsgerecht verteilt werden müssen, dann geht das nicht ohne eine halbwegs intelligente Technik. Und diese Technik gibt es auch schon. Es gibt Schnellbestimmungsgeräte für den Stickstoffgehalt in Gülle, es gibt Ausbringungstechniken, die emissionsarm arbeiten. Und da ist eine Entwicklung im Gang, die in den letzten Jahren erheblich nach vorne gekommen ist. Und Ausbringung und Verteilung, dafür braucht es Precision Farming. Ja, richtig."
Bedarfsgerecht düngen: Das sogenannte "Precision Farming"
Nideggen Berg ist ein kleines Örtchen am nördlichen Rand der Eifel. Im Ortskern ein paar Bauernhöfe, Gebäude, gemauert aus massiven Steinquadern. Am Rande der Siedlung blickt man von der Bergkuppe hinab auf die weite Ebene der Zülpicher Börde:
"Mein Name ist Manfred Hurtz. Ich habe einen zirka hundert Hektar großen Ackerbaubetrieb. Mein Betrieb ist komplett mit Precision Farming und Smart Farming ausgestattet, mit allen Sachen, die es eigentlich so auf dem Markt gibt. Wir stehen jetzt hier auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb in Nideggen Berg in der Halle, wo die Maschinen untergestellt sind, und stehen vor dem Schlepper mit dem Düngerstreuer, Schleuderstreuer und dem N-Sensor."
Die bedarfsgerechte Düngung der Ackerpflanzen stellt auf den Muschelkalkböden der Rureifel eine Herausforderung dar. Denn auf einer typischen Furchenlänge von vierhundert Metern ändert sich die Bodenbeschaffenheit mehrmals, erklärt Hurtz:
"Alle hundert Meter wechselt hier der Boden. Und aufgrund des Wechsels des Bodens ist auch die Nährstoffverfügung anders und dadurch auch das Wachstum des Getreides und der Ertrag unterschiedlich, was ich im Prinzip durch den N-Sensor ausgleiche."
Sensor erfasst den Ernährungszustand der Pflanzen
Der N-Sensor ist ein Gerät, das beim Arbeiten auf dem Acker den Ernährungszustand der Pflanzen erfasst. N ist die chemische Abkürzung für das Element Stickstoff. Der Sensor erfasst die Zusammensetzung des Lichts, das von den Pflanzen reflektiert wird: Je dunkler, desto mehr Sticktstoff haben sie aufgenommen. Der Schleuderstreuer passt dann die Menge des Mineraldüngers an. Manfred Hurtz steht vor einem moosgrünen Traktor und deutet auf das Dach der Fahrerkabine. Es sieht so aus, als sei eine Gepäckbox darauf montiert, aber quer zur Fahrtrichtung:
"Der N-Sensor ist eben dieses blaue Board auf dem Schlepper. Seitlich von dem Board sind jeweils zwei Sensoraugen verbaut, die im Sekundentakt bei der Überfahrt die Pflanzen, die Biomasse und den Chlorophyllgehalt messen und aufgrund der Legende, die im Computer hinterlegt ist, dann den Düngerstreuer steuern und die Aufwandmengen so regulieren, dass die Düngermengen so platziert werden: Wo viel Bedarf ist, kommt mehr Dünger hin. Und wo weniger Bedarf ist oder wo gar kein Bedarf ist, kommt dann weniger bis gar nichts hin."
Zur Fahrerkabine muss Manfred Hurtz ein paar Trittstufen hinauf steigen. Er lässt sich im Sitz nieder und schaltet vier Monitore rechts von ihm ein. Eine Art Joystick mit vielen farbigen Knöpfen ragt seitlich des Lenkrads in die Höhe:
"Jetzt werden die ganzen Computer hochgefahren. Das sind momentan hier auf dem Schlepper vier Stück. Einen fürs Lenksystem mit GPS-Signal, was wir brauchen. Einen zur Bedienung des Düngestreuers oder der Pflanzenschutzspritze. Ein Computer zur Bedienung des N-Sensors. Und selbst noch das Terminal, um den Schlepper zu bedienen. Das dauert ein bisschen."
Schließlich erscheint auf dem hintersten Bildschirm ein Menü, durch das der Landwirt sich hindurch hangelt:
"Ich geh dann mal ins Programm rein von der N-Düngung. Dann kann man auf die Einstellungen gehen. In den Einstellungen geht man hin und stellt eben ein, welche Arbeitsbreite man mit dem Gerät arbeitet. Mein Gerät arbeitet mit 27 Meter. Dann geht man im Prinzip hin, geht ins Sensorprogramm rein. Dann geht man ins System von dem Gerät rein. Da schaut man nach, ob GPS vorhanden ist. GPS ist vorhanden. Das Ausbringgerät ist auch da. Der Sensor ist da."
Auch die Wasserwirtschaft profitiert
Auf holprigen Feldwegen steuert der Schlepper auf ein schmales Ackerstück. Zwischen den jungen Trieben des Weizens ist die Fahrspur deutlich zu erkennen. Manfred Hurtz gibt die mittlere Zielmenge für den Dünger in den Bordcomputer ein, kalibriert den Sensor. Dann zieht er seine Bahnen über die Fläche. Auf dem Bildschirm ändern sich ständig die Messwerte.
"Jetzt kann man erkennen, wie der Sensor im Prinzip regelt. Wir hatten 50 N angedacht. Hier geht er jetzt rüber über die 50 N. Hier wird’s besser, da geht er runter mit den Werten. Geht er mal wieder höher."
Seit elf Jahren düngt der Landwirt aus der Eifel mit dieser Technik seine Äcker.
Der Stickstoff-Sensor habe sich in diesem Zeitraum unter Praxisbedingungen bewährt, resümiert Hurtz:
"Durch den Einsatz des N-Sensors habe ich festgestellt, dass ich dadurch eine gleichmäßigere Abreife habe, höhere Erträge habe, eine bessere Druschleistung im Mähdrescher habe, was bei uns immer ein Problem war, weil wir hier schon eine kleine Höhenlage sind von 300 Meter. Und wir haben natürlich auch noch im Prinzip dann auch noch im Endeffekt die Einsparung an Dünger, was natürlich direkt den Umweltschutz bedeutet und auch ökonomisch für mich auch noch Vorteile bringt."
Die Wasserwirtschaft im Kreis Düren profitiert von der Reduktion der Nitratwerte. Daher unterstützt sie die Idee der teilflächenspezifischen Düngung - indem sie die Technik mitfinanziert. Mit dem Effekt, dass die wenigen Bauern, die es dort noch gibt, tatsächlich bedarfsgerecht düngen. Hurtz:
"Die Wasserschutzkooperation fördert Technik, die direkten Umweltschutz und Wasserschutz betreibt, mit zwanzig Prozent auf die Menge der Fläche, die im Wasserschutzgebiet im Prinzip liegt. Da ich, wie gesagt, schon zu 95 Prozent da drin liege, war die Forderung natürlich etwas höher. So ein N-Sensor kostet mal so round about dreißigtausend Euro in der einfachen Ausführung."
Regionales Überangebot: Gülle und Mist

"Welch ein Erfolg, als es dann Jahrzehnte später meinen Kollegen gelang, das träge Stickstoffgas aus der Luft in eine Form umzuwandeln, die von Pflanzen leicht aufgenommen werden kann. Eine nahezu unendliche Quelle für Stickstoffdünger war damit aufgetan - doch dann streuten die Bauern in blindem Eifer den Dünger im Übermaß auf die Ackerkrume - und brachten damit den natürlichen Stickstoffkreislauf massiv aus dem Gleichgewicht. Hätten wir das zu Beginn ahnen können? Die Agrochemie hat ein Problem gelöst - und ein anderes geschaffen. Doch ihr heute wisst um diese Zusammenhänge. Ihr habt die Werkzeuge, um das Stickstoffproblem zu lösen: Nahrung für alle und eine intakte Umwelt - wenn es gelingt, aus den Flüssen der Nährstoffe wieder wahre Kreisläufe zu erschaffen."
Eine zielgenaue, bedarfsgerechte Düngung fällt besonders leicht, wenn es sich um synthetischen Mineraldünger handelt. Denn er lässt sich leicht dosieren und lagern. Anders sieht es aus beim Wirtschaftsdünger, also bei Gülle und Mist. Und bei den Stickstoffreichen Gärresten aus Biogasanlagen. Wegen der hohen räumlichen Konzentration der Betriebe vor allem im Nordwesten Deutschlands existiert dort ein Überangebot an diesen Stoffen. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger in diesen Regionen glich daher oft einer Entsorgung über die Fläche. Eine Praxis, die keine Zukunft hat, argumentiert Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband:
"Ein Betrieb, der bisher nicht im Gleichgewicht war, der wird dann sich entweder neue Flächen suchen müssen, kaufen müssen oder pachten müssen oder er wird die Gülle überbetrieblich verwerten müssen. Zum Beispiel in Niedersachsen haben wir im Westen relativ starke Konzentrationen sowohl von Tieren als auch von Biogasanlagen während es in Ostniedersachsen Ackerbaugebiete gibt, die sehr gut noch wirtschaftseigenen Dünger gebrauchen können. Dann muss man in solche überregionalen Konzepte einsteigen."
Ein Bioenergiedorf in Nord-Württemberg
Die Neufassung der Düngeverordnung wird in Zukunft von den landwirtschaftlichen Betrieben, die Vieh halten, eine höhere Lagerkapazität für Gülle und Mist fordern. Schon heutzutage wird Gülle in Tanklastern durch die Republik gefahren, um das regionale Überangebot auszugleichen. Das ist mit hohen Transportkosten verbunden. Denn man befördert dann zu neunzig Prozent Wasser. Aber auch für dieses Problem könnte man sich technische Lösungen vorstellen.
Gerade einmal rund einhundert Einwohner besitzt das Örtchen Füßbach in der Nähe von Heilbronn. Und doch war es das erste Bioenergiedorf in Nord-Württemberg. Die Anwohner beziehen Strom und Wärme vor allem aus Solarenergie und regional angebauter Biomasse. Einen Großteil davon stellt eine Biogasanlage am Rande von Füßbach zur Verfügung. Heute wimmelt es dort von Besuchern. Auch der eine oder andere Schlipsträger ist unterwegs. Ein Grüppchen hat sich vor einer offenen Maschinenhalle versammelt, neben den großen Plastikkanistern, von denen bereits die Rede war. Frau Meier:
"Und wir fangen an, indem wir einfach die Gülle aus dem Schweinestall holen. Der Schweinestall ist auf der rechten Seite von der Halle, wo Sie gerade die Präsentationen gehört haben. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir können mal rein geh'n."
Das Grüppchen bewegt sich in die Halle, wo es dezent nach Landluft riecht:
Hochwertiger Dünger aus Gülle: Das Projekt BioEcoSIM
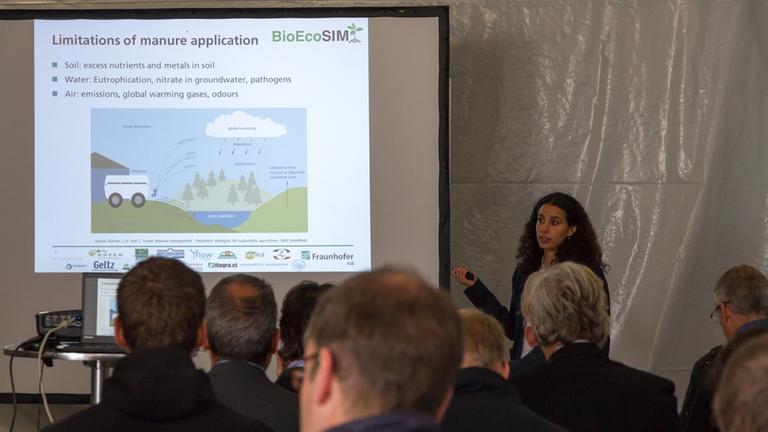
"Das ist ganz normale Schweinegülle. Wieviel? Die Anlage ist jetzt momentan ausgelegt auf vierzig Liter die Stunde. Also es ist halt wirklich noch eine Pilotanlage."
Aus Gülle soll hochwertiger Dünger gewonnen werden: Phosphatdünger, Stickstoffdünger und eine organische Fraktion, die zu Biokohle umgewandelt werden kann. Der Stickstoff ist in Form von Ammoniak und Ammoniumsalzen vollständig in der Gülle gelöst. Die Phosphate hingegen liegen zum Teil gebunden an die festen Bestandteile vor. Für die Abtrennung ist das eher hinderlich, erklärt Frau Meier, die Mitarbeiterin des Projektes BioEcoSIM:
"Da geben wir dann einfach nur Schwefelsäure zu, um dann die gebundenen Phosphate eben auch noch zu lösen. Damit wir einfach eine höhere Phosphatkonzentration in der Flüssigphase haben. Und erst nachdem wir diese Phosphate durch die Ansäuerung gelöst haben, kommen wir dann zur Separation von der festen und der flüssigen Phase."
Durch eine mehrstufige Filtration werden alle festen Bestandteile abgetrennt. Es bleibt eine Flüssigkeit übrig, die reich an Ammoniak und Phosphaten ist:
"Hier sehen Sie, dass es wirklich fast keine Partikel mehr drin hat. Es ist wirklich auch klar, sieht nicht mehr aus wie Gülle. Und so kommt es dann direkt in die Fällung."
In trockener Form lassen sich die Mineralstoffe und organischen Reststoffe leicht lagern oder transportieren. Im Prinzip ein beeindruckendes Konzept, urteilt Gerhard Weidner, einer der Besucher auf dem Hofgut in Füßbach:
"Aber ich habe meine Bedenken, ob das auch technisch im großen Rahmen so machbar ist, zum einen. Und zum anderen ob das ökonomisch tragbar ist, ob Investoren gefunden werden."
Landwirte zahlen für die Abnahme von Gülle
Der promovierte Agrarbiologe hat sich nach einer Karriere in der Düngemittelindustrie als Sachverständiger selbständig gemacht. Er stützt sich auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Branche.
"Wenn man die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre zurückschaut, da wurden manche solche Pilotanlagen in Betrieb genommen, um aus hauptsächlich Abwasser von Kläranlagen wieder Phosphat zurückzugewinnen. Dann ist nichts weiter geschehen, keine großen Projekte wurden angegangen, sondern es blieb bei den Pilotanlagen."
Dieses Verfahren dürfte sich aber rechnen - vor allem in jenen Regionen, wo der Wirtschaftsdünger im Überangebot zur Verfügung steht. Denn dort müssen die Landwirte tief in die Tasche greifen, damit ihnen jemand die Tierfäkalien abnimmt, sagt Jennifer Bilbao, die das Projekt am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik koordiniert:
"Die Landwirte müssen bis fünfundzwanzig Euro pro Tonne Gülle bezahlen, damit sie entsorgt wird. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer für die Landwirte. Deswegen: Unsere Technologie kostet natürlich viel weniger als das, also zehn bis fünfzehn Euro weniger als diese fünfundzwanzig Euro pro Tonne."
Die gebürtige Spanierin weist außerdem darauf hin, dass die Rückgewinnung von Nährstoffen aus Gülle verhältnismäßig wenig Energie verschlingt - im Gegensatz zur
synthetischen Herstellung von Stickstoffdünger mit dem Haber-Bosch-Verfahren, das den Stickstoff aus der Luft in eine verwertbare Form umwandelt:
"Dieses Verfahren ist sehr energieintensiv, also zwei Prozent von der ganzen Energieproduktion der Welt wird nur für dieses Verfahren, für das Haber-Bosch-Verfahren eingesetzt. Das ist wahnsinnig viel."

Thomas Karle ist Energielandwirt. Er betreibt die Biogasanlage in Füßbach, wo die Pilotanlage zur Gülleverwertung aufgebaut wurde:
"Ich finde das Verfahren und das Prinzip des BioEcoSIM-Projekts, den Phosphor und Stickstoff gezielt zu eliminieren, sehr interessant, weil ich dadurch unabhängig werde von diesen großen Mengen an Flüssigkeit, die es eben gibt bei Gülle und Gärresten. Und es ist auch eine Technologie, die nicht so kompliziert ist, dass sie nicht auch auf dem Bauernhof oder einer Biogasanlage umzusetzen wäre. Und grade diesen Aspekt von Nährstoffrückführung, Konzentration bei überschaubarer Technologie, finde ich sehr, sehr interessant. Und das bei gleichzeitig überschaubarem Kosten- und Energieeinsatz."
"Es brauchte eine lange Zeit, bis sich meine 'Agriculturchemie' endlich durchsetzte. Zögerlich zuerst, doch die Ergebnisse gaben mir Recht. Von großem Nutzen war mir, dass ich Freunde in der Politik hatte, die sich für meine Ideen einsetzten. Mit Theodor Reuning zum Beispiel stand ich in regem Briefkontakt. Als Regierungskommissar in Sachsen führte er die Landwirtschaft dort zu einer nie zuvor gekannten Blüte. Heutzutage, wo es scheint, dass einige meiner Erkenntnisse in Vergessenheit geraten sind, braucht es vielleicht auch wieder solche Fürsprecher für eine Düngung mit Augenmaß."
Die neue Düngeverordnung hätte im zweiten Quartal dieses Jahres in Kraft treten sollen. Nun dürfte es jedoch bis nach der Sommerpause dauern, denn die EU-Kommission hat Nachbesserungen bei dem Entwurf angemahnt. Wenn es soweit ist, werden die Landwirte zur sogenannten Hoftorbilanz verpflichtet sein, zur Gesamtbilanz aller Stickstoffströme ihres Betriebs. Die Novelle wird von vielen Experten als das wichtigste Instrument angesehen, um die Stickstoffwerte in der Umwelt zu reduzieren. Für Heidi Foth, bis vor kurzem Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, greift sie dennoch zu kurz:
"Die Düngeverordnung ist erst einmal ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. In vielen Aspekten ist der Schritt aber nicht mutig genug im Sinne von Zielen, quantitativen Zielen. Also die Reduktionsverpflichtung ist zumindestens mal aus Sicht des Sachverständigenrates nicht ambitioniert genug, sie ist im Detail nicht engmaschig genug. Es gibt zu viele Ausnahmen, die man formuliert."
Konsumverhalten kann Veränderungen bewirken
Stickstoffverbindungen gelangen außerdem auch auf anderen Wegen in die Umwelt. Bei Verbrennungsvorgängen im Dieselmotor zum Beispiel entstehen Stickoxide, die mit dem Regen niedergehen und so ungewollt für eine großflächige, gleichmäßige Düngung der gesamten Landschaft sorgen. Neben den technischen Lösungen wird also auch die Politik weiterhin am Ball bleiben müssen, um den Stickstoffeintrag zu reduzieren. Und genauso wichtig dürfte es sein, für Verhaltensänderungen zu sorgen. Nicht nur bei den Bauern, sondern auch bei uns Verbrauchern. Denn die Verbraucher entscheiden mit darüber, wie stark ihr "Fußabdruck" ausfällt, meint Foth:
"Wenn ich Obst oder Gemüse esse, habe ich eine bestimmte Stickstoffmenge, die ich brauche für ein Kilogramm Produkt. Wenn ich eine Kartoffel esse, ist das schon mal dreißig Prozent höher. Wenn ich Getreideprodukte esse, ist es schon achtmal höher. Wenn ich Geflügel esse, vierzigmal höher. Wenn ich Rindfleisch esse, zweihundertmal höher. Also in dem Augenblick, in dem wir unser Konsumverhalten ein bisschen ändern, nicht ganz oder gar nicht, sondern hier sind schon moderate zehn Prozent, zwanzig Prozent Veränderung sehr wirksam."
Und hier ist jeder einzelne gefragt, seinen Beitrag zur Lösung des Stickstoffproblems beizutragen. Denn im Fall des Konsumverhaltens gilt: Wenig hilft viel!
Es sprachen: Hildegard Meier, Bodo Primus
Technik: Oliver Dannert
Regie: Axel Scheibchen, Redaktion: Christiane Knoll
Technik: Oliver Dannert
Regie: Axel Scheibchen, Redaktion: Christiane Knoll



