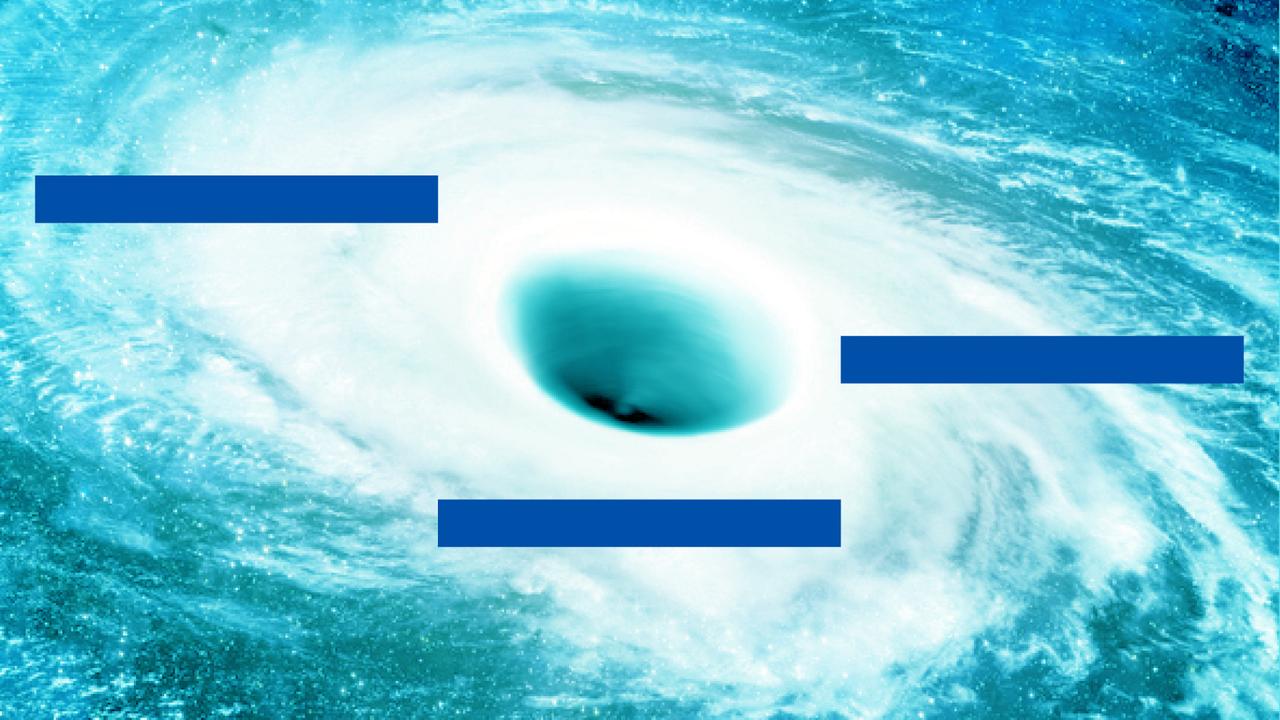
Ein Gen kontrolliert die Drehrichtung von Schneckenhäusern
Die meisten Schneckenhäuser weisen rechts gedrehte Windungen auf. Warum das so ist, galt lange als Rätsel. Japanische Forscher haben es nun aufgeklärt: Sie fanden bei Versuchen mit Spitzschlammschnecken ein Gen, das die Rechtsdrehung auslöst. Ist das Gen defekt, drehen sich die Schneckenschalen nach links. Wie die Forscher im Magazin Development berichten, setzten sie im Rahmen ihrer Studie erstmals die Genschere Crispr ein, um einzelne Gene im Erbgut der Schnecken zu manipulieren. Als sie das Gen Lsdia1 per Crispr deaktivierten, entwickelten die Nachkommen dieser Schnecken links drehende Schneckenhäuser. Auf welche Weise das Gen die Drehrichtung kontrolliert, ist noch unklar.
Quelle: Development
Es gibt einen neuen Rekord im Tiefseetauchen
Knapp 60 Jahre nachdem erstmals Menschen in einem U-Boot fast bis zum Grund des Marianengrabens im pazifischen Ozean vorgedrungen sind, hat dort eine Expedition einen neuen Tiefenrekord aufgestellt. Wie jetzt bekannt wurde, tauchte der US-Millionär und Meeresforscher Victor Vescovo Anfang Mai in einem von ihm mit finanzierten Spezial-U-Boot namens "Limiting Factor" bis 10927 Meter unter den Meeresspiegel hinab. 1960 hatten Don Walsh und Jacques Piccard im U-Boot "Trieste" 10912 Meter erreicht. Neben einigen bisher unbekannten Tierarten, darunter verschiedenen Flohkrebsen, filmte Victor Vescovo auch Plastikmüll am Tiefseegrund – darunter eine Plastiktüte und Bonbon-Papier. Der Tauchgang war Teil der sogenannten Five Deeps Expedition. Ihr Ziel ist es, die tiefsten Stellen aller fünf Weltmeere zu erreichen.
Quelle: Five Deeps Expedition
Plastikmüll im Meer gefährdet auch Bakterien
Und zwar solche, die in den Ozeanen Photosynthese betreiben und Sauerstoff produzieren. Das berichten australische Forscher im Fachmagazin Communications Biology. Prochlorococcus-Cyanobakterien gehören zu den wichtigsten Lebensformen auf unserem Planeten, weil sie rund zehn Prozent des Sauerstoffs produzieren, den wir atmen. Die Wissenschaftler machten Laborstudien mit zwei Prochlorococcus-Stämmen aus unterschiedlichen Meerestiefen. Dabei zeigte sich, dass die Mikroben empfindlich auf den Cocktail chemischer Substanzen reagieren, der aus gängigen Kunststoffarten wie Polyethylen und PVC austreten kann, wenn sie im Meer zersetzt werden. Unter dem Einfluss der Chemikalien wuchsen die Mikroben schlechter und ihre Sauerstoffproduktion ging deutlich zurück – zumindest im Labor. Ob die gleichen Effekte auch in freier Wildbahn zu beobachten sind, müssen weitere Forschungsarbeiten noch zeigen.
Quelle: Communications Biology
2019 könnte ein Waldbrand-Rekordjahr werden
Seit Jahresbeginn bis Ende April sind im europäischen Waldbrandinformationssystem EFFIS europaweit schon mehr als 250.000 Hektar verbranntes Land verzeichnet worden. Damit übertrifft die Feuerstatistik des Jahres 2019 bereits die Zahlen des gesamten Vorjahres. Für 2018 wurden rund 181.000 Hektar an Brandflächen verzeichnet. Laut Angaben des Joint Research Centre der Europäischen Kommission gab es bis Ende April in Europa schon 1233 große Waldbrände mit jeweils über 30 Hektar. Dieser Wert liegt fast elf Mal über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt für die gleiche Periode. Das erhöhte Waldbrandrisiko ist eine Folge des im vergangenen Jahr in vielen Regionen Europas überdurchschnittlich trockenen Klimas. Noch immer sind vielerorts die Böden stark ausgetrocknet.
Quelle: JRC-EFFIS
Dem Windbeobachtungs-Satelliten Aeolus geht die Puste aus
Im vergangenen August gestartet, hat der Satellit Aeolus Meteorologen schon einzigartige Messdaten über Windströmungen rund um die Welt geliefert. Allerdings gibt es jetzt Probleme. Nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA verliert der starke Ultraviolett-Laser, mit dem Aeolus die Luftbewegungen in der Atmosphäre erfasst, kontinuierlich an Leistung. Mittlerweile arbeitet er nur noch mit halber Kraft. Im Juni soll das Mess-System des Satelliten testweise auf einen an Bord befindlichen Backup-Laser umgeschaltet werden. Sollte auch dieser im Betrieb einen ähnlichen Leistungsabfall zeigen, könnte Aeolus möglicherweise nicht einmal die als Minimum geplante Betriebsdauer von drei Jahren erreichen. Bisher gibt es noch keine schlüssige Erklärung für die Leistungsverluste des Lasers. Aeolus ist der erste Satellit, der Windstärke und -richtung vom Weltraum aus messen kann, und zwar in 3D. Er erfasst die Atmosphäre vom Boden bis in 30 Kilometer Höhe.
Quelle: ESA
Wälder könnten in Zukunft weniger zum Klimaschutz beitragen
Wenn Bäume wachsen, binden sie CO2 aus der Luft und speichern den Kohlenstoff im Holz, teilweise über Jahrhunderte hinweg. Bei anhaltendem Klimawandel könnte dieser Beitrag der Wälder zum Klimaschutz allerdings abnehmen, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Nature Communications. Die Wissenschaftler fanden heraus: Mit zunehmenden Temperaturen wachsen Bäume zwar schneller, aber sie sterben in der Regel auch jünger. Damit könnte der gespeicherte Kohlenstoff schneller wieder in die Atmosphäre gelangen. Die Forscher wiesen diesen Zusammenhang anhand von Baumringanalysen an über 1100 lebenden und toten Bergkiefern in den Pyrenäen und 660 sibirischen Lärchen aus dem Altai-Gebirge nach.
Quelle: Nature Communications
