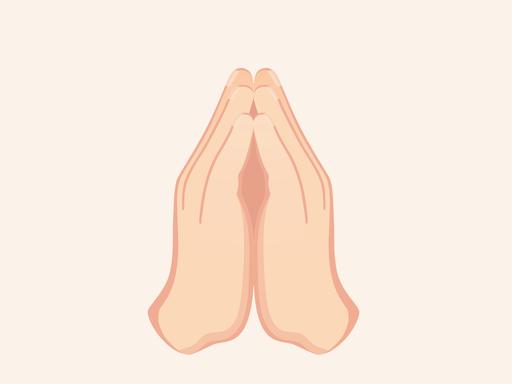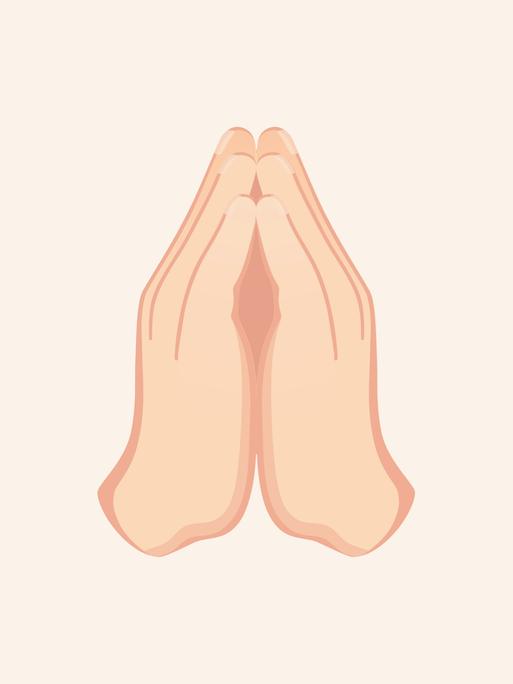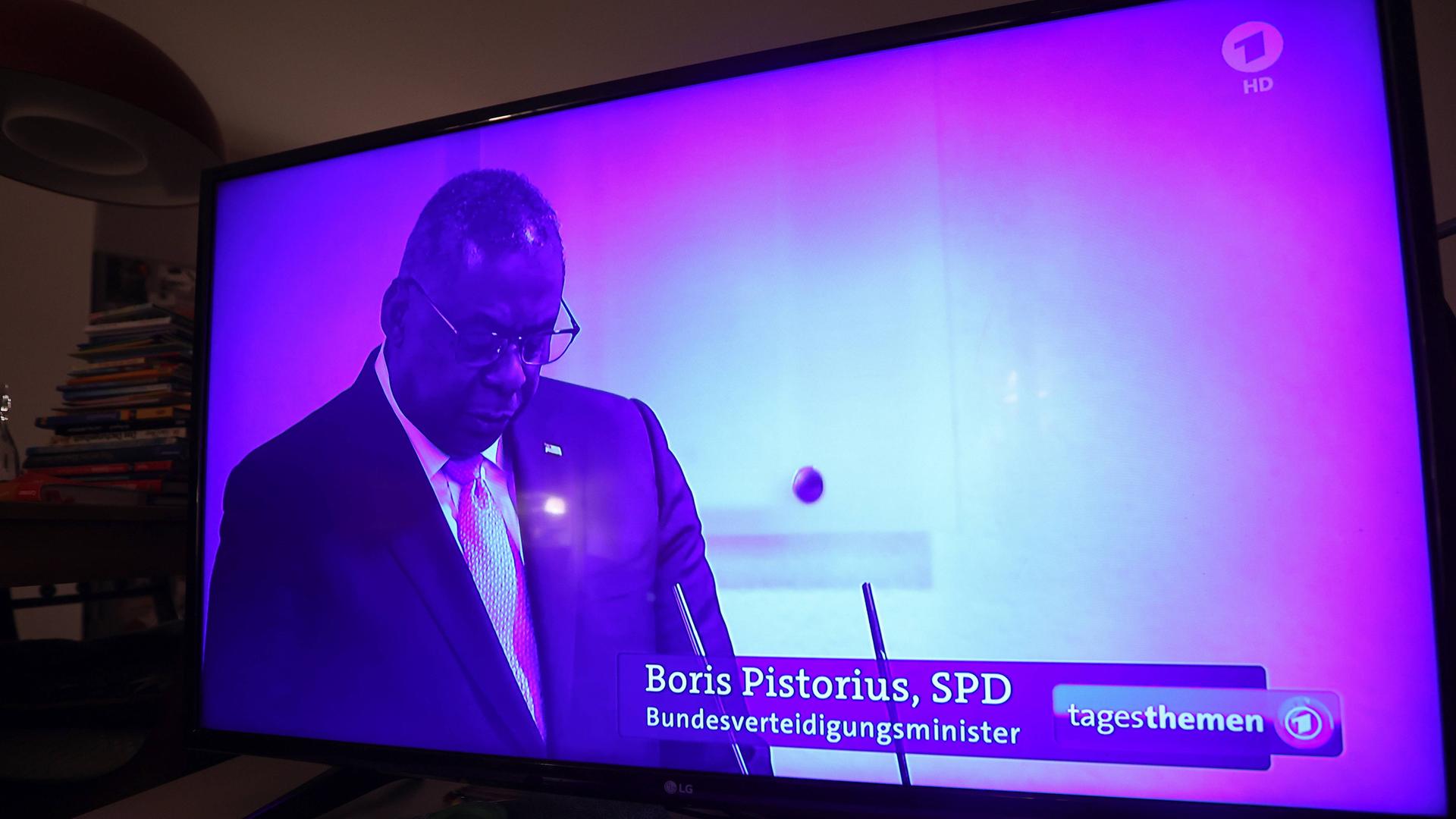Jeder Mensch macht Fehler. Diese einfache Einsicht, die bereits eine gewisse Nachsicht mit der eigenen Fehlbarkeit und die der anderen einfordert, scheint für Politiker oft nicht zu gelten. Hart wird über sie geurteilt, sie werden als privilegiert betrachtet und müssen liefern, Gegenwart und Zukunft gestalten und besser machen. Fehler sind dabei nicht vorgesehen.
Die hohen Erwartungen des Publikums sind teils verständlich, denn Politiker greifen nach Verantwortung und Macht, lassen sich wählen und versprechen vorher oft mehr, als sie hinterher halten können. Ein Fehler von ihnen kann außerdem schrecklich teuer werden: Eine Milliarde Euro ist da schnell weg, für Masken, ein Mautsystem, das nicht kommt, oder für einen neuen Flughafen.
Das ist der Rahmen, wenn über die Fehlerkultur in der Politik diskutiert wird. Natürlich sind auch in der Politik Fehler unvermeidlich. Doch anstatt sie offen einzugestehen, neigt das politische Personal oft dazu, sie zu leugnen, zu vertuschen oder herunterzuspielen.
Mit erstaunlicher Beharrlichkeit besteht beispielsweise Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer darauf, in Sachen Maut nichts falsch gemacht zu haben - obwohl Europarechtler gewarnt hatten, dass die Maut nicht rechtens sei, und sich die Schadensersatzforderungen am Ende auf eine halbe Milliarde Euro beliefen.
Politische Strategien im Umgang mit Fehlern
Strategien in der Politik, von den eigenen Fehlleistungen abzulenken, gibt es einige. Man kann sie leugnen, und wenn das nichts hilft, kleinreden. Ebenso populär: das Aussitzen von Kritik am eigenen Handeln und Gedächtnislücken - so wie bei Olaf Scholz, der sich im Cum-Ex-Skandal einfach immer wieder nicht erinnern konnte. Für das Publikum war es schwierig, das zu glauben.
Hier knüpft die sogenannte Salami-Taktik an: Immer nur zugeben, was tatsächlich nachgewiesen werden kann. Auch möglich: die Täter-Opfer-Umkehr. In der Maskenaffäre versuchte Jens Spahn, sich als Leidtragender einer Kampagne darzustellen. Statt den kritischen Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof über die Maskendeals zur Kenntnis zu nehmen, behauptete der ehemalige Gesundheitsminister, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben: „Die Frage ist trotz allen Bemühens, was wir besser hätten machen können, wo Versäumnis und Schuld liegt.“
Was inzwischen auch öfter praktiziert wird, sind „vergiftete“ Entschuldigungen. Dabei äußert man sein Bedauern nicht für das, was man getan hat, sondern dafür, dass das eigene Handeln jemanden verletzt haben könnte. So entschuldigt man sich, ohne Verantwortung zu übernehmen, sagt die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger, die das Buch „Politische Skandale und politische Macht“ geschrieben hat.
Schließlich gibt es als Strategie auch die schlichte Verweigerung der Reue: "Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa“, sagte Gerhard Schröder zu seiner Kreml-Nähe und seinem Engagement für die russische Energiewirtschaft in einem Interview nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine: „Das ist nicht mein Ding."
Hohe Erwartungen und Fehlerkosten
Warum Politiker so ungern Fehler zugeben, liegt nicht nur am persönlichen Unwillen, sondern auch an den hohen Erwartungen an sie – und daran, dass Fehler schnell die politische und damit auch die eigene wirtschaftliche Existenz kosten können. Wer in der öffentlichen Debatte beschädigt wird, kommt unter Umständen nie mehr richtig auf die Beine. Natürlich versucht auch der politische Gegner, aus jedem kleinen Fehltritt Kapital zu schlagen.
So werden große wie kleine Fehlleistungen gleichermaßen skandalisiert. Als Abwehrhaltung im Dauerfeuer der Kritik erscheinen Hartleibigkeit und Renitenz als Weg, stehenzubleiben und nicht umzufallen. Tatsächlich führen sie auch manchmal zum Ziel: Jens Spahn sitzt als Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag mehr denn je im Zentrum der Macht – während sich Robert Habeck, der über das "Heizungsgesetz" stolperte und sich stets nachdenklich gab, das politische Spiel nur noch vom Bühnenrand beobachtet.
Fehlerkultur und Selbstreflexion
Die politische Fehlerkultur ist in Deutschland nicht auf Selbstreflexion ausgelegt. Im politischen Raum wird um Macht und Wählerstimmen gekämpft. Wer immer stark sein muss, sollte besser keine offenen Flanken haben.
Während das politische Personal mit eher zweifelhaften Strategien persönliche Fehlleistungen verbirgt oder schönredet und nach dem Schein der Unfehlbarkeit strebt, ist der Wunsch nach authentischen Menschen an der Spitze groß – ein Dilemma, das sich nur schwer auflösen lässt.
Die bittere Lehre aus Sicht von Habeck sei, dass aus der Begeisterung für das Nachdenkliche komplette Ablehnung geworden sei, sagt die Journalistin Helene Bubrowski. Das sei schade, denn ein bisschen mehr Nachdenklichkeit hätte der deutschen Politik gutgetan.
Ein falscher Umgang mit Fehlern hilft Populisten
Der Umgang der politischen Akteure mit Fehlern hat Folgen, für die eigene Glaubwürdigkeit als auch für das Ansehen der Demokratie und ihrer Institutionen. Wenn das Gefühl entsteht, dass „die da oben“ machen, was sie wollen, wächst das Misstrauen. Das hilft wiederum den Populisten, die das ganze angeblich „verrottete“ System zum Einsturz bringen wollen.
Scholz und seine Erinnerungslücken: Das komme als „enorme Dreistigkeit“ rüber, sagt Bubrowski, die in ihrem Buch „Die Fehlbaren“ die Egomanie kritikunfähiger Politiker beklagt. „Das nährt die Verdrossenheit, die Ablehnung des Systems, das Gefühl, das funktioniert alles nicht mehr.“
Skandale können aber auch eine positive Wirkung haben, wenn sie denn aufgeklärt werden und Fehler angemessen sanktioniert werden. Wenn das passiert, funktioniert das System von Macht und Kontrolle; das Wahlvolk könne sich auf diese Weise auch immer wieder über gemeinsame moralische und politische Vorstellungen verständigen, betont die Juristin Schönberger.
Gewünscht: mehr Aufrichtigkeit und Gelassenheit
Wünschenswert wären mehr Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, aber auch mehr Realismus und Gelassenheit im Umgang mit Fehlern. Die Unerbittlichkeit, mit der teils über Politiker gerichtet wird, ist für eine fruchtbare Fehlerkultur kontraproduktiv.
Der politische Prozess ist extrem komplex, in der Regel gibt es keine einfachen Antworten. Entscheidungen haben Vorteile, aber immer auch Nachteile. Was heute stimmig und richtig wirkt, kann morgen schon falsch erscheinen, gerade in Stresssituationen wie einer Pandemie.
Fehler müssen schlicht erlaubt sein, angemessene gesellschaftliche Reaktionen zur Folge haben und sollten nicht politisch instrumentalisiert werden. Wie schlimm war er wirklich, der Fehler? Sich darüber zu verständigen, gehört zum Kerngeschäft der Demokratie. Letztlich wäre das auch im Interesse des politischen Personals – denn oft führen gar nicht die Fehler, sondern der Umgang mit ihnen zum Karriereknick, so Schönberger.
Onlinetext: Asmus Heß / Feature: Manuel Gogos