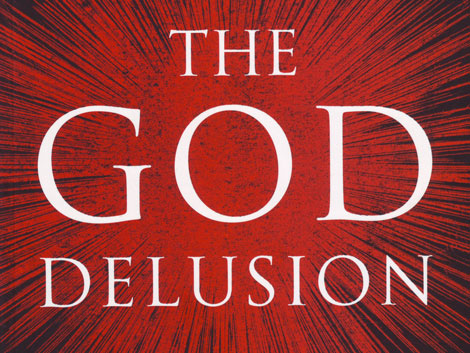" Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. "
So beginnt die Schöpfungserzählung der Bibel. Demnach erschuf Gott die Welt in sieben Tagen. Vom fünften heißt es:
" Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ... und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. "
Jede Tierart, so die Bibel, ist also von Gott eigens und separat von allen anderen erschaffen worden. Dagegen lehrt die Evolutionstheorie Darwins, dass alle Arten auseinander hervorgegangen seien, und zwar ohne Plan, allein nach den Gesetzen der natürlichen Selektion. Und der Mensch ist länger nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein Naturwesen unter anderen.
Wer hat Recht: Darwin oder die Bibel? Insbesondere im konservativen Mittleren Westen der USA, im so genannten Bibel-Belt, verstehen viele die Bibel wortwörtlich - entgegen dem Votum einer aufgeklärten Theologie.
Ulrich Lüke: " Ich glaube die Bibel will keine schlechte Naturkunde darüber sein, wie es zum Menschen gekommen ist, sondern eine Urkunde darüber, was es mit dem Menschen auf sich hat. Wenn ich sie als Naturkunde interpretierte und missintepretierte, würde ich sagen, dann gerät sie in Kollisionskurs mit der Evolutionstheorie und vielen anderen Theorien. "
Ulrich Lüke, Theologieprofessor an der RWTH Aachen, zugleich studierter Biologe hat in diesem Herbst ein Buch mit dem Titel "Das Säugetier von Gottes Gnaden" veröffentlicht. Darin legt er unter anderem dar, warum man die Bibel nicht als dokumentarisches Protokoll der Schöpfung lesen könne.
" Wir haben zwei Schöpfungserzählungen, und die kann man nicht zu einem Topf zusammenrühren und daraus eine machen. Die ältere der beiden Schöpfungserzählungen steht an zweiter Stelle. ... im Volksmund bekannt als Adam-und-Eva-Geschichte. In der Adam-und-Eva-Erzählung steht der Adam am Anfang und wenn ich es etwas flapsig sagen darf: der liebe Gott baut sozusagen ein Biotop um ihn herum. Adam ist derjenige der allen Tieren ihren Namen gibt, und auf die Tiere schaut, aber eine Gehilfin die ihm entspricht findet er nicht. Also schafft Gott in dieser Mythologie aus einer Rippe Adams die Eva - die entsteht gewissermaßen ganz am Ende.
Aber ich muss nur ein redlicher Theologe sein und lese die erste Schöpfungserzählung, das Siebentagewerk, die jüngere der beiden, dann stelle ich fest: ... ganz am Ende, am 6. Tag entstehen Mann und Frau gleichzeitig, und nicht wie in der zweiten älteren Erzählung, im Jahwisten, erst der Adam dann die übrige Biologie und dann Eva. "
Das Beispiel zeigt, dass der Bibeltext keineswegs eindeutig, sondern widersprüchlich und interpretationsbedürftig ist. Seit dem Zeitalter der Aufklärung hat sich eine historisch-kritische Auslegung der Bibel entwickelt, die heute fest etabliert ist, - anders als im Islam, wo eine entsprechende Koranlektüre noch in den Anfängen steckt und heftig angefeindet wird.
Die neuesten Gegner der Evolutionslehre berufen sich aber nicht primär auf Bibel oder Koran, sondern argumentieren naturwissenschaftlich.
Die Vertreter des so genannten Intelligent Design behaupten, dass sich Ursprung und Entwicklung des Lebens besser durch die Annahme eines Intelligenten Designs, also eines schöpferischen Plans, erklären lasse als durch ungelenkten Zufall, wie Darwin lehrt.
Evolutionsbiologen behaupten dagegen, das Intelligent Design sei keine fundierte Wissenschaft, sondern eine verkappte religiöse Weltanschauung. Auch Ulrich Lüke beurteilt diese Strömung kritisch:
" Es sind darunter durchaus nicht unwichtige Naturwissenschaftler. Und Mathematiker, das ist erstaunlich, dass sie sich für diese Fraktion engagieren. Sie behaupten, dass es in der Entwicklungsgeschichte gewissermaßen Sprünge gegeben haben muss, in der Komplexität der Entwicklung, die so groß sind, dass wenn die Natur nur gewürfelt, nur auf Zufall gesetzt hätte, der Kosmos viel älter sein müsste, als er ist. Das rechnet z.B. der Mathematiker Demsky oder auch der Biologe Michael Behe aus den USA vor, die beide als Galionsfiguren dastehen. "
Design must have a designer. Ein Design muss einen Designer haben. Dieser Designer muss eine Person sein. Diese Person ist Gott.
Der englische Theologe William Paley, ein Vordenker des Intelligent Design hatte 1802 noch offen von Gott als dem Designer gesprochen. Dagegen verstecken sich die Anhänger heute hinter Argumenten der Wahrscheinlichkeitstheorie - wie sie der Physiker Frederick Hoyle pointiert:
"Die Chance, dass höhere Lebensformen durch Zufall entstanden sind, ist vergleichbar der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado, der über einen Schrottplatz fegt, aus den dort herumliegenden Teilen eine Boeing 747 entstehen lässt."
Ulrich Kutschera, ein Kasseler Evolutionsbiologe, hält dem entgegen, dass komplexe Gebilde nicht in einem einzigen Zug entstehen, dass sich die Evolution vielmehr in unzähligen Schritten vollzogen habe, manchmal über Jahrmillionen. Der Streit um Intelligent Design hat inzwischen Europa erreicht. Dafür sorgte nicht zuletzt der Wiener Kardinal Schönborn, der im letzten Jahr in einem Artikel der New York Times der Evolutionstheorie den Kampf ansagte. Mit der These: "Jedes Denksystem, das die überwältigende Evidenz für einen Plan in der Biologie leugnet oder wegzuerklären versucht, ist Ideologie, nicht Wissenschaft."
Ulrich Lüke:
" Nach diesen ersten Einlassungen im Sommer 2005, die im International Herold Tribune drin waren, und in der New York Times, hat er eine ganze Reihe von Katechesen im Wiener Stefansdom gehalten, und in denen er sich definitiv nicht identifiziert mit dem Kreationismus und dem Intelligent Design. Ich glaube er hat einen etwas unglücklichen Zugriff getan, als er sich festgehakt hat, am Begriff Zufall. Er hat gesagt, wer sage die Prozesse der Evolution seien eben auch zufallsgesteuert, der würde die Möglichkeit des Einwirkens Gottes ausschließen, einige Evolutionsbiologen in den USA haben sehr sauer reagiert, und ihm allerlei vorgeworfen, ich glaube beide Seiten haben nicht genau geklärt, was sie mit Zufall meinen. "
Der Streit um die Definition des Zufalls trifft den Kern des Problems: Für den Gläubigen mag es durchaus Zufall geben, aber er ist nicht die letzte Instanz. Für die Evolutionisten hingegen ist der Zufall prinzipiell, ohne zugrunde liegenden Zweck. An diesem Punkt lassen sich Schöpfungsglaube und Evolutionismus nicht versöhnen.
Doch es handelt sich nicht nur um einen Streit über die Entstehung des Lebens, hier wird auch ein Kampf ausgetragen um die Deutungshoheit zwischen Wissenschaft und Glaube. Inzwischen sind die Evolutionisten zum Gegenangriff übergegangen und haben ihrerseits die Demarkationslinie überschritten. "The God Delusion - Die Gott-Wahnvorstellung" - heißt das neue Buch von Richard Dawkins, mit dem der britische Zoologe zur Abkehr vom Glauben aufruft.
Aber keine Seite, Wissenschaft ebenso wenig wie Religion, hat ein Monopol auf letzte Wahrheit: Die Wissenschaft kann nicht beweisen, dass es keinen Schöpfergott gibt; die Religion darf die Menschen nicht zwingen, an seine Existenz zu glauben.
Und auch die Frage nach dem Menschen bleibt offen. Zwar hat die Evolutionstheorie sehr nachhaltig unsere Naturseite aufgehellt, aber sie kann nicht für sich reklamieren, dass damit alles über die menschliche Existenz gesagt sei.
So beginnt die Schöpfungserzählung der Bibel. Demnach erschuf Gott die Welt in sieben Tagen. Vom fünften heißt es:
" Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ... und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. "
Jede Tierart, so die Bibel, ist also von Gott eigens und separat von allen anderen erschaffen worden. Dagegen lehrt die Evolutionstheorie Darwins, dass alle Arten auseinander hervorgegangen seien, und zwar ohne Plan, allein nach den Gesetzen der natürlichen Selektion. Und der Mensch ist länger nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein Naturwesen unter anderen.
Wer hat Recht: Darwin oder die Bibel? Insbesondere im konservativen Mittleren Westen der USA, im so genannten Bibel-Belt, verstehen viele die Bibel wortwörtlich - entgegen dem Votum einer aufgeklärten Theologie.
Ulrich Lüke: " Ich glaube die Bibel will keine schlechte Naturkunde darüber sein, wie es zum Menschen gekommen ist, sondern eine Urkunde darüber, was es mit dem Menschen auf sich hat. Wenn ich sie als Naturkunde interpretierte und missintepretierte, würde ich sagen, dann gerät sie in Kollisionskurs mit der Evolutionstheorie und vielen anderen Theorien. "
Ulrich Lüke, Theologieprofessor an der RWTH Aachen, zugleich studierter Biologe hat in diesem Herbst ein Buch mit dem Titel "Das Säugetier von Gottes Gnaden" veröffentlicht. Darin legt er unter anderem dar, warum man die Bibel nicht als dokumentarisches Protokoll der Schöpfung lesen könne.
" Wir haben zwei Schöpfungserzählungen, und die kann man nicht zu einem Topf zusammenrühren und daraus eine machen. Die ältere der beiden Schöpfungserzählungen steht an zweiter Stelle. ... im Volksmund bekannt als Adam-und-Eva-Geschichte. In der Adam-und-Eva-Erzählung steht der Adam am Anfang und wenn ich es etwas flapsig sagen darf: der liebe Gott baut sozusagen ein Biotop um ihn herum. Adam ist derjenige der allen Tieren ihren Namen gibt, und auf die Tiere schaut, aber eine Gehilfin die ihm entspricht findet er nicht. Also schafft Gott in dieser Mythologie aus einer Rippe Adams die Eva - die entsteht gewissermaßen ganz am Ende.
Aber ich muss nur ein redlicher Theologe sein und lese die erste Schöpfungserzählung, das Siebentagewerk, die jüngere der beiden, dann stelle ich fest: ... ganz am Ende, am 6. Tag entstehen Mann und Frau gleichzeitig, und nicht wie in der zweiten älteren Erzählung, im Jahwisten, erst der Adam dann die übrige Biologie und dann Eva. "
Das Beispiel zeigt, dass der Bibeltext keineswegs eindeutig, sondern widersprüchlich und interpretationsbedürftig ist. Seit dem Zeitalter der Aufklärung hat sich eine historisch-kritische Auslegung der Bibel entwickelt, die heute fest etabliert ist, - anders als im Islam, wo eine entsprechende Koranlektüre noch in den Anfängen steckt und heftig angefeindet wird.
Die neuesten Gegner der Evolutionslehre berufen sich aber nicht primär auf Bibel oder Koran, sondern argumentieren naturwissenschaftlich.
Die Vertreter des so genannten Intelligent Design behaupten, dass sich Ursprung und Entwicklung des Lebens besser durch die Annahme eines Intelligenten Designs, also eines schöpferischen Plans, erklären lasse als durch ungelenkten Zufall, wie Darwin lehrt.
Evolutionsbiologen behaupten dagegen, das Intelligent Design sei keine fundierte Wissenschaft, sondern eine verkappte religiöse Weltanschauung. Auch Ulrich Lüke beurteilt diese Strömung kritisch:
" Es sind darunter durchaus nicht unwichtige Naturwissenschaftler. Und Mathematiker, das ist erstaunlich, dass sie sich für diese Fraktion engagieren. Sie behaupten, dass es in der Entwicklungsgeschichte gewissermaßen Sprünge gegeben haben muss, in der Komplexität der Entwicklung, die so groß sind, dass wenn die Natur nur gewürfelt, nur auf Zufall gesetzt hätte, der Kosmos viel älter sein müsste, als er ist. Das rechnet z.B. der Mathematiker Demsky oder auch der Biologe Michael Behe aus den USA vor, die beide als Galionsfiguren dastehen. "
Design must have a designer. Ein Design muss einen Designer haben. Dieser Designer muss eine Person sein. Diese Person ist Gott.
Der englische Theologe William Paley, ein Vordenker des Intelligent Design hatte 1802 noch offen von Gott als dem Designer gesprochen. Dagegen verstecken sich die Anhänger heute hinter Argumenten der Wahrscheinlichkeitstheorie - wie sie der Physiker Frederick Hoyle pointiert:
"Die Chance, dass höhere Lebensformen durch Zufall entstanden sind, ist vergleichbar der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado, der über einen Schrottplatz fegt, aus den dort herumliegenden Teilen eine Boeing 747 entstehen lässt."
Ulrich Kutschera, ein Kasseler Evolutionsbiologe, hält dem entgegen, dass komplexe Gebilde nicht in einem einzigen Zug entstehen, dass sich die Evolution vielmehr in unzähligen Schritten vollzogen habe, manchmal über Jahrmillionen. Der Streit um Intelligent Design hat inzwischen Europa erreicht. Dafür sorgte nicht zuletzt der Wiener Kardinal Schönborn, der im letzten Jahr in einem Artikel der New York Times der Evolutionstheorie den Kampf ansagte. Mit der These: "Jedes Denksystem, das die überwältigende Evidenz für einen Plan in der Biologie leugnet oder wegzuerklären versucht, ist Ideologie, nicht Wissenschaft."
Ulrich Lüke:
" Nach diesen ersten Einlassungen im Sommer 2005, die im International Herold Tribune drin waren, und in der New York Times, hat er eine ganze Reihe von Katechesen im Wiener Stefansdom gehalten, und in denen er sich definitiv nicht identifiziert mit dem Kreationismus und dem Intelligent Design. Ich glaube er hat einen etwas unglücklichen Zugriff getan, als er sich festgehakt hat, am Begriff Zufall. Er hat gesagt, wer sage die Prozesse der Evolution seien eben auch zufallsgesteuert, der würde die Möglichkeit des Einwirkens Gottes ausschließen, einige Evolutionsbiologen in den USA haben sehr sauer reagiert, und ihm allerlei vorgeworfen, ich glaube beide Seiten haben nicht genau geklärt, was sie mit Zufall meinen. "
Der Streit um die Definition des Zufalls trifft den Kern des Problems: Für den Gläubigen mag es durchaus Zufall geben, aber er ist nicht die letzte Instanz. Für die Evolutionisten hingegen ist der Zufall prinzipiell, ohne zugrunde liegenden Zweck. An diesem Punkt lassen sich Schöpfungsglaube und Evolutionismus nicht versöhnen.
Doch es handelt sich nicht nur um einen Streit über die Entstehung des Lebens, hier wird auch ein Kampf ausgetragen um die Deutungshoheit zwischen Wissenschaft und Glaube. Inzwischen sind die Evolutionisten zum Gegenangriff übergegangen und haben ihrerseits die Demarkationslinie überschritten. "The God Delusion - Die Gott-Wahnvorstellung" - heißt das neue Buch von Richard Dawkins, mit dem der britische Zoologe zur Abkehr vom Glauben aufruft.
Aber keine Seite, Wissenschaft ebenso wenig wie Religion, hat ein Monopol auf letzte Wahrheit: Die Wissenschaft kann nicht beweisen, dass es keinen Schöpfergott gibt; die Religion darf die Menschen nicht zwingen, an seine Existenz zu glauben.
Und auch die Frage nach dem Menschen bleibt offen. Zwar hat die Evolutionstheorie sehr nachhaltig unsere Naturseite aufgehellt, aber sie kann nicht für sich reklamieren, dass damit alles über die menschliche Existenz gesagt sei.