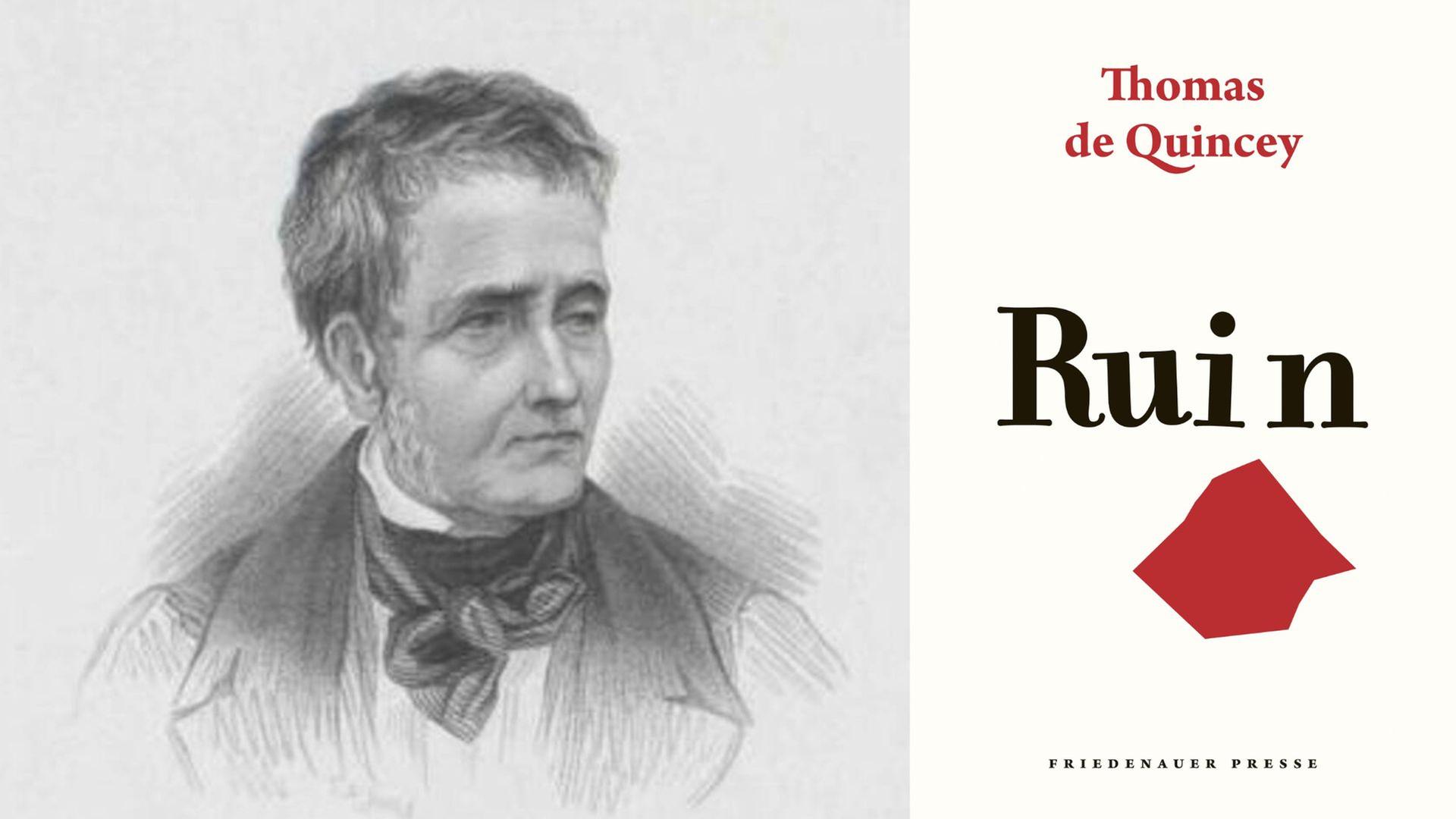
Wie aus Steinchen des Anstoßes eine zermalmende Schicksalslawine wird, davon erzählt Thomas de Quincey in „The Household Wreck“ von 1838. Die deutsche Übersetzung dieser ebenso erschütternden wie doppelbödigen Geschichte vom Untergang einer jungen Familie trägt den Titel „Ruin“. Zu Beginn erinnert sich der Ich-Erzähler, noch immer erschaudernd, an den sonnigen Apriltag vor 28 Jahren, der ihn aus seiner „Glückseligkeit“ riss. Grundlage dieses Glücks war die Tatsache, dass er sich ohne materielle Sorgen ganz der Verfeinerung seines Verstandes und der Pflege seines reinen Gewissens widmen konnte, aber noch mehr die Liebe zu seiner jungen, schönen Frau Agnes. Sie ist es, die aus heiterem Himmel das Verhängnis ereilt:
„Oh, taubengleiches Weib!, dazu ausersehen, in der Stunde höchster Wehrlosigkeit einem beutegierigen Geier zu begegnen – du Lamm, das mitten hinein in ein Rudel Wölfe geraten ist – zitternd – du bebendes Rehkitz, das den Pfad des blutrünstigen Tigers kreuzte …“
Die Spannung wächst ins Unerträgliche
Der Autor de Quincey beziehungsweise sein Erzähler bietet einiges auf, um die Erwartungen seines Lesepublikums zu befeuern, nicht nur mittels rhetorischer Höchstleistungen wie dieser hyperbolischen Reihung schwülstiger Metaphern. Bevor er zu seiner eigenen unter den zahllosen – wie er es nennt – „rasenden Tragödien und schlagartigen Verwüstungen“ des gesellschaftlichen Lebens kommt, serviert er seitenlang philosophische Parerga und Paralipomena, unter anderem zu den Folgen von Pech in geschäftlichen Unternehmungen. Womit immerhin angedeutet ist, in welchem Zusammenhang der titelgebende „Ruin“ sich abgespielt haben mag.
Es folgt eine Art Disclaimer, warum Namen und Orte nicht benannt werden, es folgt die ausführliche Schilderung des heiteren Frühlingstags, es folgt eine umständliche Selbstbeschreibung, es folgt die mindestens so umständliche Würdigung der für immer verlorenen holden Agnes samt Geschichte ihrer Liebe und Ehe, all dies reich geschmückt mit Zitaten aus Bibel und griechischem Mythos, Miltons „Verlorenem Paradies“ und Shakespeares Dramen sowie Versen der mit de Quincey befreundeten Zeitgenossen Coleridge und Wordsworth. Endlich beginnt so etwas wie Handlung, mit einer ungarischen Hellseherin nämlich, die dem Erzähler nahelegt, um Abwendung eines nicht näher bezeichneten finsteren Geschicks zu beten. Und noch immer steigt die Spannung auf das alles zerschmetternde Ereignis.
Es steigt aber auch ein gewisser Unmut auf, ja, leises Misstrauen, die Frage, wozu dieser Erzähler solche Spitzenklöppelei betreibt, zumal er sich, als endlich der sonnige, verhängnisvolle 6. April herangekommen ist, erst einmal in Erklärungen ergeht, aus welch guten Gründen er keinerlei Anlass hatte, seine junge, unerfahrene Frau bei ihrem Einkaufsgang ins Gewimmel der Stadt zu begleiten. Einen Gang, von dem sie nicht zurückkehrt. Heutige Leserschaft, an straffe Plots gewohnt, ist da schon ganz kribbelig. Der Erzähler jedoch, anstatt zu offenbaren, was zum Teufel geschehen ist, berichtet zunächst, wie Agnes sich die unbedingte Zuneigung einer tatkräftigen Hausangestellten erworben hat. Mit dieser will er nun in die Stadt eilen, um nach der Vermissten zu suchen. Jedoch muss der Mann erst noch seinen Milton aufschlagen und landet ausgerechnet bei den – wahrhaft ominösen – Versen von Evas Ausbleiben und Adams Bangen.
Wenn das Schicksal an die Tür klopft
Plötzlich steht ein Polizist vor der Tür: Agnes ist eingekerkert worden. Überflüssig zu erwähnen, dass es nochmals viele Seiten dauert, bis die Natur der Anschuldigung zu erfahren ist. Umso zügiger scheint der Erzähler bereit, sich ins Unabänderliche zu schicken:
„In diesem Moment, während eines Lidschlags bloß und doch von nun an für alle Ewigkeit unbestreitbar, begriff ich den vollständigen Ruin meiner Lage. (…) Ich war der abschließenden Ergebnisse so unumstößlich, unwiderruflich und hoffnungslos sicher, als hätte ich sie schon mit eigenen Augen in den Schicksalsbüchern des Himmels verzeichnet gefunden.“
De Quincey verarbeitete in „Ruin“ einen realen Londoner Skandal. Eine Dame der Gesellschaft, Tante der Schriftstellerin Jane Austen, war beschuldigt worden, im Laden ein Stück Spitze entwendet zu haben, und deshalb vor Gericht gelandet. Eine ernste Sache, waren die Strafen für „Shop-Lifting“ doch drakonisch, zugleich gab es ein florierendes Erpressergewerbe mit untergeschobenem Diebesgut.
Auf diesen Erzähler ist kein Verlass
In seinem lesenswerten Nachwort erhellt der Herausgeber und Übersetzer Andreas Hofbauer diese Hintergründe und die niederschmetternden Lebensumstände des Autors, die ihre Spuren im Text hinterlassen haben. Zu Recht zitiert Hofbauer Thomas de Quinceys autobiografische „Suspiria de Profundis“, in denen es heißt,
„dass das unbeschreibliche Leid, das ich durchmachen musste, für mich einen Schacht in die Welten des Todes und der Dunkelheit trieb, der sich niemals wieder schloss und den ich, wie man sagen könnte, hinab- und hinaufsteige, wie es mir gefällt und wie es meine Gemütslage gebietet.“
Im Unterschied zum glimpflichen Ausgang der wahren Geschichte von Jane Austens Tante endet de Quinceys Story denkbar schlimm. Unglückliche Umstände und menschliche Niedertracht führen dazu, aber vor allem das Vergessen entlastender Tatsachen und Verschweigen beunruhigender Warnzeichen.
Die Unzuverlässigkeit der Erinnerung ist das eigentliche Thema von „Ruin“, der literarischen Umsetzung von de Quinceys These, das Gedächtnis sei ein Palimpsest, immer neu überschrieben durch das, „was die Gemütslage gebietet“. Damit hat Thomas de Quincey Maßstäbe gesetzt für den „unreliable narrator“ in der britischen Literatur, für die unzuverlässigen Erzähler von Ford Madox Ford bis Barbara Vine, Julian Barnes und Ian McEwan. „Ruin“ ist mit der ganzen dynamischen Energie der Schauerromantik aufgeladen und hinterlässt am Ende die Impression ironischer Melancholie. Eine schöne Einladung zur weiteren Entdeckung eines großen Werks.
Thomas de Quincey: „Ruin“
Aus dem Englischen übersetzt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Andreas L. Hofbauer
Friedenauer Presse bei Matthes & Seitz, Berlin
196 Seiten, 18 Euro.
Aus dem Englischen übersetzt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Andreas L. Hofbauer
Friedenauer Presse bei Matthes & Seitz, Berlin
196 Seiten, 18 Euro.

