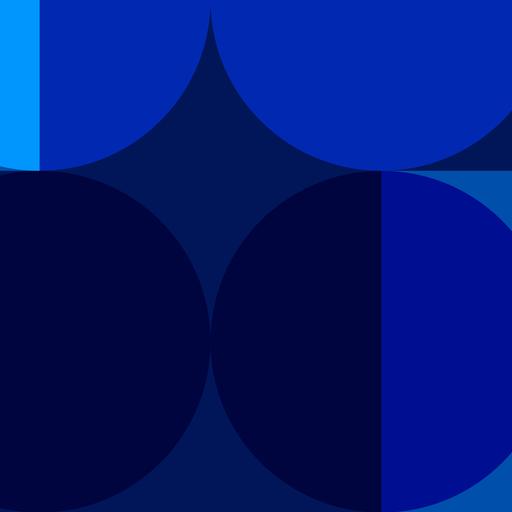Auf der Rue Sainte-Cathérine in Montréal ist das multikulturelle Leben Kanadas mit den Händen zu greifen. Die Kolonialgeschichte und auch die traditionell liberale Immigrationspolitik prägen die Millionenstadt.
Neben den Abkömmlingen der Kolonisatoren haben heute Menschen aus allen Teilen der Welt hier ihr Zuhause. Daneben gibt es drei besonders geschützte Minderheitengruppen: die Inuit aus den arktischen Regionen, die Metis, Nachfahren der französischen Pelzhändler und die "First Nations" genannten, nomadischen Ureinwohner. 140.000 Angehörige der First Nations-Stämme leben heute in Québec, die meisten von ihnen in Reservaten abseits der Städte.
Die Geschichte der First Nations, im Volksmund auch als "Indianer" bekannt, ist bis heute trotz vieler politischer Anstrengungen ein ungelöstes Kapitel. Beim Eintreffen der Franzosen passten sich die nomadischen Stämme den neuen Umständen an. Während die Ureinwohner die Kolonisatoren durch die unwirtlichen Weiten der kanadischen Natur führten, wurden sie als Gegenleistung mit modernen Werkzeugen und Waffen entlohnt. Der Verlust ihrer traditionellen Lebensweise hat Folgen bis in die Gegenwart: Québecs zehn Stammesgemeinschaften haben bis heute mit großen sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, vor allem in den rund 30 Reservaten.
Die kultisch verehrte Sängerin und Aktivistin Alanis Obomsawis kämpfte schon in den 1960er Jahren für die Anerkennung der verdrängten Stammeskulturen und gegen die industrielle Ausbeutung ihrer angestammten Lebensräume.
Eine Innu erzählt aus ihrer Zeit in der Residential School
Im 19. Jahrhundert hatte man den First Nations Reservate zugeteilt, in denen sie ihre Traditionen des Gemeinschaftslebens mehr schlecht als recht aufrechterhielten. Noch bis ans Ende des 20. Jahrhunderts wurden 80.000 Kinder ihren indianischen Familien entrissen und in staatliche "residential schools" zur Zwangsassimilation verbracht. Die Dichterin Josephine Bacon ist eine von denen, die die residential schools erlebten. Wir treffen die rüstige alte Dame vom Volk der "Innu" in einem kleinen Café in Montreal.
"14 Jahre lang habe ich in einer residential school verbracht. Als ich 1947 geboren wurde, haben meine Eltern noch als Nomaden gelebt. Sie waren vom Volk der Innu. 1952 wurde ich gezwungen, in eines dieser Internate zu gehen. Wir sollten lesen und schreiben lernen, aber vor allem ging es darum, die Gemeinschaft der Innu zu zerstören, damit die Großindustrie das Stammesgebiet ungestört ausbeuten konnte. Eisenmienen, Wälder für die Holzproduktion und die Flüsse zur Energiegewinnung – alles befand sich auf unseren angestammten Gebieten! Die haben damit ein Vermögen verdient", erklärt Josephine Bacon entschlossen aber ganz ohne Groll. Seit über 40 Jahren unterrichtet sie Jugendliche ihres Reservates im Norden in der traditionellen Sprache Innu-Aimun.
Das Reservat, das sind ihre Wurzeln. Das Leben in der Stadt ist für viele eine Illusion, ein Trugbild. Das Leben im Reservat ist sicherlich nicht perfekt. Aber in der Stadt, wo sie vereinsamen, sicherlich noch weniger.
Leben im Reservat Uashat
Die Reservate im Norden haben bei den weißen Québecern einen schlechten Ruf. Tatsächlich ist dort die Arbeitslosigkeit hoch, die Lebenserwartung gering, das Bildungsniveau niedrig, die Kriminalitätsrate überdurchschnittlich, und auch Krankheiten, Drogen, Alkohol und die Suizidrate sind reale Probleme. Um uns selbst einen Eindruck zu verschaffen, machen wir uns auf den Weg ins Reservat Uashat, rund 1000 Kilometer nördlich von Montreal, dort wo der Sankt-Lorenz-Strom in den Atlantik mündet.
Als uns die kleine, reichlich wackelige Propeller-Maschine am Flughafen von Sept-Iles absetzt, wird schnell klar, dass das Leben hier oben anders funktioniert. Der Flughafen ist ein maroder Betonbau, für ein Transportmittel in die Stadt muss man selbst sorgen.
Verabredet sind wir mit Naomi Fontaine, einer preisgekrönten Autorin und gebürtigen Innu. Naomi verbringt ihr Leben als Schriftstellerin in Québec-Stadt und als Lehrerein im Reservat Uashat. Um dorthin zu gelangen durchqueren wir zu Fuß die Kleinstadt Sept-Iles: große Geländewagen stehen vor einfachen Holzbungalows, kein Fußgänger weit und breit. Ehe wir uns versehen, stehen wir vor Naomis kleinem Holzhaus am Rande der Bucht vom Reservat Uashat.
Naomi - dunkel funkelnde Augen und bunte Federohrringe - bereitet uns einen kühlen, wortlosen Empfang. Besuch ist man im Reservat Uashat nicht gewohnt. Am Tisch der Wohnküche bricht dann doch nach und nach das Eis.
"Wir leben hier ein bisschen wie in einem gallischen Dorf, wir müssen davor gefeit sein, eingenommen zu werden. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass unsere Kultur nicht schützenswert sei, dass die Welt uns nicht wollte. Deswegen öffnen wir uns Fremden gegenüber nicht so einfach. Seit der Gründung der Reservate und der Zwangsinternate, waren Fremde für uns immer wie eine Bedrohung. Aber das ändert sich langsam. Wir stehen viel mehr zu unserer Kultur als früher. Wir pflegen unsere Sprache und unsere Traditionen", erklärt Naomi und lädt auf eine Spritztour durch das Reservat ein.
Einblick in eine schamanische Welt
Entschlossen springt sie auf den Fahrersitz ihres Geländewagens, schaltet das Radio an und zündet sich die nächste Zigarette an. Als erstes geht es zum alten Campingplatz an der Meeresbucht. Wir nähern uns einem kuppelförmigen Holzbauskelett mit einer Feuerstelle in der Mitte.
"Hier schau, das ist ein "matutishan", ein Schwitzzelt. Bei einer Sitzung wird es abgedeckt, damit sich die Hitze entwickeln kann. Das Ganze wird sehr heiß und dient der Reinigung von Seele, Geist und Körper. Die Traditionalisten heilen damit physische und psychische Krankheiten, sie treten in Kontakt mit unseren Geistern...Siehst du, wie eine Sauna – hier in der Mitte werden heiße Steine aufgestapelt..."
Während der Zeremonie im Schwitzzelt wird ein Tambourin geschlagen, das aus der Haut des spirituell verehrten Rentiers gefertigt sein muss, eine Spezialität von Naomis Onkel Ovila. Er weiß viel zu berichten, spricht aber lieber nicht ins Mikrophon. Regelmäßig fährt der sanfte Mitfünfziger auf Rentierjagd ein paar Hundert Kilometer weiter in den Norden, versorgt seine Familie und seinen Stamm mit Nahrungsvorräten, ganz so wie es die Tradition will. Ovila kennt sich auch aus mit dem so genannten "zitternden Zelt", das im Wald aufgeschlagen wird. Durch die Kraft des Tamburin-Rhythmus bringt ein Schamane das Zelt in Vibration, tritt mit dem Jenseits in Kontakt und vertreibt böse Gedanken oder sorgt für eine erfolgreiche Jagd. Naomis Familie setzt sich dafür ein, dass in der Bucht von Uashat ein Ort entsteht, an dem traditionelles autochthones Leben stattfinden kann.
"Mein Onkel hat das Projekt dem Clan-Rat vorgeschlagen. Der Rat ist die Regierung unseres Reservats, er verwaltet alle Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, sowie alle Verwaltungsangelegenheiten, Bebauungspläne, bis hin zu unseren drei Schulen. Der Rat erhält Gelder von der kanadischen Zentralregierung und ist dann mehr oder weniger frei, damit zu tun, was er will. Der Rat wird turnusgemäß gewählt und funktioniert dann wie eine kleine, autonome Monarchie."
Auch die alte Umladestation für Biberfälle ist noch erhalten und wird heute als Ausflugsziel und als sozialer Treffpunkt zwischen den weißen Quebecern und den Innu genutzt.
Die Innu pflegen eine andere Art zu denken
"Die soziale Trennung zwischen den Weißen und uns Innu begann eigentlich erst mit den Reservaten. Davor waren wir aufeinander angewiesen. Mein Großvater hat noch mit Biberpelzen gehandelt. Später kamen der Holzhandel und dann die Eisenminen. In den Reservaten haben die Innu ihre Würde verloren. Und schließlich ging auch der Pelzhandel ein."
Trotz der sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Reservat Uashat, wächst seit einigen Jahren ein neuer Zusammenhalt zwischen den 1500 Bewohnern, eine selbstbewusste Rückbesinnung auf die gemeinsamen Traditionen, erklärt Naomi. Auch die Regierung von Québec unterstützt die Innu mit speziellen Förderprogrammen. Am Abend lädt uns ihr Onkel Ovila tatsächlich noch zu einem üppigen Abendessen ein, natürlich mit selbst erlegtem Rentier nach traditioneller Art. Das ambivalente Verhältnis zu den Weißen, und auch die Schwierigkeiten der Innu, ihren Platz zwischen den Traditionen und der modernen Leistungsgesellschaft zu finden, erklärt Naomi am Ende so:
"Uns Innu macht aus, dass wir sehr nah an unseren Emotionen sind. Das Innu-Wort für "nachdenken" bedeutet wörtlich übersetzt "mit dem Herzen denken". Wir sind nicht sehr rational, was das Leben manchmal vereinfacht und manchmal erschwert."
Die Reise nach Uashat wurde unterstützt vom Toledo-Proramm des Deutschen Übersetzerfonds und von der Vertretung der Regierung von Québec Büro Berlin.