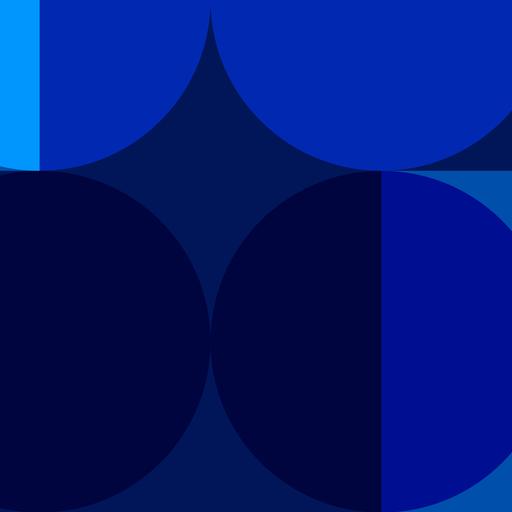Tarnowskie Góry, früher Tarnowitz, ist eine Kleinstadt rund 25 Kilometer von Kattowitz. In Tarnowitz begann der Abbau von Silber, Blei und Zink schon im Mittelalter. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab man die Förderung auf. 1976, mitten im kommunistischen Polen unter Edward Gierek, einem Parteiführer, der selbst unter Tage gearbeitet hatte, öffnete das Bergbaumuseum am Rande der Stadt.
"... und hier haben wir noch die Lampen. Es waren ja zwei Arten Lampen möglich mitzunehmen. Entweder Öl oder Rindfett, Talg. Er musste seinen Brennstoff haben. Öl war Risiko, weil oft stürzte so eine Lampe herunter, und die war nicht zu retten. Ist bei der Fettlampe geblieben. Und das ist Schichtlampe. Volle geladene Schicht Fett brannte sechs Stunden ab. Er musste zwölf Stunden arbeiten. Also hat er gleich auch Zeitmaß daneben. Er wusste ja jetzt, wenn das zu Ende brannte: Jetzt ist die Zeit hochzuklettern, mit den Leitern, weil von Zuhause war er erwartet."
Der Erzählstollen von Tarnowitz
Zygmunt Koloch ist ein Pionier des Bergbautourismus in Oberschlesien. Seit vielen Jahren führt er Besucher unter Tage durch die Erzstollen von Tarnowitz. Heute geht es per Fahrstuhl 40 Meter hinab ins Stollenlabyrinth: eineinhalb Kilometer freigegebene Strecke, zu durchwandern teilweise nur mit eingezogenem Kopf.
Zygmunt Koloch drückt ab und zu einen Schalter. Tonträger sollen den Besuchern Arbeitsalltag und Mythen ferner Jahrhunderte näher bringen. Schauspieler imitieren den Berggeist oder lassen das Gebet der Kumpel an ihre Schutzpatronin, die heilige Barbara ertönen. Man hört Kanarienvögel zwitschern.
Zygmunt Koloch drückt ab und zu einen Schalter. Tonträger sollen den Besuchern Arbeitsalltag und Mythen ferner Jahrhunderte näher bringen. Schauspieler imitieren den Berggeist oder lassen das Gebet der Kumpel an ihre Schutzpatronin, die heilige Barbara ertönen. Man hört Kanarienvögel zwitschern.
"Kanarienvögel, gab's nun seinen Grund. Und Sauerstoffmangel ist da gekommen. Der Mensch hat schon Schwierigkeiten zu atmen, um da zu wissen, wann muss man am schnellsten von der Stelle wegkommen, denn er wollte ja bis zum Längsten dabei sein bei dem Abbau, schnappt der den Kanarienvogel, der zehnfach schwächer als der Mensch war. Und mit ihnen zusammen an eine Stelle, wo es bessere Lüftung gab, um da sich wieder aufzubauen. Deswegen, Kanarien wurden gezüchtet von Bergleuten, um die da also als Messgerät dabeizuhaben."
Das Stadtzentrum von Tarnowitz liegt ein paar Kilometer vom Bergbaumuseum entfernt.
Durch den einst von Bergbaubetreibern angelegten, heute etwas verwilderten Stadtpark führt der Weg zu einer weiteren Sehenswürdigkeit unter Tage. Mitten im Gehölz steht eine Felssteinrotunde.
Durch den einst von Bergbaubetreibern angelegten, heute etwas verwilderten Stadtpark führt der Weg zu einer weiteren Sehenswürdigkeit unter Tage. Mitten im Gehölz steht eine Felssteinrotunde.
Es ist der Eingang zum alten Entwässerungsstollen mit dem Namen "Schwarze Forelle". Die "Schwarze Forelle" heißt so, weil im Wasser des unterirdischen Kanals einst Fische aus den umliegenden Flüssen schwammen. Doch sie sind wegen der Verschmutzung der umliegenden Gewässer längst verschwunden. Eine enge Wendeltreppe bringt uns hinab zur Bootsanlegestelle.
"Wir befinden uns jetzt zwanzig Meter da unten, tief. Und wir fahren jetzt von dem Ewa-Schacht zum Silvester-Schacht."
600 Meter durch die "Schwarze Forelle"
Katarzyna Magligówka, Touristenführerin. 600 Meter misst der Weg durch die "Schwarze Forelle", die den Ewa-Schacht mit dem Silvester-Schacht verbindet. Es ist der für Besucher geöffnete Abschnitt eines Entwässerungslabyrinths von insgesamt einhundertfünfzig Kilometern.
Der Bootsführer steht mit dem Rücken zum Bug. Sein Gesicht wendet er den Passagieren zu, mit kräftigen Händen stößt er sich an den Seitenmauern ab, so dass der Kahn durch den Stollen gleitet. Bis zu 700 Pferde habe man, sagt der Bootsführer, im 16. Jahrhundert benötigt, um die große Kette der Wasserbehälter in Bewegung zu halten, die wie ein Paternoster hinauf- und hinab fuhren. Mit der Kraft von diesen 700 Pferden habe man das überschüssige Wasser aus der Grube nach oben gezogen. Damals seien mehr Bergleute mit der Entwässerung der mit Grundwasser volllaufenden Stollen beschäftigt gewesen, als mit Abbau des Erzes. Erst mit dem Einsatz der Dampfmaschinen kehrten sich die Verhältnisse um. Doch davon erzählt der Bootsführer nicht mehr, denn der Kahn hat nach knapp einer halben Stunde den Silvester-Schacht erreicht.
Mit einem polnischen "Glückauf", dem Bergmannsgruß, verabschiedet er sich. Wieder über eine Wendeltreppe klettern wir hinauf in den Park.
Die Dampfmaschine, die das Industriezeitalter in Oberschlesien einläutete, war ein Erzeugnis der britischen Firma "Boulton und Watt". 1788 nahm sie als eine der ersten ihrer Art auf dem Kontinent den Betrieb auf – in Tarnowitz. Sie entwässerte im Nu die gerade wieder einmal vollgelaufenen Gruben und machte auf einen Schlag 700 Pferde samt Betreuer arbeitslos. Das war damals eine Nachricht, die Kreise zog und schließlich auch nach Weimar gelangte. Dort suchte der Herzog von Sachsen-Weimar nach einer Möglichkeit, die Silbergruben von Ilmenau besser auszubeuten. Also schickte der Herzog seinen geheimen Rat und Minister Johann Wolfgang von Goethe ins sechshundert Kilometer östlich gelegene, damals zu Preußen gehörende Tarnowitz. Goethe kam 1790 und stieg in einem Gasthaus nahe dem Markplatz ab:
"Wir befinden uns vor einem Gebäude, wo früher Johann Wolfgang von Goethe lebte, der berühmte Dichter. Jetzt ist das ein Restaurant, auf polnisch 'Kałamarz'."
Auf Deutsch "Tintenfass":
Im historischen Gasthaus stehen Rindsrouladen und andere schlesische Spezialitäten auf der Speisekarte. An den berühmten Logiergast von 1790 erinnern Bilder und Dokumente, darunter eine Abschrift jenes Epigramms, das der Dichter an die "Bürger von Tarnowitz" richtete und mit denen er ihnen nicht unbedingt schmeichelte.
"Fern von gebildeten Menschen am Ende des Reiches,
Wer hilft euch, Schätze zu finden und sie glücklich zu bringen ans Licht..."
Wer hilft euch, Schätze zu finden und sie glücklich zu bringen ans Licht..."
Goethe in Tarnowitz
Um Goethe in Tarnowitz kümmerte sich damals Berghauptmann Friedrich Wilhelm von Reden, ein Vorreiter der Industrialisierung in Oberschlesien. Es war Reden gewesen, der 1787 zum Einkauf der Dampfmaschine eigens nach England gefahren war. Zu dieser Zeit lag der einst blühende Bergbau in Oberschlesien darnieder. Wenige Jahrzehnte zuvor hatte Preußenkönig Friedrich II. das von Krankheiten und Kriegen verwüstete Land den Österreichern entrissen. Nun wollten die Preußen investieren.
"Friedrich der Große schickte seine Leute zu uns, um da wieder Industrie zu wecken. und wir sehen da Graf Reden, der hier auch gekommen ist."
Graf Reden ist ein historischer Held, den man immer mal wieder vom Sockel stieß. 1852, zu seinem 100. Geburtstag, weihten ihm die Preußen ein Denkmal auf dem Redenberg in Königshütte. 1922 kam Oberschlesien zu Polen. Die Polen bauten das Denkmal ab. Die Deutschen bauten es nach dem Überfall Hitlers auf Polen 1939 wieder auf. Im kommunistischen Polen verschwand das Reden-Denkmal erneut.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat man Reden dann in Chorzów, ehemals Königshütte, ein neues Denkmal gewidmet. Durch die Ehrung eines Deutschen demonstriert Oberschlesien sein Selbstbewusstsein gegenüber dem zentralistischen polnischen Staat. Viele Bewohner wollen mehr wirtschaftliche und politische Autonomie im Verhältnis zu Warschau und begründen es mit dem besonderen Erbe Oberschlesiens. Die Geschichte ihrer Region sei eben eine besondere, geprägt vom Bergbau und von einem Schmelztiegel der Kulturen – deutsch, polnisch, tschechisch.
Ausdruck des ethnischen Miteinanders war und ist der schlesische Dialekt, den viele als eigene Sprache betrachten. Der Touristenführer Zygmunt Koloch freut sich darüber, dass das lange verpönte Schlesisch wieder gepflegt wird, in der Öffentlichkeit, im lokalen Radio. Dieser Dialekt ist dem Polnischen eng verwandt, aber mit vielen deutschen und tschechischen Ausdrücken durchsetzt.
"Schlesisch ist ja ein bisschen anders. Wenn ich sage: Wo hast du die Fusekle, weiß der Deutsche kaum etwas davon, der Pole auch. Da muss man ihnen erklären, dass um Socken es sich handelt. Fusekle. Also sind ja viele Wörter. Man sagt ja Hosen, die Polen sagen: Das sind spodnie und der Schlesier sagt, das sind galoty. Der Tscheche weiß ja, was das ist. Und damalig auch ein Steiger, der musste drei Sprachen kennen lernen: Deutsch, Tschechisch und Polnisch – also Schlesisch."
Eine Hälfte Schlesier, die andere beschreibt sich als Schlesier und Polen zugleich
Es geht nicht nur um einen Dialekt: Bald eine Million Menschen haben sich bei der letzten Volkszählung 2011 zur schlesischen Nationalität bekannt, etwa die Hälfte ausschließlich. Die andere Hälfte beschrieb sich als Schlesier und Polen zugleich. Dagegen wetterten nationalpolnisch orientierte Politiker aller Couleur. Dann fällte das oberste polnische Gericht vor einigen Monaten sein Urteil: die Schlesier seien keine eigene Nation. Daraufhin erhob sich in Oberschlesien ein Sturm des Protests – besonders unter den Mitgliedern und Anhängern der RAŚ, der Bewegung für schlesische Autonomie. RAŚ tritt als regionale politische Partei auf und will den postindustriellen Wandel im Revier durch mehr regionale Rechte bewältigen. Dabei geht es neben Wirtschaft und Politik auch um die Pflege der multikulturellen schlesischen Industriegeschichte.
"Also Industrietourismus wird immer wichtiger, wir haben diese Route der Industriekultur, die eigentlich dem Beispiel einer ähnlichen Route im Ruhrgebiet folgt. Und letztes Jahr hatten wir in diesen Objekten, die sich auf dieser Route befinden, über 500.000 Besucher."
Jerzy Gorzelik, Kunsthistoriker von Beruf und einer der Anführer der Bewegung für schlesische Autonomie RAŚ mit Sitz in Kattowitz.
"Natürlich wird der Industrietourismus nicht zum Hauptzweig der oberschlesischen Wirtschaft. Das ist unmöglich. Aber das ist sehr wichtig für das Antlitz der Region. Also, das ist wichtig für die Leute, die hier wohnen. Die sehen diese positive Energie, die vorhanden ist, und die man verwenden kann, um das Leben hier in Oberschlesien neu zu gestalten."
Das Industriezeitalter trotz aller sozialen Probleme als multikulturelle Erfolgsstory zu präsentieren, das war der Grundgedanke einer neuen Dauerausstellung zur schlesischen Geschichte. Sie soll bald im bereits fertigen Neubau des Schlesischen Museums in Kattowitz zu sehen sein. Das neue Schlesische Museum liegt zum großen Teil unter der Erde und nutzt auch Teile der stillgelegten Steinkohlenzeche Kattowitz.
Umstrittene Dauerausstellung
Die Dauerausstellung ist allerdings heftig umstritten. Am Beginn sollte ursprünglich eine Reproduktion der in Tarnowitz irgendwann verloren gegangenen ersten Dampfmaschine von "Boulton und Watt" stehen. Dazu wollte man Goethes Besuch von 1790 dokumentieren. Doch das, fanden einige Politiker, war zuviel deutsche Kultur und zuwenig polnischer Kampf gegen Deutschland. Der Streit wurde so heftig, dass am Ende sogar der Kopf des verantwortlichen Direktors des Schlesischen Museums rollte. Der entlassene Direktor leitet inzwischen ein Museum im benachbarten Tschechien. Das multikulturelle Konzept für die Dauerausstellung im Schlesischen Museum werden dort in Kattowitz seine Nachfolger verändern. Es soll mehr polnische Nationalgeschichte geben.
Szenenwechsel: Zabrze, rund 20 Kilometer westlich von Katowice, der Wojewodschaftshauptstadt, und ebenso weit südlich von Tarnowskie Góry oder Tarnowitz, bildet ein Zentrum des Steinkohlereviers - eine Stadt mit knapp 200.000 Einwohnern, ausgefahrenes Straßenpflaster. Die Fassaden der Arbeitermietskasernen aus der wilhelminischen Ära dominieren das Stadtbild. Zwischen 1915 und 1945 trug die Stadt den Namen Hindenburg. 1945 kam sie zur polnischen Volksrepublik. In Zabrze wird immer noch Steinkohle gefördert, Polens nach wie vor wichtigster Energieträger. Mitten in der Stadt ragt der blaue Förderturm der seit langem stillgelegten Steinkohlenzeche Guido empor. 1855 gegründet, trägt die Zeche bis heute den Namen des Industriemagnaten Guido Henckel von Donnersmarck, der einst zu den reichsten Männern im deutschen Kaiserreich gehörte. Die Zeche Guido steht seit 2007 für Besucher offen:
"Der Industrietourismus kommt gut an. Der Besucher braucht etwas Ungewöhnliches, etwas, was er nirgendwo anders zu sehen bekommt. Gleich zur Begrüßung gibt es bei uns eine Fahrt mit dem alten Originalaufzug dreihundert Meter unter die Erde. Branchenleuten dürfte das am Allerwertesten vorbeigehen, aber für ihre Familien, die noch nie da unten waren, ist das eine Attraktion - hier die helle Sonne, da die dunkle Hölle."
Leszek Żurek fungiert als technischer Direktor der Museumszeche Guido. Einst arbeiteten in Zabrze über 80 Prozent der Männer im Bergbau – heute, so schätzt man, etwa noch ein Drittel. Viele Zechen wurden nach der Wende zusammengelegt oder geschlossen. Auch deshalb verknüpfen sich so viele Hoffnungen mit dem Ausbau des Bergbautourismus. Bald soll in Zabrze sogar eine Art Untergrundbahn durch mehrere Kilometer Stollen fahren – direkt zum Hotel Ibis in der Nähe des Hauptbahnhofs.
25 Kilometer östlich von Zabrze liegt Nikiszowiec, heute ein Vorort der Wojewodschaftshauptstadt Katowice. Nikiszowiec gehörte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen. Seit einigen Jahren steht die Arbeitersiedlung unter Denkmalschutz und findet international Beachtung. Neun Wohnblöcke aus rotem Ziegel, mal drei-, mal vier-, mal fünfeckig, ausgestattet mit weitläufigen Innenhöfen. Dazu gehören soziale Einrichtungen, Schulen, eine Gemeinschaftsbäckerei und eine mächtige, im neobarocken Stil errichtete Backsteinkirche. Die Siedlung hatten die Berlin-Charlottenburger Architekten Emil und Georg Zillmann kurz vor dem Ersten Weltkrieg geplant – im Auftrag des Bergbaukonzerns "Georg von Giesches Erben", der für die Arbeiter und Angestellten seiner Kohlenzeche Wohnraum benötigte. Die Zeche und damit auch die Siedlung hießen Nikischschacht. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es auch hier polnisch-deutsche Grenzkämpfe. Nikischschacht wurde polnisch und hieß fortan Nikiszowiec, im Zweiten Weltkrieg wurde es wieder deutsch, 1945 abermals polnisch. Die Häuser überstanden Weltkriege und Staatswechsel weitgehend unversehrt. Heute bemüht man sich um die Aufnahme in das Welterbe der UNESCO.
Auf dem Marktplatz glaubt man sich 100 Jahre zurückversetzt
Im Vergleich zu vielen anderen Siedlungen kümmert man sich hier um die originalgetreue Erhaltung der Gebäude. Man sorgt dafür, dass die Holztüren zum Treppenhaus erneuert und nicht ausgewechselt werden, ebenso bei den Fenstern. Wenn man auf dem Marktplatz steht, glaubt man doch, einhundert Jahre zurückversetzt zu werden.
Waldemar Jan gehört einer Bürgerinitiative für Nikiszowiec an. Wie es früher in den Wohnungen von Nikiszowiec aussah, kann man in einem kleinen Museum betrachten. Man kann aber auch ältere Bewohner fragen, etwa Gabriela Szymkowiak, geborene Schmidt:
Damals gab es in den Höfen keine Spielplätze, sondern Ställe und Schuppen, auch Backstuben. Jeder hatte seinen Schuppen, seine Kammer. Die einen lagerten dort Kohle, die anderen hielten Tauben, Kaninchen oder sogar Schweine. Die Erwachsenen nahmen einen Sessel aus der Wohnung mit und setzten sich vors Haus. Die Männer spielten oft auf einem Musikinstrument, die Frauen strickten. Die Türen standen offen. Die Kinder konnten in ihrem Aufgang in jede Wohnung hinein. Die Nachbarn gehörten zur Familie. Wer gerade am Fenster stand, passte auf die Kinder im Hof auf. Unsere Nachbarinnen durften mir einen Klaps geben, ohne dass meine Mutter böse war.
Seit Ende des Ersten Weltkriegs bekannten sich die Menschen im oberschlesischen Nikiszowiec überwiegend zum nun als Staat wiedererstandenen Polen. Dennoch, die Nationalität sei im Alltag immer zweitrangig gewesen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt Gabriela Szymkowiak, geborene Schmidt.
"Nicht genug, dass ich von Hause aus Schmidt heiße, mein Vater war auch bei der Wehrmacht, und zwar zweimal, unfreiwillig. Aber so etwas war bei uns nach dem Krieg kein Thema. Unter Bergleuten war jeder mit jedem befreundet."
"Woanders zu wohnen kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das hier ist mein Platz auf der Erde."
Zwischen Nikiszowiec, dem benachbarten Giszowiec und einigen Kohlegruben verkehrte einst über zwanzig Mal am Tag eine Schmalspurbahn, mit der die Betriebsangehörigen umsonst fuhren. Ironisch anspielend auf den Luxuszug Berlin-Konstantinopel hieß er im Volksmund Balkan-Express. Auch heute heißt er noch so, auch wenn nur noch Güterzüge auf einem kleinen Streckenabschnitt verkehren.
Gleich neben den Bahngleisen betreibt Grzegorz Rykaczewski seinen Trödelladen. Bei ihm findet man so ziemlich alles: Kinderwagen aus schlesischer Produktion vor dem Zweiten Weltkrieg, alte Radioapparate und Möbel, Fahrräder, Geschirr und Bilder - von Stalin, Gomułka, auch von deutschen Diktatoren. Rykaczewski ist in Nikiszowiec, wo jeder jeden kennt, ein bunter Hund - mit Federhut und Kleidungsstücken, die wie ein Theaterkostüm wirken. Bevor er mit Antiquitäten handelte, hat auch er lange unter Tage geschuftet. Doch das ist vorbei. Heute verkörpert Rykaczewski wie kaum einer in Nikiszowiec den Wandel von der Schwerindustrie zum Tourismusgewerbe.
"Ich besitze schon zwei original indische Fahrradrikschas. Mit denen werde ich Gäste über den Markt fahren. Mit den Rikschas kann man auch Photos machen, für Hochzeiten - oder auch Filmaufnahmen. Diese Rikszas werden für das Leben in unserem schönen Nikiszowiec etwas Neues bringen."
Aus dem hart arbeitenden Bergmann ist ein geschäftsinniger Freak geworden, und er hat sich dabei selbst verwirklichen können. Ein geflügeltes Wort unter Oberschlesiern lautet: Besser eine Tüte Geschäft, als ein Sack Arbeit.