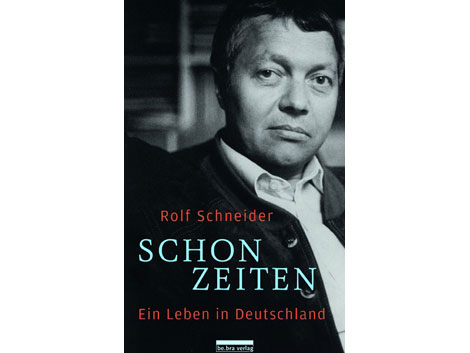"'Die Schonzeit bezeichnet den Zeitraum, in dem Fang und Tötung von Wild durch das Jagdgesetz verboten sind. Für Tiere, die nicht dem Jagdgesetz unterstellt sind, gibt es keine Schonzeiten.' Ich fand, damit wird die Situation in der DDR ganz allgemein und meine besonders ganz gut umschrieben."
Denn Rolf Schneider war Schriftsteller in der Deutschen Demokratischen Republik, einem Staat, der seinen Literaten allzeit ganz besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte:
(…)Die SED fürchtete, Dichter seien begabt, durch ihr Wort Revolten auszulösen, weshalb sie es streng kontrollierten.
Schreibt Schneider in seinen jetzt erschienen Erinnerungen, auf die der Begriff Autobiografie indes nur schwer anwendbar ist: Dem Buch fehlt ein streng chronologischer Aufbau, es ist vielmehr auf eine reizvolle Weise sprunghaft – eine Zeitreise, auf der wir Ereignissen, Orten und Menschen begegnen, die das mittlerweile 71-jährige Leben des Autors geprägt haben.
Allein das Register intellektueller Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegszeit, die Schneiders Wege kreuzten, beeindruckt: unter vielen anderen waren es Anna Seghers, Peter Huchel, Martin Gregor-Dellin, Golo Mann, Hans Mayer – und Professor Victor Klemperer, der den jungen Studenten Schneider an der Halleschen Universität in den 50er-Jahren für die französische Literatur begeisterte:
Ein wenig erinnerte er, in Statur und Gesichtsschnitt, an den Maler Pablo Picasso. Er verbeugte sich, gewissermaßen seitlich, die rechte Schulter nachdrücklicher in die Verneigung einbeziehend als die linke, gegen den Studentenapplaus, lächelte und begann mit der Vorbereitung zu seinem Kolleg.
Zwei Seiten später erfahren wir die Ursache der eigentümlichen Verneigung Klemperers: Die Nazis hatten dem jüdischen Professor mit einer Eisenstange eine Schulter zertrümmert. Eine sehr typische Passage für Schneiders Technik, scheinbar belanglose Kleinigkeiten und Beobachtungen mit der allzu oft unseligen deutschen Geschichte zu verbinden.
Als Redakteur der kulturpolitischen Zeitschrift "Aufbau", die im gleichnamigen Verlag erschien, beteiligte sich Schneider 1956 an den hausinternen intellektuell-oppositionellen Debatten im Umfeld des Ungarn-Aufstands.
Anschließend fuhr ich mit einem Bekannten aus dem Verlag eine gemeinsame Strecke in der S-Bahn. Der Mann war älter als ich, er hatte seine Erfahrungen. Mit trübem Lächeln blickte er mich an, als er sagte: "Und S i e haben das Programm formuliert." Mir war, als berührte mich eine eisige Hand.
Doch anders als der Verlagsleiter Walter Janka, der mitsamt dem Lektoren und marxistischen Philosophen Wolfgang Harich zwei Tage später verhaftet wurde, entging Schneider einer Festnahme - durch den Umstand, dass die Stasi beim Durchkämmen des Verlagshauses nach drei Etagen glaubte, genug Belastungsmaterial gefunden zu haben.
Mein Arbeitsplatz befand sich im vierten Stockwerk.
Schonzeit für Schneider also. Trotzdem kollidierte er – ab 1958 freier Autor – in den folgenden Jahrzehnten immer wieder mit der DDR-Kulturbürokratie und ihren wechselnden Dogmen.
Eine der Nischen, in die flüchten konnte, wer dem ästhetischen Dogmatismus entgehen wollte, blieb die Kinderliteratur. Für sie fühlte ich mich ungeeignet. Eine andere Nische war der Rückgriff auf Geschichtliches. Ihn bevorzugte ich. Er bot die Gelegenheit zu heimlichen Parallelen. Parabeln waren eine Möglichkeit, sich zur DDR zu verhalten, ohne lügen zu müssen. Insgesamt führte dergleichen, nicht nur in meinem Falle, zu einem manieristischen Versteck- und Maskenspiel, getreu dem Karl-Kraus-Ausspruch, ein Satz, den der Zensor verstehe, werde zu Recht verboten.
Ein frankophiler Kosmopolit in der eingemauerten DDR – konnte das überhaupt auf Dauer gut gehen?
"Es ging insofern gut, als es eine relativ lebendige Romanistik an den Universitäten gab, und Frankreich damals ein Land mit einer sehr starken kommunistischen Partei war, die so lange akzeptiert und als brüderlich empfunden wurde, solange sie sich nicht zum Eurokommunismus bekannte. Das war aber erst ab Mitte der 80er-Jahre, da war ich eh' ein Dissident."
Wie allen anderen Mitunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns verzieh die Partei auch Rolf Schneider diesen Akt des Opponierens nie, zumal er mit "November" auch noch im Westen ein beklemmendes Buch über die bleierne Zeit veröffentlichte, die der Ausbürgerung Biermanns folgte. 1979 wurde Schneider zusammen mit anderen renitenten Kollegen aus dem Schriftstellerverband der DDR geworfen.
"Es war zunächst gedacht und hat auch so funktioniert als psychische Demütigung. Es war natürlich auch verbunden mit einer Menge von materiellen Nachteilen, ich hatte fortan Einkünfte, die ein Fünftel meiner früheren Einkünfte in der DDR betrugen und mich dazu zwangen, mich anderswo, nämlich jenseits der Grenzen, als Geldverdiener zu betätigen."
In den 80er-Jahren lebte und arbeitete Schneider als DDR-Bürger mit Dauervisum hauptsächlich in der Bundesrepublik – ein Konstrukt, das die SED für aufmüpfige Intellektuelle ersonnen hatte, um nicht nochmals Proteste wie bei Biermanns Ausbürgerung zu provozieren. Schneider hinwiederum hielt an seiner DDR-Staatsbürgerschaft fest – aus familiären Gründen, aber auch, weil er der Partei den Triumph nicht gönnen mochte, ihn endgültig losgeworden zu sein.
In "Schonzeiten" nimmt er den Leser auch auf zahlreiche Reisen in die ihm nun offen stehende Welt mit und beweist – ähnlich wie sein ebenfalls in den Westen emigrierter Kollege Günter Kunert – gerade bei diesen atmosphärisch dichten Skizzen besonderes literarisches Talent. Mitunter aber fragt man sich bei der durchaus kurzweiligen Lektüre, welchen Leserkreis der Autor bei der Niederschrift seiner Erinnerungen eigentlich anpeilte. Mal vertraut Schneider auf vorhandenes Hintergrundwissen seiner Leser über die Geschichte der DDR und ihres Literaturbetriebes, um dann etwas später bei der Charakterisierung des allbekannten Marcel Reich Ranicki in Allgemeinplätze zu verfallen, die allenfalls für Leser auf einem entfernten Planeten noch eine Novität sein dürften.
Die stärksten Passagen in Schneiders Erinnerungen sind die, die jenes besondere Gefühl von Zerrissenheit wieder lebendig werden lassen, das so nur in einem geteilten Land und der geteilten Stadt Berlin existieren konnte. Etwa, wenn der Autor – mit Visum auf dem Weg zum Grenzübergang Friedrichstraße - in der Ost-Berliner S-Bahn die verkniffenen Gesichtszüge eines Reisenden mustert und über die Gründe für dessen Misanthropie rätselt. Wenig später steht Schneider auf der Aussichtsplattform an der Mauer und blickt von dort hinüber in den Ostsektor:
Ich drehte den Kopf und schaute hinab auf den Thälmannplatz. Eine einsame Straßenbahn umrundete ihn, bis nahe an die Grenze fuhr sie heran, (…) ich konnte Gesichter der Passagiere erkennen, und so sah ich ein Gesicht, das ich kannte und wiedererkannte, (…) ein graues, ein mürrisches Gesicht, Falten der Verkniffenheit neben den Mundwinkeln. Kein Irrtum war möglich: Dort unten fuhr der Mann, mit dem ich eben noch, keine Stunde war darüber vergangen, im selben Stadtbahn-Abteil gesessen hatte. Ich hätte ihm zuwinken können. Ich unterließ es. Ich glaubte zu wissen, welcher Missmut diesen Mann befallen hatte, woran er litt, sein Leiden ergriff über diese sonderbare Entfernung hinweg auch mich, in einem Gefühl unbegreiflicher Schuld sah ich zu, wie die Straßenbahn weiter- und davonfuhr...
Rolf Schneider: "Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland".
Bebra Verlag, 316 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-898-09102-2
Denn Rolf Schneider war Schriftsteller in der Deutschen Demokratischen Republik, einem Staat, der seinen Literaten allzeit ganz besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte:
(…)Die SED fürchtete, Dichter seien begabt, durch ihr Wort Revolten auszulösen, weshalb sie es streng kontrollierten.
Schreibt Schneider in seinen jetzt erschienen Erinnerungen, auf die der Begriff Autobiografie indes nur schwer anwendbar ist: Dem Buch fehlt ein streng chronologischer Aufbau, es ist vielmehr auf eine reizvolle Weise sprunghaft – eine Zeitreise, auf der wir Ereignissen, Orten und Menschen begegnen, die das mittlerweile 71-jährige Leben des Autors geprägt haben.
Allein das Register intellektueller Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegszeit, die Schneiders Wege kreuzten, beeindruckt: unter vielen anderen waren es Anna Seghers, Peter Huchel, Martin Gregor-Dellin, Golo Mann, Hans Mayer – und Professor Victor Klemperer, der den jungen Studenten Schneider an der Halleschen Universität in den 50er-Jahren für die französische Literatur begeisterte:
Ein wenig erinnerte er, in Statur und Gesichtsschnitt, an den Maler Pablo Picasso. Er verbeugte sich, gewissermaßen seitlich, die rechte Schulter nachdrücklicher in die Verneigung einbeziehend als die linke, gegen den Studentenapplaus, lächelte und begann mit der Vorbereitung zu seinem Kolleg.
Zwei Seiten später erfahren wir die Ursache der eigentümlichen Verneigung Klemperers: Die Nazis hatten dem jüdischen Professor mit einer Eisenstange eine Schulter zertrümmert. Eine sehr typische Passage für Schneiders Technik, scheinbar belanglose Kleinigkeiten und Beobachtungen mit der allzu oft unseligen deutschen Geschichte zu verbinden.
Als Redakteur der kulturpolitischen Zeitschrift "Aufbau", die im gleichnamigen Verlag erschien, beteiligte sich Schneider 1956 an den hausinternen intellektuell-oppositionellen Debatten im Umfeld des Ungarn-Aufstands.
Anschließend fuhr ich mit einem Bekannten aus dem Verlag eine gemeinsame Strecke in der S-Bahn. Der Mann war älter als ich, er hatte seine Erfahrungen. Mit trübem Lächeln blickte er mich an, als er sagte: "Und S i e haben das Programm formuliert." Mir war, als berührte mich eine eisige Hand.
Doch anders als der Verlagsleiter Walter Janka, der mitsamt dem Lektoren und marxistischen Philosophen Wolfgang Harich zwei Tage später verhaftet wurde, entging Schneider einer Festnahme - durch den Umstand, dass die Stasi beim Durchkämmen des Verlagshauses nach drei Etagen glaubte, genug Belastungsmaterial gefunden zu haben.
Mein Arbeitsplatz befand sich im vierten Stockwerk.
Schonzeit für Schneider also. Trotzdem kollidierte er – ab 1958 freier Autor – in den folgenden Jahrzehnten immer wieder mit der DDR-Kulturbürokratie und ihren wechselnden Dogmen.
Eine der Nischen, in die flüchten konnte, wer dem ästhetischen Dogmatismus entgehen wollte, blieb die Kinderliteratur. Für sie fühlte ich mich ungeeignet. Eine andere Nische war der Rückgriff auf Geschichtliches. Ihn bevorzugte ich. Er bot die Gelegenheit zu heimlichen Parallelen. Parabeln waren eine Möglichkeit, sich zur DDR zu verhalten, ohne lügen zu müssen. Insgesamt führte dergleichen, nicht nur in meinem Falle, zu einem manieristischen Versteck- und Maskenspiel, getreu dem Karl-Kraus-Ausspruch, ein Satz, den der Zensor verstehe, werde zu Recht verboten.
Ein frankophiler Kosmopolit in der eingemauerten DDR – konnte das überhaupt auf Dauer gut gehen?
"Es ging insofern gut, als es eine relativ lebendige Romanistik an den Universitäten gab, und Frankreich damals ein Land mit einer sehr starken kommunistischen Partei war, die so lange akzeptiert und als brüderlich empfunden wurde, solange sie sich nicht zum Eurokommunismus bekannte. Das war aber erst ab Mitte der 80er-Jahre, da war ich eh' ein Dissident."
Wie allen anderen Mitunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns verzieh die Partei auch Rolf Schneider diesen Akt des Opponierens nie, zumal er mit "November" auch noch im Westen ein beklemmendes Buch über die bleierne Zeit veröffentlichte, die der Ausbürgerung Biermanns folgte. 1979 wurde Schneider zusammen mit anderen renitenten Kollegen aus dem Schriftstellerverband der DDR geworfen.
"Es war zunächst gedacht und hat auch so funktioniert als psychische Demütigung. Es war natürlich auch verbunden mit einer Menge von materiellen Nachteilen, ich hatte fortan Einkünfte, die ein Fünftel meiner früheren Einkünfte in der DDR betrugen und mich dazu zwangen, mich anderswo, nämlich jenseits der Grenzen, als Geldverdiener zu betätigen."
In den 80er-Jahren lebte und arbeitete Schneider als DDR-Bürger mit Dauervisum hauptsächlich in der Bundesrepublik – ein Konstrukt, das die SED für aufmüpfige Intellektuelle ersonnen hatte, um nicht nochmals Proteste wie bei Biermanns Ausbürgerung zu provozieren. Schneider hinwiederum hielt an seiner DDR-Staatsbürgerschaft fest – aus familiären Gründen, aber auch, weil er der Partei den Triumph nicht gönnen mochte, ihn endgültig losgeworden zu sein.
In "Schonzeiten" nimmt er den Leser auch auf zahlreiche Reisen in die ihm nun offen stehende Welt mit und beweist – ähnlich wie sein ebenfalls in den Westen emigrierter Kollege Günter Kunert – gerade bei diesen atmosphärisch dichten Skizzen besonderes literarisches Talent. Mitunter aber fragt man sich bei der durchaus kurzweiligen Lektüre, welchen Leserkreis der Autor bei der Niederschrift seiner Erinnerungen eigentlich anpeilte. Mal vertraut Schneider auf vorhandenes Hintergrundwissen seiner Leser über die Geschichte der DDR und ihres Literaturbetriebes, um dann etwas später bei der Charakterisierung des allbekannten Marcel Reich Ranicki in Allgemeinplätze zu verfallen, die allenfalls für Leser auf einem entfernten Planeten noch eine Novität sein dürften.
Die stärksten Passagen in Schneiders Erinnerungen sind die, die jenes besondere Gefühl von Zerrissenheit wieder lebendig werden lassen, das so nur in einem geteilten Land und der geteilten Stadt Berlin existieren konnte. Etwa, wenn der Autor – mit Visum auf dem Weg zum Grenzübergang Friedrichstraße - in der Ost-Berliner S-Bahn die verkniffenen Gesichtszüge eines Reisenden mustert und über die Gründe für dessen Misanthropie rätselt. Wenig später steht Schneider auf der Aussichtsplattform an der Mauer und blickt von dort hinüber in den Ostsektor:
Ich drehte den Kopf und schaute hinab auf den Thälmannplatz. Eine einsame Straßenbahn umrundete ihn, bis nahe an die Grenze fuhr sie heran, (…) ich konnte Gesichter der Passagiere erkennen, und so sah ich ein Gesicht, das ich kannte und wiedererkannte, (…) ein graues, ein mürrisches Gesicht, Falten der Verkniffenheit neben den Mundwinkeln. Kein Irrtum war möglich: Dort unten fuhr der Mann, mit dem ich eben noch, keine Stunde war darüber vergangen, im selben Stadtbahn-Abteil gesessen hatte. Ich hätte ihm zuwinken können. Ich unterließ es. Ich glaubte zu wissen, welcher Missmut diesen Mann befallen hatte, woran er litt, sein Leiden ergriff über diese sonderbare Entfernung hinweg auch mich, in einem Gefühl unbegreiflicher Schuld sah ich zu, wie die Straßenbahn weiter- und davonfuhr...
Rolf Schneider: "Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland".
Bebra Verlag, 316 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-898-09102-2