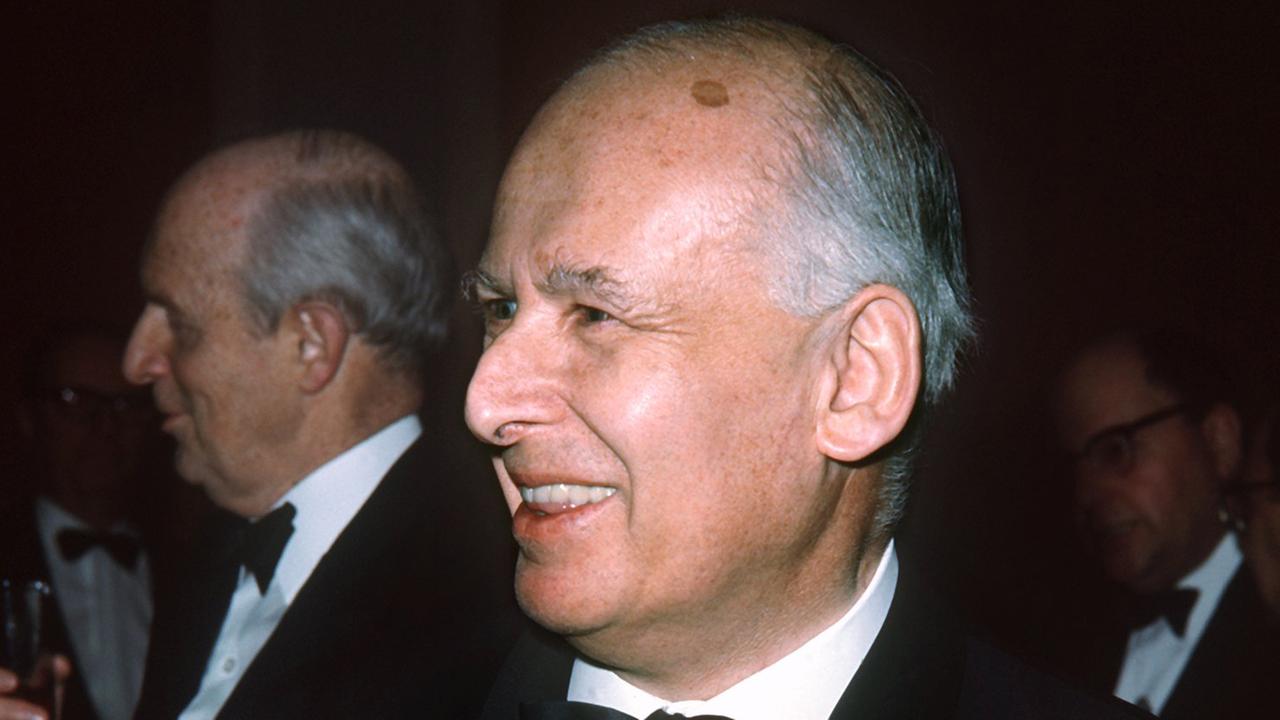Rüdiger Achenbach: Herr Ginzel, nachdem nun in den 1950er-Jahren viele Juden aus der DDR geflohen waren, was bedeutete denn das für das jüdische Leben im Land?
Günther Ginzel: Die DDR ist zuerst einmal ein Museum geworden, nämlich das Museum des deutschen Judentums. Das heißt, alles das, was im Westen, in der Bundesrepublik, untergegangen ist, weil das deutsche Judentum vertrieben oder vernichtet war – die alten Melodien, die alte Aussprache des Hebräischen, die war hier im Westen praktisch verschwunden – in der DDR nicht. Auf diese Art und Weise hat sich hier dieses deutsch-jüdische Element in dieser kleinen Zahl erhalten können, gefördert auch von der DDR.
Günther Ginzel: Die DDR ist zuerst einmal ein Museum geworden, nämlich das Museum des deutschen Judentums. Das heißt, alles das, was im Westen, in der Bundesrepublik, untergegangen ist, weil das deutsche Judentum vertrieben oder vernichtet war – die alten Melodien, die alte Aussprache des Hebräischen, die war hier im Westen praktisch verschwunden – in der DDR nicht. Auf diese Art und Weise hat sich hier dieses deutsch-jüdische Element in dieser kleinen Zahl erhalten können, gefördert auch von der DDR.
Für mich war es zum Beispiel faszinierend, wenn ich in der DDR war, in Ost-Berlin, Leipzig oder Dresden einen Gottesdienst besuchte, sprachen sie mit ihren O- und AU-Tönen des Hebräischen ganz anders als das sephardische Hebräisch in Israel, so wie meine Mutter hebräisch gesprochen hat. Und es waren die alten Lewandowski Melodien. Man hatte Chöre.
Achenbach: Die Tradition aus dem liberalen Judentum.
Ginzel: Alle Gemeinden waren liberal, hatten Chöre, die überwiegend aus Nicht-Juden bestanden, etwa der Leipziger Synagogalchor ist sehr berühmt geworden, der sich aber auf wunderbare Art und Weise diese synagogale Musik erarbeitet hatte. Es waren herrliche Gottesdienste, wie ich sie dort erlebte. Gottesdienste allerdings, die einen unendlich traurig gemacht haben, weil man natürlich begriff, dies ist ein Museum und es gibt ein paar ausgestellte lebende Exemplare.
Achenbach: Die Tradition aus dem liberalen Judentum.
Ginzel: Alle Gemeinden waren liberal, hatten Chöre, die überwiegend aus Nicht-Juden bestanden, etwa der Leipziger Synagogalchor ist sehr berühmt geworden, der sich aber auf wunderbare Art und Weise diese synagogale Musik erarbeitet hatte. Es waren herrliche Gottesdienste, wie ich sie dort erlebte. Gottesdienste allerdings, die einen unendlich traurig gemacht haben, weil man natürlich begriff, dies ist ein Museum und es gibt ein paar ausgestellte lebende Exemplare.
"Das Jüdische gehörte in der DDR dazu"
Achenbach: Und es gab wahrscheinlich auch keinen Nachwuchs.
Ginzel: Es gab keinen Nachwuchs. In Leipzig bestand die ganze Jugend aus drei jungen Männern, Brüder einer einzigen Familie. Das hat mich immer wieder ergriffen. Gerade Leipzig war so ein schönes Beispiel: Alte, kranke Männer, zum Teil gehbehindert, und die humpelten dort mit der Thora-Rolle herum. Man merkte es, die werden das Judentum bis an ihr Grab aufrechterhalten. Aber sie werden nicht klein beigeben. Die waren auch resistent gegenüber der SED. Sie waren auch aufmüpfig.
Ginzel: Es gab keinen Nachwuchs. In Leipzig bestand die ganze Jugend aus drei jungen Männern, Brüder einer einzigen Familie. Das hat mich immer wieder ergriffen. Gerade Leipzig war so ein schönes Beispiel: Alte, kranke Männer, zum Teil gehbehindert, und die humpelten dort mit der Thora-Rolle herum. Man merkte es, die werden das Judentum bis an ihr Grab aufrechterhalten. Aber sie werden nicht klein beigeben. Die waren auch resistent gegenüber der SED. Sie waren auch aufmüpfig.
Gleichzeitig hat die SED das jüdische Leben nicht so unterdrückt, wie man das im christlichen versucht hat, weil das Jüdische war, wie mir das der damalige Staatssekretär Gysi, also der Vater von Gregor Gysi, erzählte, für sie Teil der deutsch-kulturellen Geschichte. Mit anderen Worten: Es gehörte dazu.
Achenbach: Aber weitgehend abgelöst vom Religiösen.
Ginzel: Das Religiöse wurde billigend in Kauf genommen, weil man das eine nicht ohne das andere haben konnte. Außerdem war das eine kleine Gruppierung. Und die DDR hat also zugelassen, dass es einen Verband der jüdischen Gemeinde DDR gab, der vergleichsweise Freiheiten hatte wie die evangelische Kirche. Es gab Ferienheime. Es gab für die wenigen Jugendlichen Ferienlager.
Die Rabbiner kamen überwiegend aus Budapest. Interessanterweise war Budapest das einzige Rabbinerseminar und die einzige Stätte zur Ausbildung von Kantoren im gesamten kommunistischen Ostblock. Und die DDR leistete sich den Luxus – was es zum Beispiel in West-Berlin nicht gab – einer koscheren Metzgerei. Staatlich gefördert, irgendwie so eine sozialistische Einrichtung, wo sich dann auch die arabischen, muslimischen Botschaften bedienten.
"Die DDR hat Ansprüche von Juden in keiner Weise unterstützt"
Achenbach: Das heißt also, es war ein sehr entspanntes Verhältnis.
Ginzel: Zum Schluss. Es war ein entspanntes Verhältnis. Es gab eine eindeutige Diskriminierung. Juden waren Jahrzehnte lang nicht als Verfolgte des Dritten Reiches, als politische Verfolgte, als Widerstandskämpfer anerkannt. Sie waren irgendwo, hatten einen minderen Status, sie bekamen eine geringere Opferrente. Erst in den letzten Jahren der DDR wurden sie den politischen Widerstandskämpfern gleichgesetzt. Das war natürlich schon eine herbe Enttäuschung gewesen, weil es eine eindeutige Diskriminierung war.
Achenbach: Und ein Tabuthema in dieser Zeit in der DDR war ja auch immer wieder die Wiedergutmachung für Naziopfer.
Ginzel: Es gehört zu den Widersprüchen und Verlogenheiten dieses antifaschistischen Systems, dass es kaum einen Beitrag geleistet hat zur Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Die DDR hat die Ansprüche von Juden, etwa in Israel, in der Bundesrepublik, die aus dem Gebiet der DDR jetzt stammten, in keiner Weise unterstützt.
Achenbach: Hing es nicht auch damit zusammen, dass die DDR sich ja ohnehin als ein Staat der Naziopfer dargestellt hat.
"Die DDR hat das Erbe der Arisierer angetreten"
Ginzel: Ja, das ist ja das große Problem und die große Heuchelei. Das Volk war eben kein Volk von Opfern, sondern wir hatten – wenn wir mal von einigen roten Regionen in Berlin absehen – die braunsten Regionen von ganz Deutschland, in der jetzt DDR. Das alles ist nie aufgearbeitet worden. Man hat einfach so getan, als hätte man ein anderes Volk. Was natürlich auch dazu führte, dass nichts aufgearbeitet wurde.
Die DDR hat das Erbe der Arisierer angetreten, in dem die arisierten Werke, das arisierte Privateigentum jetzt alles Staatseigentum wurde, beziehungsweise Eigentum der SED. Die SED-Kreisleitung hauste im ehemaligen Haus der Reichsvertretung der deutschen Juden. Und nirgendwo gab es eine Tafel, nirgendwo gab es eine Erforschung der deutsch-jüdischen Geschichte, nirgendwo gab es wirklich eine dezidierte Geschichte der Shoa. Und dementsprechend wurde der Antisemitismus tabuisiert. Der Nazismus war natürlich ein Verbrechen. Aber eine aktive Aufklärungsarbeit fand in dem Sinne nicht statt.
Achenbach: Zum Teil damals in Kirchengemeinden und auch in jüdischen Gemeinden.
Ginzel: In Kirchen- und jüdischen Gemeinden ja, vor allen Dingen in Kirchengemeinden. In der aufmüpfigen Zeit in der letzten– sagen wir mal – 20 Jahre der DDR-Zeit, der DDR-Existenz, begann eine neue Generation, in den Kirchen darüber nachzudenken, was heißt Sozialismus, was heißt Frieden, wie war das mit dem Dritten Reich. Im Zuge dieses Nachdenkens entdeckten sie auf einmal die tabuisierte Geschichte der Juden in Ostdeutschland. Daraus ist enorm viel entstanden.
Trauer der Nachgeborenen als Provokation empfunden
Nun begann, jenseits der offiziellen SED-Feier zum 9. November 1938, in Erinnerung daran, an die Reichspogromnacht, in der sich formierenden christlichen Bürgerrechts- und Friedensbewegung, die Aufarbeitung dieser jüdischen Geschichte. Dazu gehörte die Trauer der Nachgeborenen. Die nahmen sich eine kleine Kerze und zogen mit ihren Kerzen still dorthin, wo einmal die Synagoge stand, und zum Teil standen sie einfach nur mit ihren Kerzen da. Die SED hat das als dramatische Provokation empfunden.
Achenbach: Das waren ja Schweigemärsche, die nicht genehmigt waren.
Ginzel: Sie waren nicht genehmigt, es waren am Anfang nur ein paar Dutzend Leute. Es war das selbstständige Denken. Es war die Bereitschaft, eine Alternative humanistische Ideologie zu entwickeln, die mit dem Christentum in Einklang stand, die das Jüdische umfasste. Daraus ist dann viel entstanden. So wurden die Kerzen zum Symbol des christlichen Widerstandes in der DDR. Der 9. November wurde zu einem zentralen Ereignis aus den bereits geschilderten Anfängen der gesamten DDR-Bürgerrechtsbewegung.
Achenbach: Das waren ja Schweigemärsche, die nicht genehmigt waren.
Ginzel: Sie waren nicht genehmigt, es waren am Anfang nur ein paar Dutzend Leute. Es war das selbstständige Denken. Es war die Bereitschaft, eine Alternative humanistische Ideologie zu entwickeln, die mit dem Christentum in Einklang stand, die das Jüdische umfasste. Daraus ist dann viel entstanden. So wurden die Kerzen zum Symbol des christlichen Widerstandes in der DDR. Der 9. November wurde zu einem zentralen Ereignis aus den bereits geschilderten Anfängen der gesamten DDR-Bürgerrechtsbewegung.
Die Einheit hat zum Zusammenbruch der ganzen Bürgerrechtsstrukturen geführt. Da ist alles auf diesem Sektor Christlich-Jüdisch zusammengebrochen. Die jüdischen Gemeinden wussten plötzlich auch nicht, wo sie eigentlich stehen. Jetzt plötzlich gehörten sie zum Zentralrat der Juden. Der Zentralrat der Juden, bis vor Kurzem ja doch noch Ausdruck der Bourgeoise. Vom Westen aus hatte man überhaupt keine Ahnung. Es gab praktisch gar keine Kontakte.
Die Rabbiner kannten überhaupt nicht das jüdische Leben hier im Westen, wie es in der DDR war, oder jetzt plötzlich bei den neu gewonnenen Schwestern und Brüdern. Es war eine große Fremdheit. In Berlin ist natürlich, wie bei den Kirchen, auch alles zusammengeführt worden. Man hat auf die besonderen Erfahrungen und Entwicklungen wenig Rücksicht genommen. In der Zwischenzeit hat sich das alles nivelliert. Dank des Zuzugs aus der Sowjetunion von russischen Juden lebt das Leben wieder auf.
"Heute gibt es ein lebendiges jüdisches Leben in Gesamtdeutschland"
Achenbach: Es gibt auch wieder größere Gemeinden.
Ginzel: Wobei man natürlich sagen muss, dass das der Volkskammer zu verdanken ist. Als die Mauer gefallen war, gab es ja immer noch die DDR. Die Volkskammer war noch stark bestimmt von den bürgerlichen idealen Bewegungen. Die haben als Allererstes gesagt: Wir müssen uns als deutsches Parlament zur deutschen Schuld bekennen. Gerade wir – in einem Land, in dem das jahrzehntelang verdrängt wurde.
Ginzel: Wobei man natürlich sagen muss, dass das der Volkskammer zu verdanken ist. Als die Mauer gefallen war, gab es ja immer noch die DDR. Die Volkskammer war noch stark bestimmt von den bürgerlichen idealen Bewegungen. Die haben als Allererstes gesagt: Wir müssen uns als deutsches Parlament zur deutschen Schuld bekennen. Gerade wir – in einem Land, in dem das jahrzehntelang verdrängt wurde.
Somit ist es zu einer eindringlichen, außerordentlich eindringlichen Erklärung der Volkskammer gekommen – zum Thema "Schuld Deutschlands gegenüber Juden und anderen Verfolgten". Im Kontext dieses Ideals hat man dann die Grenzen geöffnet für russische Juden, denn in der Sowjetunion begann plötzlich eine antisemitische Verfolgung von rechtsextremen Gruppen, von stalinistischen Gruppen, von zaristischen Gruppen aus der Ukraine. Aufgrund dieser alten Kontakte sind die ersten Juden dann nicht in die Bundesrepublik aus der Sowjetunion gegangen, sondern in die DDR.
Diese Regelung des Zuzugs von Juden aus dem Ostblock nach Deutschland – ursprünglich nur für das Gebiet der DDR – wurde dann im Einheitsvertrag von den Gesamtdeutschen, von der Bundesrepublik, übernommen. Somit kam es eben zu einem Zuzug und vor allen Dingen zu einem Wiederaufleben. Wir haben heute eben auch wiederum starke jüdische Gemeinden in Ostdeutschland, neue Bauten. Ja, es gibt ein lebendiges jüdisches Leben heute in Gesamtdeutschland.