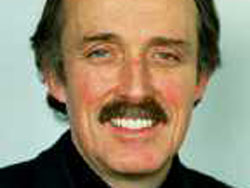Die raue See vor der Ostküste Schottlands wurde schon so manchem Schiff zum Verhängnis. Entsprechend stoßen Taucher dort immer wieder auf archäologische Schätze der Schifffahrtsgeschichte. Doch wenn sie geborgen sind, fangen die Probleme erst richtig an, denn nach dem Trocknen werden vor allem kombinierte Funde aus Holz und Metall sehr empfänglich für den Zahn der Zeit, sagt David Cole-Hamilton. Deshalb, so schildert der Chemiker der Universität von Saint Andrews, werden die Fundstücke bislang gerne mit Kunststoff behandelt. Doch die Methode hat einen Haken, denn im Synthetikharz sind kleine Mengen Säuren enthalten, die wiederum metallische Komponenten wie Nägel und Nieten angreifen - so etwa geschehen bei der berühmten "Vasa" in Stockholm. Erst spät kamen Wissenschaftler dem nagenden Phänomen auf die Spur. Wie aber, so rätselte Cole-Hamilton, könnten die nautischen Schätze ohne Nebenwirkungen für die Nachwelt bewahrt werden.
In der Badewanne, erzählt der ostschottische Chemiker süffisant, sei er zu dem entscheidenden Heureka-Erlebnis gekommen: das Gas Kohlendioxid. Den Effekt demonstriert er anhand eines Stückes, das er für das schottische Nationalmuseum konservierte: "Das ist die Halterung für den Kompass der Swan, die 1653 sank: ein rundes Holzstück von fünfzehn Zentimetern Durchmesser, beschwert von einem ebenfalls runden Bleigewicht. Darauf sitzt ein Stift aus Kupfer, auf dem der Kompass befestigt war. Das Blei ist mit gebogenen Kupfernägeln am Holz befestigt." Weil der Kunststoff die zahlreichen Teile aus Blei und Kupfer korrodiert hätte, verbot sich das herkömmliche Verfahren. Auch eine Demontage, um alles separat zu versiegeln, war unmöglich, denn dabei wäre es vermutlich zu Beschädigungen gekommen. Also versuchte es David Cole-Hamilton auf seine Art. Dazu wurde der Fund zunächst über zwei Wochen quasi mit Methanol mariniert, um das Wasser herauszulösen. Dann wanderte die über 300 Jahre alte Kompasshalterung in eine Kompressionskammer.
"Darin betreiben wir die Holz-Konservierung. Kohlendioxid wird unter hohem Druck hineingepumpt, durchströmt die Reaktionskammer und tritt auf der anderen Seite wieder aus", schildert der Chemiker. Dabei drückt das Kohlendioxid den Alkohol aus dem Baustück. Dies geschieht ohne Verlust - das Methanol kann anschließend wieder verwendet werden. Doch der Clou ist das Kohlendioxid, das keineswegs gasförmig zum Einsatz kommt. Vielmehr liegt es in einer bizarren Sonderform vor, dem so genannten überkritischen Zustand. Dazu Cole-Hamilton: "Überkritisches Kohlendioxid ist ein Zwitter aus Gas und Flüssigkeit. Wie ein Gas kann es in alle Poren vordringen, außerdem kann es Stoffe auflösen wie eine Flüssigkeit. Die Lebensmittelindustrie hat das längst entdeckt und entfernt mit Hilfe von überkritischem Kohlendioxid Bitterstoffe aus dem Hopfen und Koffein aus Kaffeebohnen." Allein Wasser löst sich nicht darin - das muss das Methanol besorgen. Um den segensreichen Zustand des Klimagases zu erreichen, muss man allerdings einige Kniffe anwenden: "Wir arbeiten dazu bei 70 Grad Celsius und dem 120fachen Atmosphärendruck. Unser Druckgefäß ist ein Zylinder mit 20 Zentimetern Durchmesser und einem Volumen von 20 Litern." Weil aber sein Demonstrator eher von bescheidenem Format ist, hofft David Cole-Hamilton, bald die nötigen Mittel für einen größeren Reaktor zu bekommen.
[Quelle: Hellmuth Nordwig]
In der Badewanne, erzählt der ostschottische Chemiker süffisant, sei er zu dem entscheidenden Heureka-Erlebnis gekommen: das Gas Kohlendioxid. Den Effekt demonstriert er anhand eines Stückes, das er für das schottische Nationalmuseum konservierte: "Das ist die Halterung für den Kompass der Swan, die 1653 sank: ein rundes Holzstück von fünfzehn Zentimetern Durchmesser, beschwert von einem ebenfalls runden Bleigewicht. Darauf sitzt ein Stift aus Kupfer, auf dem der Kompass befestigt war. Das Blei ist mit gebogenen Kupfernägeln am Holz befestigt." Weil der Kunststoff die zahlreichen Teile aus Blei und Kupfer korrodiert hätte, verbot sich das herkömmliche Verfahren. Auch eine Demontage, um alles separat zu versiegeln, war unmöglich, denn dabei wäre es vermutlich zu Beschädigungen gekommen. Also versuchte es David Cole-Hamilton auf seine Art. Dazu wurde der Fund zunächst über zwei Wochen quasi mit Methanol mariniert, um das Wasser herauszulösen. Dann wanderte die über 300 Jahre alte Kompasshalterung in eine Kompressionskammer.
"Darin betreiben wir die Holz-Konservierung. Kohlendioxid wird unter hohem Druck hineingepumpt, durchströmt die Reaktionskammer und tritt auf der anderen Seite wieder aus", schildert der Chemiker. Dabei drückt das Kohlendioxid den Alkohol aus dem Baustück. Dies geschieht ohne Verlust - das Methanol kann anschließend wieder verwendet werden. Doch der Clou ist das Kohlendioxid, das keineswegs gasförmig zum Einsatz kommt. Vielmehr liegt es in einer bizarren Sonderform vor, dem so genannten überkritischen Zustand. Dazu Cole-Hamilton: "Überkritisches Kohlendioxid ist ein Zwitter aus Gas und Flüssigkeit. Wie ein Gas kann es in alle Poren vordringen, außerdem kann es Stoffe auflösen wie eine Flüssigkeit. Die Lebensmittelindustrie hat das längst entdeckt und entfernt mit Hilfe von überkritischem Kohlendioxid Bitterstoffe aus dem Hopfen und Koffein aus Kaffeebohnen." Allein Wasser löst sich nicht darin - das muss das Methanol besorgen. Um den segensreichen Zustand des Klimagases zu erreichen, muss man allerdings einige Kniffe anwenden: "Wir arbeiten dazu bei 70 Grad Celsius und dem 120fachen Atmosphärendruck. Unser Druckgefäß ist ein Zylinder mit 20 Zentimetern Durchmesser und einem Volumen von 20 Litern." Weil aber sein Demonstrator eher von bescheidenem Format ist, hofft David Cole-Hamilton, bald die nötigen Mittel für einen größeren Reaktor zu bekommen.
[Quelle: Hellmuth Nordwig]