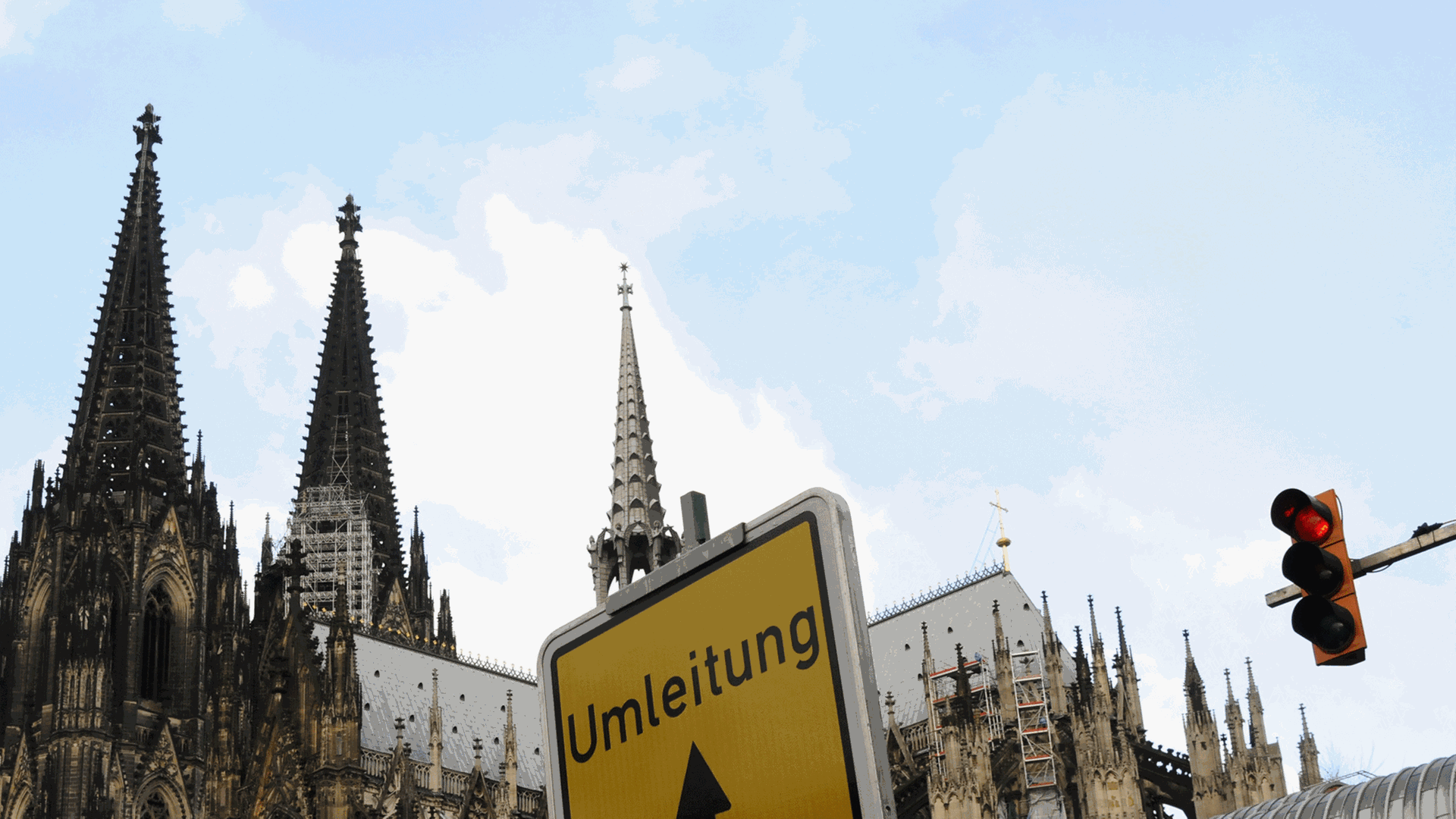
Direkt in der Einfahrt des Parkhauses führt eine unscheinbare Tür in das fensterlose, holzvertäfelte Kontrollzentrum des Kölner Ampelnetzes. Dort im Keller rauschen die Lüfter von sechs Verkehrsrechnern – jeder so groß wie ein Büro-Rollcontainer. Der Techniker Günter Diedrichs ist dafür zuständig, sie am Laufen zu halten.
"Hier stehen jetzt also die Verkehrsrechner aus den Neunziger Jahren. Das waren damals Hochleistungsprozessrechner, aber wie gesagt aus den Neunziger Jahren, die sind natürlich nicht mehr Stand der Technik. Also ich sag mal, jedes Handy hat heute mehr Rechenleistung als der alte Verkehrsrechner."
Ein modernes Smartphone hat zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. Jeder der sechs alten Verkehrsrechner hier hat nur 66 Megabyte Arbeitsspeicher, also ein Dreißigstel davon. Trotzdem laufen hier die Daten von hunderten Ampeln zusammen.
"Das Gesamtsystem von so einer Verkehrssteuerungsanlage bei einer Stadt besteht aus den Signalanlagen, die draußen erst einmal autark laufen. Diese Signalanlagen sind noch mal an die Verkehrsrechnerzentrale angeschlossen. Und diese Signalanlagen melden also dem Verkehrsrechner erst einmal ihren Status. Das ist eine wichtige Funktion. Die zweite wichtige Funktion ist dann diesen Status zu Kontrollen, das heißt zu erkennen, ob irgendwo Störfälle sind."
Und dafür ist Günter Diedrichs seit 1994 zuständig. Wenn er nachsehen will, ob an den Ampeln draußen alles in Ordnung ist, setzt er sich damals wie heute vor einen voluminösen Röhrenbildschirm, und dechiffriert die Zahlenkolonnen, die darauf erscheinen:
"Ich habe jetzt eingegeben, ein sogenanntes Dach IS, steht für Ist-Stand Störung. Und als Antwort sagt der Verkehrsrechner mir jetzt hier sind jetzt der Knoten 462, 472, 624 und 637 sind außerhalb vom Regelbereich. Und jetzt muss ich die Zeichen, die dahinter in dieser Zeile kommen, interpretieren können. 08 für Lampenstörung, 01 ist in dem Fall eine Kommunikationsstörung."
Kabelstränge von über 600 Ampeln
Um herauszufinden, wo die Verbindung zwischen Ampel und Zentralrechner gestört ist, öffnet der Techniker eine Tür in der Holzvertäfelung. Dahinter kommen die Kabelstränge von über 600 Ampeln an.
"Wenn wir irgendwo eine Störung im Kommunikationsbereich zur Lichtsignalanlage erkennen, dann prüfen wir hier mit dem Kopfhörer, ob die Signale noch sauber sind. Das ist erst mal eine grobe Diagnose und wenn man also herausgefunden hat, aha, auf der Kabelleitung sind Geräusche, die da nicht hingehören, dann muss man diagnostizieren: Wo kommen die her?"
Pfeif- und Knacktöne aus der Leitung und Zahlenkolonnen auf einem antiquierten Monitor, das sind alle Möglichkeiten, auf die Günter Diedrichs zurückgreifen kann, um das Ampelnetz zu überwachen. Nicht gerade komfortabel.
Noch größer ist das Problem der Ersatzteilbeschaffung. Für 30 Jahre alte Rechner werden keine Bauteile mehr hergestellt und die Vorräte der Betreiberfirma sind endlich. Aber was passiert dann, wenn einer der Zentralcomputer nicht mehr zu reparieren ist? Bricht dann in dem Bezirk, dessen Ampeln er steuert, völlige Anarchie an den Kreuzungen aus?
"Nein, also es ist tatsächlich so, dass die Anlagen in einem Notlauf weiterlaufen, zumindest mal die meisten, aber es würden teilweise Störungen in den grünen Wellen passieren, es würden keine Umschaltungen mehr passieren für zum Beispiel Morgenspitze-Programme, Abendspitze-Programme. Das würde alles nicht mehr passieren und sie können sich vorstellen, dann wäre der Stau vorprogrammiert."
Zwei Millionen Euro für einen neuen Zentralrechner
Das hat auch der Kölner Stadtrat eingesehen und die zwei Millionen Euro für einen neuen Zentralrechner bewilligt. Derzeit läuft die Ausschreibung, wenn alles gut geht, werden noch dieses Jahr alle sechs alten Verkehrsrechner von einem modernen ersetzt. Der wird mit einigen Terabyte Arbeitsspeicher daher kommen und bringt neben dem Vorteil, alles von einem einzigen Rechner aus steuern zu können, auch noch eine Menge neuer Diagnose-Möglichkeiten mit. Welche das sind, lässt sich für den Innenstadtbereich schon demonstrieren. Für diesen Bezirk ist derzeit ein halbwegs moderner Leihrechner zuständig.
"Sie haben hier jetzt eine grafische Oberfläche mit der Stadtkarte von der Stadt Köln. Darauf entsprechende Kreuzungssymbole. Jedes Symbol bildet dann einen Zustand einer einzelnen Lichtsignalanlage draußen ab. Grün: Die Anlage ist störungsfrei, Rot: Die Anlage ist ausgefallen. Sie haben also deutlich mehr Möglichkeiten, den Zustand der Signalanlagen zu betrachten, auszuwerten und können den natürlich verbessern. Dann gibt's natürlich automatische Verkehrsplanungs-Tools, die die Verkehrsplaner noch dabei unterstützen können, die Steuerung des Knotens zu optimieren."
Auch die Ingenieure der Stadt Köln, die die Zyklen für die Ampelschaltung programmieren, können also von einem modernen Zentralrechner profitieren. Denn dieser sammelt eine wesentlich umfangreichere Datenbasis darüber, was an den Kreuzungen passiert. Immer vorausgesetzt, die Technik in den Ampeln ist auf dem neusten Stand. Zwar wird auch die nach und nach erneuert, bei knapp eintausend Ampelanlagen, die die Stadt jeweils einzeln ausschreiben muss, ist das allerdings ein immerwährender Prozess. Dementsprechend feiert die Steuerelektronik einiger Ampelanlagen in Köln dieses Jahr schon den vierzigsten Geburtstag. Von intelligenter Verkehrssteuerung kann da noch keine Rede sein.
