
Es beginnt mit einem Aufbruch, der Unverständnis weckt. Am 10. November 1989 erreicht Carl Bischoff ein Telegramm seiner Eltern, er möge bitte umgehend zu ihnen nach Hause kommen, um etwas Wichtiges zu besprechen. Carl setzt sich in seinem Wohnort Halle in den Zug, strandet kurzzeitig am vollkommen überfüllten Hauptbahnhof in Leipzig, um schließlich weiterzureisen nach Gera, seiner Geburtsstadt.
Nach Westen und Nach Osten
Die Gegenströmungen der Geschichte erfährt Carl am Leipziger Bahnhof zum ersten Mal ganz konkret, als er beobachtet, wie die Menschen den hoffnungslos überfüllten Zug in Richtung Berlin erstürmen, während er selbst in die thüringische Provinz abbiegt. Dort angekommen, machen Carls Eltern ihm eine überraschende Eröffnung: Inge und Walter Bischoff, zwei grundsolide, auf den ersten Blick nicht weiter auffällige Menschen, wollen weg, wollen das Land verlassen in Richtung Westen. Und es soll schnell gehen, auch deshalb, weil sie Angst haben, das System könne noch einmal zurückschlagen und die frisch geöffnete Grenze wieder schließen. Carl macht der Entschluss seiner Eltern einigermaßen perplex:
"Auf ihre Weise trugen Inge und Walter zum Umsturz bei, der überall im Gange war. Sie erschienen nicht mehr auf ihrer Arbeit, sie verließen ihren Platz und rüsteten zur Flucht, wenn man es so nennen wollte. Seine Eltern! Sie waren die unwahrscheinlichsten Flüchtlinge, die Carl sich vorstellen konnte."
Dass Carl mit dieser Einschätzung falsch liegen soll, wird sich erst am Ende des Romans in aller Klarheit erweisen. Es ist nicht die einzige Fehleinschätzung Carls im Hinblick auf seine Eltern. Der Kontrast zwischen den Beobachtungen und Erfahrungen der in den Westen ausgewanderten Eltern und Carls eigenem Blick auf die Welt gehört zu den vielen reizvollen Aspekten des Romans.
Doch zunächst fühlt Carl sich wider alle Vernunft allein- und zurückgelassen. Seine Eltern bitten ihn, in Gera die Stellung zu halten und auf die Wohnung, die Hobbywerkstatt des Vaters und das Auto aufzupassen. "Sich zu kümmern", wie der Vater es ausdrückt. Dann fährt Carl seine Eltern über die deutsch-deutsche Grenze, nach Herleshausen, und kehrt selbst zurück nach Gera. Er ist unzufrieden, aufgewühlt und versucht gleichzeitig, den Schein der Normalität zu wahren. Seine Laune wird zunehmend schlechter:
"Die kleinen Unglücke summierten sich, eine feindliche Stimmung baute sich auf. Ein Glas ging zu Bruch, und sofort trat Carl mit bloßem Fuß in einen der Splitter. Ihn packte die Wut. Draußen fielen die Grenzen, und er saß in Gera-Langenberg fest. Verlassen von Gott und der Welt."
Rund zwei Wochen geht das gut; dann macht sich auch Carl auf die Reise. Er ist 26 Jahre alt; sein Studium hat er unter- oder auch abgebrochen, und aus Andeutungen lässt sich schließen, dass er eine unglückliche Liebesgeschichte inklusive Tablettenüberdosis hinter sich hat. Carl setzt sich in das sorgsam gepflegte Auto des Vaters und bricht nach Berlin auf.
Dieses Auto entwickelt sich, so abseitig das zunächst klingen mag, zu einer der Hauptfiguren des Romans: Ein Shiguli, ein FIAT-Nachbau aus sowjetischer Produktion aus den 1970er-Jahren, stilecht in weiß mit orangenem Dach und gleichfarbigen Zierstreifen. Der Wagen wird in den ersten Tagen nach Carls Ankunft in Berlin zu seinem Gefährten und zu seiner Wohnung zugleich. In der Linienstraße stellt Carl den Shiguli ab, lässt, so lange es möglich ist, die Heizung und das Radio laufen, um in den Winternächten nicht zu erfrieren und zu vereinsamen, und erkundet in den Tagen den Prenzlauer Berg, die neue Zeit, die neue Epoche, die anbricht.
Der Anführer, der Hirte
Ganz eindeutig trägt "Stern 111" autobiografische Züge, doch der Roman ist keine Autofiktion im eigentlichen Sinn. Lutz Seiler betont, dass er zwar im Hinblick auf die Handlungsorte die Strahlkraft des Authentischen genutzt habe. Auf der anderen Seite wird aber auch schnell deutlich, dass erst die Wirkungsmacht von Seilers eleganter, bildreicher Sprache die dokumentarischen Elemente des Romans literarisch erhebt.
In der Nacht zum dritten Advent 1989 wacht Carl mit Schüttelfrost im Shiguli auf. Er schleppt sich soeben noch nach draußen, in eine Kneipe, und bricht zusammen. Als er wieder aufwacht, liegt er auf einer Matratze, einen Becher Ziegenmilch in der Hand, und ist aufgenommen in die Gemeinschaft des Rudels, wie die Kommune zukünftig nur noch genannt wird.
Ihr Anführer ist Hoffi oder auch "der Hirte", eine breite, charismatische Figur, um die herum sich eine radikal utopistische Stadtguerilla formiert hat. Sie nehmen Carl, den Shigulimann, auf, und von diesem Augenblick an lebt er in der Gewissheit, Teil eines bedeutenden Vorgangs zu sein:
"Alles schien wie eingebettet und lange schon geplant, in genau dieser einzig logischen Folge. Das war ein seltsames Gefühl. Es war das Vorgefühl einer Legende (falls es das gibt, dachte Carl), die sich anschickte, ihn aufzunehmen in ihr tiefes, alles umfassendes ‚Es-war-einmal‘."
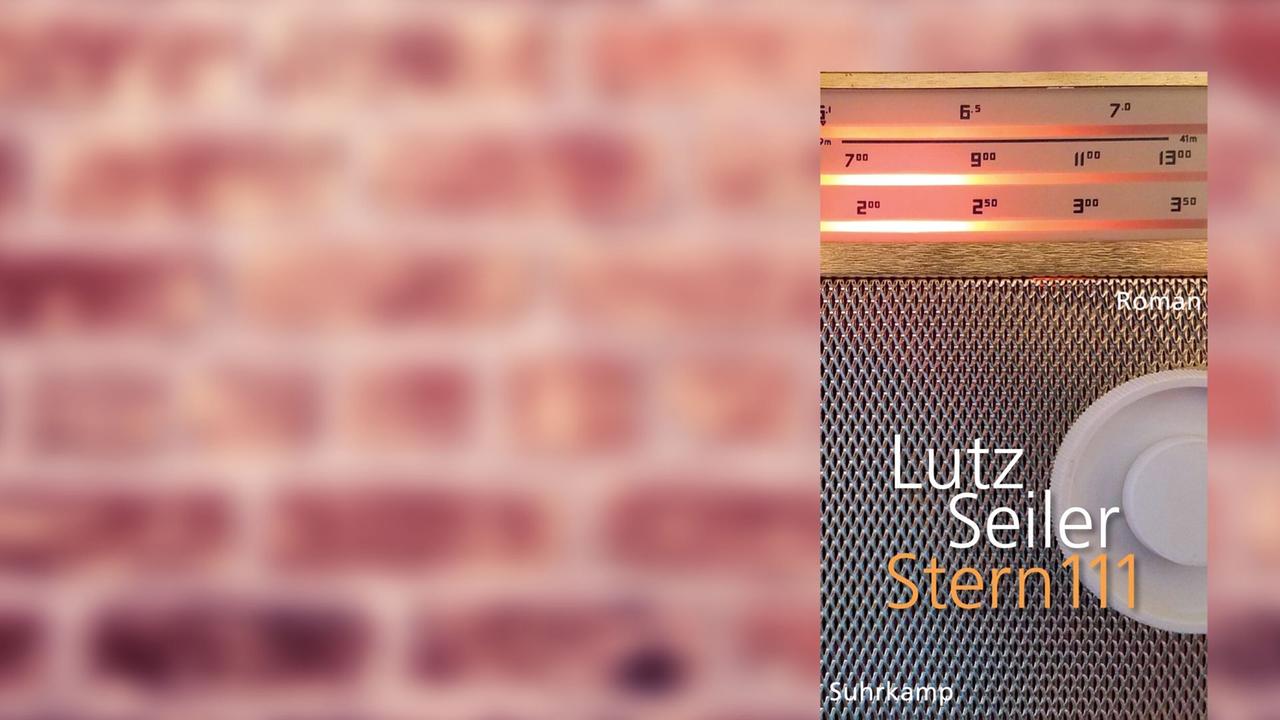
Lutz Seilers Roman umspannt einen Zeitraum von rund 16 Monaten und ist in seinem Bewegungsradius eng begrenzt: Rykestraße, Oranienburger Straße, Kollwitzplatz heißen die Koordinaten, die heute als Chiffren bürgerlicher Kreativexistenzen in einem gentrifizierten Quartier gelesen werden können. Bei Lutz Seiler dagegen, und unter anderem das ist das Aufregende an "Stern 111", erscheinen Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg als freie Spielfläche der Utopien, als ein wildes Gelände, in dem jeder Gedanke, jede Idee, jede Zukunft möglich erscheinen.
In der Beschreibung der herunter gekommenen Häuserblocks, die von der anarchistischen Hirtengruppe mitsamt der Ziege Dodo in Besitz genommen werden, entfaltet Lutz Seiler sein großes schriftstellerisches Können. Seine Sprache ist so anschaulich wie sinnlich, so elegant wie frei von Klischees. Die Stimmung, die Seiler heraufbeschwört, hat etwas Irreales. Das liegt in erster Linie an der Erkenntnislücke zwischen den erzählten Ereignissen und unserem Wissensstand in der Gegenwart: "Stern 111" katapultiert seine Leser in einen schmalen Zeitkorridor, der aufgeladen ist mit Visionen von alternativen Lebensformen. Heute wissen wir, wie schnell der Kapitalismus sich diese Visionen einverleibt hat; das ändert aber nichts an der Vehemenz und Anschaulichkeit, mit der ihnen Seiler literarische Geltung verschafft.
Das Rudel besteht aus Menschen, die mit Verve eine neue Ära ausgerufen haben, die das große Wort und die große Geste nicht scheuen. Davon ist auch Carl nicht ausgenommen, und in der Verbindung von Freidenkerei und ästhetischem Anspruch wird "Stern 111" zugleich zu einem politischen Roman wie zu einem Künstlerroman. Denn so sehr das Rudel auch Carls handwerkliche Fähigkeiten bei der Instandsetzung der maroden Bausubstanz benötigt, so sehr treibt Carl in Wahrheit der Drang nach Höherem an:
"Ja, ich habe den Beruf eines Maurers erlernt und als Maurer gearbeitet, und ich bin gern bereit, euch etwas zurückzugeben auf diese Weise, aber eigentlich bin ich kein Maurer, ich bin ... Wie sollte er es sagen? Ein Dichter. Das gute, alte, hochfahrende Wort und sein peinliches Pathos. Ein Dichter – also ein Irrer, Aufschneider, Angeber, eine Witzfigur."
Männer, die auf Ziegen starren
Arbeiter und Dichter, Revolution und hoher Ton: "Stern 111" ist ein Roman der Verwandlungen und Übergänge. Lutz Seilers Terrain ist ein Machtvakuum; ein Staat, der seine alte Form verloren und seine neue Form noch nicht gefunden hat. Ein Leben in Widersprüchen ist es zudem: Man lehnt den Konsum ab, holt aber das Begrüßungsgeld ab, um überleben zu können.
Das Rudel richtet sich in der Oranienburger Straße einen Treffpunkt ein, ein Café mit dem Namen "Die Assel". Diese Kneipe, die tatsächlich existiert hat, wird zum Kulminationspunkt des System- und Identitätswechsels. Im vermeintlich herrschaftsfreien Raum tummeln sich Spinner und Dichter, neu angekommene Sexarbeiterinnen und russische Soldaten, die sich ebenfalls in einer Daseinskrise befinden und auf ihren Marschbefehl nach Hause warten.
Wer hier ebenfalls eines Tages auftaucht, ist ein Mann, der "Commandante" oder "der Sprengmeister" genannt wird. Sein Name ist Krusowitsch, kurz: Kruso, und er ist der Anführer des gewaltbereiten Flügels der Stadtguerilla, der die neu in Besitz genommenen Wohnungen zur Not auch mit der Waffe gegen die Obrigkeit zu verteidigen bereit ist. Kruso ist auch der Initiator des lächerlich fehlschlagenden Versuchs, die ehemaligen DDR-Grenzhunde günstig zu kaufen und in den Dienst der Stadtguerilla zu stellen. So erweist Lutz Seiler dem Helden seines letzten Romans seine Reverenz.
Zur Finanzierung des Alltags hat der Hirte im Übrigen ein recht lukratives, wenn auch zeitlich begrenztes Geschäftsmodell entwickelt:
"Es gibt Anfragen von Firmen, sogar aus Übersee. Sie kaufen die richtig großen Teile, komplette Elemente, Meterware. Das steht dann vor irgendeiner Firmenzentrale in Cincinnati oder an einem Swimmingpool in Sacramento. Auch Privatleute werden beliefert, klar, Kleinvieh macht auch Mist. Manche wollen ihr Stück Mauer in einer besonderen Form, mehr sage ich nicht dazu. Wir fertigen das an, in unserer Werkstatt, diskret, schön geschliffen."
Die Zeit in der Assel-Community vergeht langsam. Fast spielt sie keine Rolle. Seine innere Spannung bezieht Seilers Roman auch aus dem Widerspruch zwischen der historischen Dynamik jener Monate, die allenfalls in Nebensätzen aufscheint, und der demonstrativen Ereignislosigkeit in Carls persönlichem Umfeld, in das Veränderungen nur allmählich einsickern. Der 3. Oktober 1990, der Tag der staatlichen Vereinigung, ist allenfalls ein Randereignis, während das Verputzen einer Kellermauer mit Leichtigkeit ein ganzes Kapitel tragen kann.
Wenn es einen Einwand gegen den Roman gibt, dann den, dass die erlebte Einförmigkeit jener Tage phasenweise bis an den Rand der Manieriertheit inszeniert wird. Lutz Seiler ist allerdings ein viel zu guter Schriftsteller, um das nicht zu wissen. Der drohenden Monotonie seines dennoch glänzend erzählten Handlungsstrangs in der Assel setzt Seiler zwei Kontrapunkte entgegen. Zum einen ist es die detailliert beschriebene Dingwelt, die in "Stern 111" ein Eigenleben zu führen scheint und immer wieder als Anker für Erinnerungen, Rückblenden und Motivverkettungen fungiert. Carls Auto, der Shiguli, ist nur ein Beispiel dafür. Ebenso präzise widmet sich Seiler Elektrogeräten, Werkzeugen und Alltagsgegenständen. Zu ihnen gehört auch der dem Roman den Titel gebende Stern 111, ein Radio-Gerät aus DDR-Zeiten, das die Brücke zwischen der Gegenwart und Carls Kindheitserinnerungen schlägt.
Zum anderen erzählt Lutz Seiler in einem parallelen Strang auf anspruchsvolle Weise die Geschichte von Ingrid und Walter Bischoff, Carls Eltern, und deren Ankunft im Westen. Aus Briefen an Carl und erlebter Rede setzt sich ein Bild der Verunsicherung zusammen. Nach ihrer Ankunft im Auffanglager bei Gießen werden Ingrid und Walter zunächst getrennt, schlagen sich dann in verschiedenen Jobs durch, bevor sie in der Nähe von Gelnhausen bei Frankfurt wieder zusammenfinden. Der technisch begabte Walter wird von einem dubiosen Unternehmensgründer angestellt und als Referent für Computerkurse geschult. Der Makel seiner Herkunft und sein niederer Status werden Walter gleich zu Beginn vor Augen geführt:
"‘Das Wichtigste wird sein, dass niemand erfährt, woher du kommst, eigentlich‘" – das hatte Karajan gesagt, Cheftrainer von CTZ. Karajan hatte Walter gezeigt, wie das Kursmaterial beschaffen sein sollte, welche Technik ihn vor Ort erwarten und wie sie gehandhabt werden musste. Das Aufwendigste waren die Folien für den Overhead-Projektor. Jeder Kurs war eine Folienwüste. ‚Ein Ostler, verstehst du, Walter – viele ertrügen das nicht, bei 1000 Mark Kursgebühr pro Tag‘, hatte Karajan gesagt."
'The weeping song'
Für Carl wiederum eröffnet sich in der Assel eine weitere Dimension. Wie durch eine Vorsehung trifft er bei einer Kunstinstallation Effi wieder. Effi, seine Jugendliebe aus Geraer Zeiten, der er einst einen so sehnsuchtsvollen wie vergeblichen Liebesbrief geschrieben und die er später aus den Augen verloren hatte. Nun sitzt sie vor ihm, als Teil einer Performance, ist mit ihren künstlerischen Ambitionen ebenso in Berlin gelandet wie er selbst. Mit größter Selbstverständlichkeit werden die beiden ein Paar, wenn auch vorerst nicht in einer gemeinsamen Wohnung. Effi fordert, auch mit Blick auf ihren kleinen Sohn, Rückzugsmöglichkeiten.
Wohnraum gibt es genug; der Bezug ist recht einfach: Man sucht sich eine leerstehende Wohnung, bricht sie auf, tauscht das Schloss aus und zieht ein. Mit dem Eintritt von Effi in Carls Leben verschiebt sich auch sein Blick auf die Welt, so wie Lutz Seiler insgesamt Monat für Monat, den er beschreibt, den Winkel seiner Führungskamera minimal verändert:
"Er sah sie gemeinsam in diesem Zimmer, bei der Arbeit, er sah den Tisch, wo die Zigaretten lagen, wo der Wein stand, wo man sich in Abständen ein Glas eingoss, nur so, wie jeder wollte, wie es einem gerade zumute war, der Tisch, an dem man sich zufällig traf, berührte, miteinander schlief und dann zurückkehrte zur Arbeit, und so die ganze Nacht ... Er sah Szenen großer Wärme und Gemeinsamkeit, mehr als Liebe, falls das möglich war, er sah Freundschaft, Sex, Arbeit, sie waren Gefährten, und zusammen würden sie es schaffen, sie würden Künstler sein."
Was Lutz Seiler am Beispiel des Rudels vorführt, ist auch ein Prozess von Machterwerb und Machtverfall, von Strukturaufbau und Strukturwandel. Ein tatsächlich gelebter vermeintlich utopischer Zustand kann nur augenblickhaft und niemals von Dauer sein. Was geradezu naturgemäß in der Assel einsetzt, ist ein schleichender Prozess der Devastierung. Hoffi, der Hirte, wird bei einem Häuserkampf verletzt und vegetiert fortan nur noch als traurige Figur mit Dodo, der Ziege, in einem stallähnlichen Nebengebäude der Assel vor sich hin. Zum ersten Geburtstag der Einrichtung sind es schon andere, die die großen Reden halten.
Carls Verhältnis zu Effi verkompliziert sich, als der Vater ihres Sohnes wieder in ihr Leben tritt und in die Nachbarwohnung einzieht. Carl beginnt zu trinken. Und er fällt in alte Gewohnheiten aus DDR-Zeiten zurück. An einem der betrunkenen Abende in der Assel, an denen Nick Caves "The Weeping Song" aus den Lautsprechern tönt, zerdrückt Carl das Glas, das sich in seiner Hand befindet, verliert dabei beinahe einen Daumen und hat in dem Dämmer aus Trunkenheit, Blutverlust, Traurigkeit und Erschöpfung eine Vision:
"Das Blut floss ganz ungebremst aus Carl heraus, und die Lache am Boden vergrößerte sich. Muss nicht meine Sorge sein, dachte Carl und legte den Kopf in den Nacken. Er war ziemlich erschöpft. An der Decke tauchten Malereien auf, auch an den Wänden. Es waren Bilder von Effi, und dazwischen standen Carls Gedichte geschrieben. Gute Gedichte, die er noch gar nicht kannte, mit Zeilen so lang wie Geburtstagsgirlanden. Er hatte es endlich geschafft."
Seit den 1990er-Jahren war immer wieder die Rede vom so genannten großen Wenderoman, der von Schriftstellern erwartet oder gar gefordert wurde. Heute könnte man angesichts von Romanen wie jenen von Ingo Schulze, Thomas Brussig und auch Uwe Tellkamp zumindest das vielschichtige, wenn auch heterogene Stimmungsbild einer Umbruchszeit zusammensetzen.
Auch Lutz Seiler hat mit "Kruso" ein künstlerisches Werk geschaffen, das sowohl in seinem dokumentarischen wie literarischen Wert Bestand haben dürfte. Mit "Stern 111" verhält es sich anders: Der Roman fällt heraus aus allem, was bisher zu lesen war, weil Lutz Seiler nostalgiefrei etwas erzählt, was so bislang weder als Literatur noch als offizielle Geschichtsschreibung, sondern nur als mündliche Erinnerung existiert hat. Es ist ein Buch, das uns dorthin führt, wo wir noch nicht waren – in einen phantastischen Zwischenraum zwischen zwei zerbröselnden Staaten.
Es spricht für Lutz Seiler und für die Zuneigung zu all seinen Figuren, dass er seinem Roman auf der Schlussgeraden noch einmal eine sowohl die Leser als auch Carl Bischoff verblüffende Wendung gibt, die zwar rührend, aber glaubwürdig erscheint.
Sechzehn Monate der vollkommenen Möglichkeiten sind vorüber. Menschen sind gekommen und gegangen. Die neue Ordnung bildet sich heraus. Und Carl macht mit Dodo, der Ziege, einen Ausflug in den Tierpark, wo sich zum letzten Mal Wunderliches ereignet:
"Aus heutiger Sicht ist es ganz gleich, ob Dodo gesprochen hat oder nicht. Entscheidend ist, was ich gehört habe, damals. Und dass in diesem Moment plötzlich sehr viel zusammenkam – ich kann es nur so undeutlich sagen. Dazu Dodos stechender Geruch, der mir die Tränen in die Augen trieb.
‚Lass uns gehen.‘"
‚Lass uns gehen.‘"
So ernsthaft Lutz Seiler auf rund 500 Seiten existentielle Veränderungen und Hoffnungen durchgespielt hat, so ironisch entlässt er sein Alter Ego Carl in eine offene Zukunft. Auch das spricht für die große Qualität von "Stern 111".
Lutz Seiler: "Stern 111"
Suhrkamp Verlag, Berlin. 528 Seiten, 24 Euro.
Suhrkamp Verlag, Berlin. 528 Seiten, 24 Euro.


