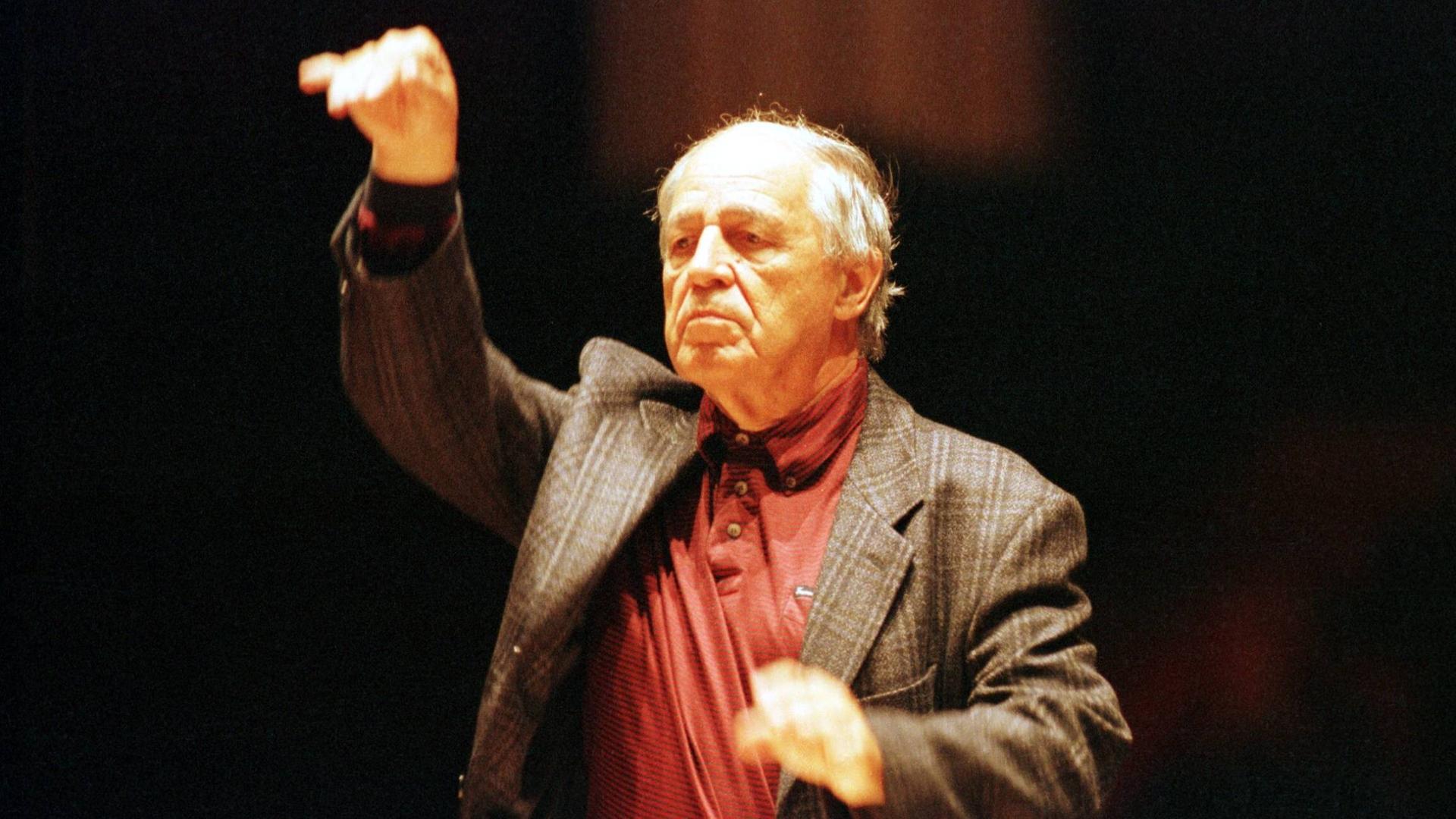Giuseppe Verdi nannte ihn "il Bismarck della critica musicale“; von der Wagner-Partei wurde er zum Erzfeind stilisiert. Der am 11. September 1825 geborene Eduard Hanslick zählt zu den mythischen Figuren der Musikkritik. Was blieb von dem gefürchteten Wiener Kritiker, und wie prägt er den Musikjournalismus bis heute?
"Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik."
Mit Ende zwanzig landete Hanslick einen Coup: Sein schmales Buch "Vom Musikalisch-Schönen" wurde gelesen, debattiert und von der Wiener Universität sogar als Habilitationsschrift angenommen. So wurde der promovierte Jurist und Journalist Eduard Hanslick der erste Professor für Musikwissenschaft an der Wiener Universität. "Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik": Der apodiktische Satz wurde berühmt.
Meinungshoheit mit Feder
Zum Ruhm Hanslicks trug dessen Kritik an Wagner wesentlich bei. Der Wiener Professor war es, der es wagte, dem Erfinder des „Gesamtkunstwerks“ entgegenzutreten. Hanslick wurde zum Anti-Wagner: So ist er zu sehen auf einem Karikatur-Scherenschnitt von Otto Böhler, der bis heute in kaum einem Wagner-Programmheft fehlt. Er zeigt den Kritiker auf einem Podest thronend, eine überdimensionierte Schreibfeder in der einen Hand, die andere mit dem Zeigefinger nach unten deutend; vor ihm ein indignierter Richard Wagner. Es wurde zum Klischeebild des Musikkritikers.
Aber wie konnte er so mächtig werden? Und was kann man bis heute von ihm lernen? Hanslick-Forscher Werner Abegg meint: dass man sich wirklich Gedanken mache, was qualitativ über eine Komposition zu sagen sei.
"Dass man nicht nur sagt, ja, das war wunderbar, sondern warum war es für einen wunderbar?“
Mitunter war Hanslick inkonsequent, nicht alle der selbst aufgestellten Regeln befolgte er auch. Und er blieb offen für die Klänge von morgen - das zählt zu den sympathischen Seiten des Kunstrichters, dessen Sätze auch 200 Jahre nach seiner Geburt nichts an Schärfe verloren haben.