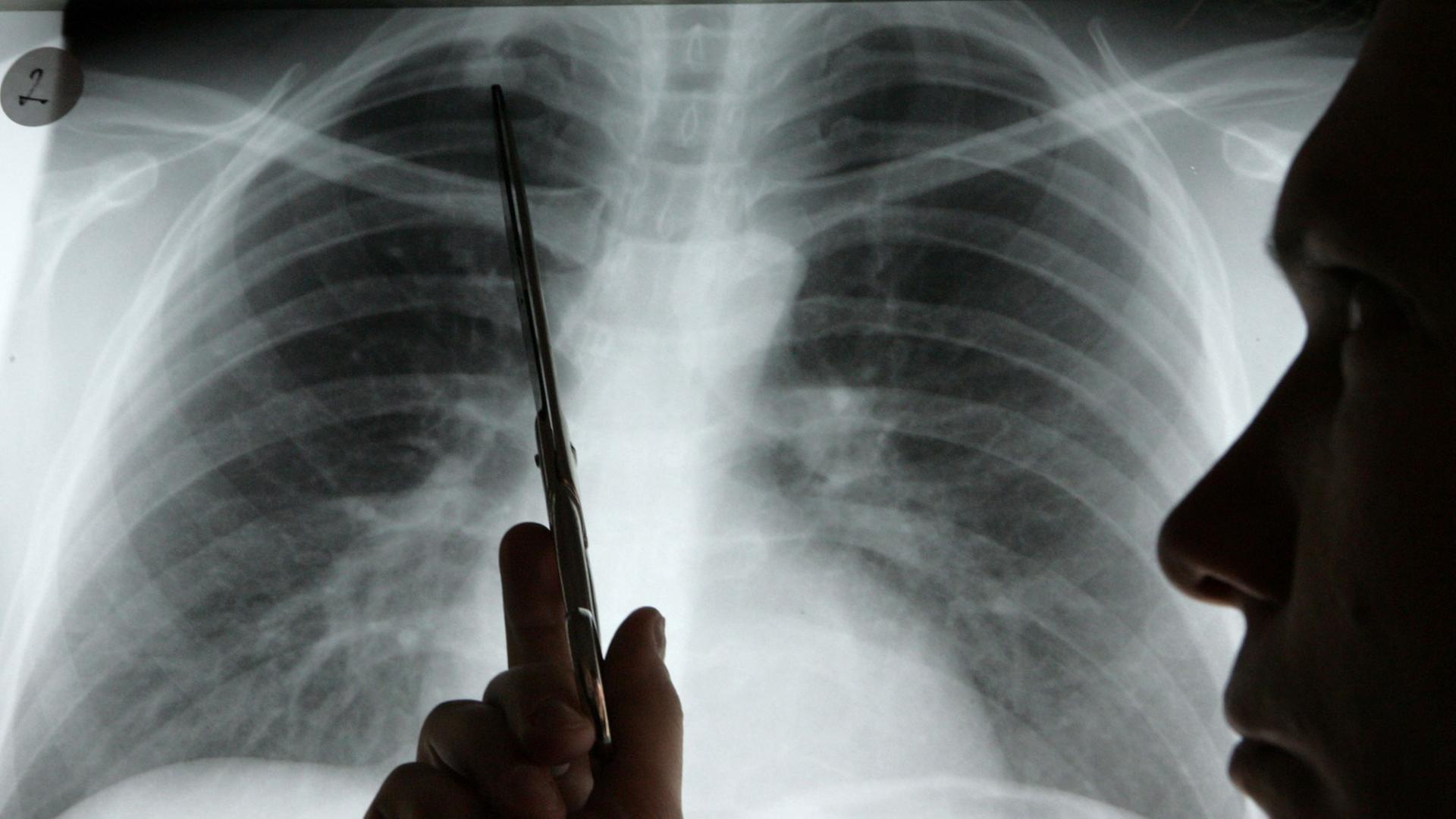
Fritz Andersen: "2011 erfuhr ich: Ich hatte einen Tumor in der linken Gehirnhälfte."
Larry Hegland: "Ich habe viele Male gebetet, Gott möge mein Leben beenden."
Stacy Erholtz: "Evan war der Tumor mitten auf meiner Stirn."
Viren machen Menschen krank. Dabei bestehen sie im Wesentlichen aus ein bisschen genetischem Code. Sie dringen in Zellen ein und programmieren sie um. Seit ein paar Jahren versuchen Wissenschaftler, diese Zellenkiller gegen einen anderen Killer einzusetzen – gegen Krebs. "Das hat eine längere Vorgeschichte als viele Leute glauben", sagt Christian Buchholz vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen. "Es gab schon vor Jahrzehnten Beobachtungen von spontan heilenden Tumoren, die dann im Nachhinein mit Virusinfektionen in Zusammenhang gebracht worden sind, ein klassisches Beispiel ist etwa ein Burkitt-Lymphom.
Von diesem Fall aus Afrika erzählt auch Guy Ungerechts vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg: "Von einem Jungen, der einen aggressiv wachsenden Tumor im Augenbereich hatte und zeitgleich eine Masernvirus-Wildtypinfektion durchgemacht hat, ansonsten völlig unbehandelt war, und der Tumor ist tatsächlich kleiner geworden zeitgleich mit dieser Masernvirusinfektion. In den 1950er-Jahren - weder Chemo- noch Strahlentherapie waren entdeckt - begannen Ärzte, mit Viren gegen Tumoren zu experimentieren - ethisch nicht unbedingt einwandfrei aus heutiger Sicht: "Ärzte nahmen Körperflüssigkeiten von Patienten, deren Krebs zurückgegangen war, reinigten sie minimal auf und behandelten Krebspatienten damit", sagt Roberto Cattaneo von der Mayo-Klinik in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota.
Doch der Erfolg blieb aus. Kevin Harrington vom Institute of Cancer Research der Universität London: "Diese Studien schlugen fehl, vor allem weil die Technologie, um Viren wachsen zu lassen, aufzureinigen und zu Medizinprodukten zu verarbeiten, einfach nicht existierte."
Beispiel eins: Das Masernvirus
Als in den 1960er- und 1970er-Jahren Chemo- und Strahlentherapie aufkamen, flaute das Interesse an den onkolytischen Viren ab. Erst mit der Zeit zeigte sich, dass die neuen Therapien bei manchen Krebsarten und einigen Patienten versagen. Diese Patienten sind austherapiert. Damit verbrämen die Ärzte, dass sie alles probiert haben, was es auf dem Markt gibt. Für diese Patienten suchte man einen neuen Hoffnungsschimmer. Anfang der 1990er-Jahre war die Gentechnik soweit, dass Forscher die onkolytischen Viren weiterentwickeln und seit kurzem auch klinische Studien starten konnten. Drei Beispiele:
Das Masernvirus: "Evan war der Tumor mitten auf meiner Stirn, nicht zu übersehen, wie ein Golfball. Meine Kinder hatten ihn Evan genannt, weil Plasmazytom war einfach zu viel Blablabla. Immer wenn Evan auftauchte, wusste ich, dass der Krebs zurückgekehrt war. Noch ehe irgendwelche Tests anschlugen" Stacy Erholtz litt unter einem Multiplen Myelom. Dieser Krebs bildet überall im Köper kleine Geschwulst, vor allem aber im Knochenmark. Die Plasmazellen, also jene Zellen, die Antikörper gegen Krankheitserreger bilden, vermehren sich bösartig. Damit nicht genug: Sie bringen nur wirkungslose Antikörper hervor. Und sie verdrängen die gesunden Plasmazellen. Das setzt die Immunabwehr außer Gefecht, sagt Roberto Cattaneo: "Diese Patienten haben sehr wenig Antikörper gegen welche Art von Virenpartikel auch immer. Gerade darum waren sie gute Ziele für unsere Therapie mit onkolytischen Viren."
Die Ärzte verabreichten die Viren systemisch, also über die Blutbahn. Bei gesunden Menschen würde das Immunsystem die Krankheitserreger binnen kürzester Zeit eliminieren - noch ehe sie ihre Arbeit erledigen können. Nur wenige Patienten nahmen an dieser Phase-1-Studie teil. Die Forscher wollten erst einmal herausfinden, wie viel Masernviren ein Mensch überhaupt verträgt. Sie begannen also mit niedrigen Dosen und steigerten sie immer weiter. Im Juni 2013 war Stacy Erholtz an der Reihe. Catteneo: "Sie erhielt eine sehr hohe Dosis vom Masernvirus-Impfstoff, den wir ein wenig verändert hatten. Sie gehörte zu den ersten Patienten, die die maximale Dosis erhielten - die Menge hätte gereicht, um zehn Millionen Kinder zu impfen."
Viren docken über bestimmte Proteine auf der Oberfläche von Zellen an. Die Krebszellen des Multiplen Myeloms haben besonders viele dieser Proteine. Die Masernviren befallen sie also bevorzugt.
Das Masernvirus, das man Stacey Erholtz gegeben hatte, war das gleiche, mit dem wir unsere Kinder impfen - mit einer Ergänzung. Cattaneo: "Mein Kollege Steve Russell hatte die Idee, einen Natriumjodit-Symporter in das Masernvirus einzubauen. Damit bringt das Virus infizierte Zellen dazu, Jodit aufzunehmen. Das macht die Zellen in der Computertomographie sichtbar. Wir konnten verfolgen, dass sich das Virus tatsächlich in den Tumoren vermehrte. Bei früheren Versuchen war niemand in der Lage zu sagen, ob der Krebs wirklich wegen des Virus verschwunden war. Mit dem Symporter ging das."
40 Minuten dauerte die Infusion. Stacy Erholtz erzählte davon später im Mayo-Klinik-Radio: "Ich fühlte von der ersten Minute an, dass etwas passierte. Nach kurzer Zeit begannen diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Ich dachte, mein Kopf würde explodieren. Und ich bekam einen seltsamen Husten. Wir stoppten die Infusion kurz, ich bekam ein Mittel gegen den Husten, und auch die Kopfschmerzen ließen nach. Ich wollte weitermachen. Kaum war die Infusion zu Ende, ging es mir wieder gut." Stacy Erholtz' Immunsystem wachte auf und kämpfte gegen die Erreger und die infizierten Zellen - mit entsprechenden Symptomen. Zwei Stunden nach der Infusion bekam sie Schüttelfrost, hohes Fieber, ihr wurde übel. Sie durchlebte eine furchtbare Nacht, dann verschwanden die Nebenwirkungen. Erholtz: "Es war schrecklich, aber es war bei weitem die einfachste Behandlung, die ich je hatte."
Das Masernvirus, das man Stacey Erholtz gegeben hatte, war das gleiche, mit dem wir unsere Kinder impfen - mit einer Ergänzung. Cattaneo: "Mein Kollege Steve Russell hatte die Idee, einen Natriumjodit-Symporter in das Masernvirus einzubauen. Damit bringt das Virus infizierte Zellen dazu, Jodit aufzunehmen. Das macht die Zellen in der Computertomographie sichtbar. Wir konnten verfolgen, dass sich das Virus tatsächlich in den Tumoren vermehrte. Bei früheren Versuchen war niemand in der Lage zu sagen, ob der Krebs wirklich wegen des Virus verschwunden war. Mit dem Symporter ging das."
40 Minuten dauerte die Infusion. Stacy Erholtz erzählte davon später im Mayo-Klinik-Radio: "Ich fühlte von der ersten Minute an, dass etwas passierte. Nach kurzer Zeit begannen diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Ich dachte, mein Kopf würde explodieren. Und ich bekam einen seltsamen Husten. Wir stoppten die Infusion kurz, ich bekam ein Mittel gegen den Husten, und auch die Kopfschmerzen ließen nach. Ich wollte weitermachen. Kaum war die Infusion zu Ende, ging es mir wieder gut." Stacy Erholtz' Immunsystem wachte auf und kämpfte gegen die Erreger und die infizierten Zellen - mit entsprechenden Symptomen. Zwei Stunden nach der Infusion bekam sie Schüttelfrost, hohes Fieber, ihr wurde übel. Sie durchlebte eine furchtbare Nacht, dann verschwanden die Nebenwirkungen. Erholtz: "Es war schrecklich, aber es war bei weitem die einfachste Behandlung, die ich je hatte."
Die Ärzte an der Mayo-KliniK konnten im CT verfolgen, wo ihre Masernviren zu Werke gingen. Stacey Erholtz aber brauchte nur Evan zu beobachten: "36 Stunden nachdem ich die Maserndosis erhalten hatte, war Evan verschwunden. Und einen Monat später, zum Nationalfeiertag am 4. Juli hatte ich so viel Energie, wie seit Ewigkeiten nicht mehr." Cattaneo: "Nach der Behandlung begann der Krebs aus ihrem Körper zu verschwinden. Der Tumor auf ihrer Stirn kehrte ein paar Monate später zurück, aber der konnte diesmal bestrahlt werden. Seitdem ist sie frei von Krebs."
Ungerechts: "Man konnte auch in dieser Studie sehr gut sehen, dass dort viel viel hilft." Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Das war eine winzige Studie. Gerade einmal fünf Patienten erhielten die maximale Masernvirusdosis. Lediglich bei einer zweiten Patientin schlug die Therapie an. Doch bei ihr kehrte der Krebs zurück. Und auch bei Stacy Erholtz haben die Forscher den Verdacht, dass etwas hinter dem Verschwinden des Krebses steckt, das sie noch nicht kennen. Es gibt noch ein Problem: Die Herstellung der Masernviren ist aufwändig und sehr teuer. An der Mayo-Klinik haben die Forscher tausendmal höhere Mengen des Virus produziert als der größte Hersteller von Masernimpfstoff. 75 Liter Zellkultur herzustellen dauert vier bis fünf Monate und reicht für gerade einmal fünf Patienten.
Beispiel zwei: Das Poliomyelitis-Virus
"Die Prognose ist ziemlich schrecklich. Ich war am Boden zerstört. 50 Prozent der Betroffenen sterben binnen sechs Monaten, und nach fünf Jahren sind nur noch zwei Prozent am Leben. Es ist eine richtig schlechte Krankheit." Fritz Andersen spricht von einem Glioblastom, einem bösartigen Hirntumor, den Ärzte 2011 in seiner linken Gehirnhälfte fanden, nachdem er aus heiterem Himmel einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Der heute 73-Jährige wurde am Krankenhaus der Duke University in Durham im US-Bundesstaat North Carolina behandelt. Erst schnitten die Ärzte ihm den Geschwulst aus dem Gehirn. Zuhause in der Nähe von Washington DC bekam er noch eine Chemotherapie. Dann stand eine Kontrolluntersuchung an: "Als ich zur Duke University zurückkehrte, hatte der Tumor wie verrückt zu wachsen begonnen, binnen zwei Monaten auf das Vierfache. Es war offensichtlich, dass ich nicht mehr lange leben würde."
" Wenn der Tumor wiederkommt, nach der Therapie, dann sieht es ganz schlecht aus, weil diese Tumore dann wirklich auf gar nichts mehr ansprechen. Und zu diesem Zeitpunkt ist er in unseren klinischen Versuch eingetreten." Matthias Gromeier forscht seit 20 Jahren an Viren gegen Tumore. Er und seine Kollegen von der Duke University setzen auf das Poliomyelitis-Virus, den Erreger der Kinderlähmung. Fritz Andersen sollte der zweite Patient überhaupt für diese Behandlung sein: "Ich wuchs in Argentinien auf. Dort gab es 1956 eine große Polio-Epidemie, 6.000 Kinder bekamen die Krankheit. Die Schulen blieben für zwei Monate geschlossen, und wir hatten große Angst. Als Medizinstudent und später als Arzt in Buenos Aires habe ich viele Polio-Opfer gesehen: Kinder mit gelähmten Beinen oder Armen. Als man also vorschlug, mir Polio ins Gehirn zu spritzen, war mein erster Gedanke: Oh Gott, vielleicht werde ich gelähmt!"
Matthias Gromeier und seine Kollegen konnten die Sorgen ihres Patienten zerstreuen: "Sowieso befallen Polio-Viren Tumorzellen viel leichter als gesunde Zellen: "Der Poliovirusrezeptor, und das ist ein reiner Zufall, ist abnormal auf Krebszellen exprimiert, und das betrifft Hirntumorzellen, aber auch viele andere Typen von Tumorzellen, zum Beispiel Brustkrebs, Lungenkrebs, kolorektale Karzinome, Leberkrebs und so weiter, und das bedeutet, dass diese Zellen mit Poliovirus infiziert werden können."
Zusätzlich zogen die Duke-Wissenschaftler dem Erreger seinen Giftzahn: Normale Polioviren stellen in Nervenzellen toxische Proteine her. Die verursachen die Lähmungen. In ihrem therapeutischen Poliovirus mit Namen PVS-RIPO haben die Forscher das Gift-Gen durch ein harmloses Gen eines verwandten Schnupfenvirus' ersetzt. Dadurch kann PVS-RIPO in gesunden Hirnzellen nicht mehr funktionieren. Im Innern der Tumorzellen sind die Bedingungen für das Virus hingegen ideal. Gromeier: "Das macht ja Sinn, Tumorzellen wachsen schnell, die machen sehr viel Protein, und der Virus nutzt das eben aus. Es ist einfach ein Zufall, dass diese Viren ganz besonders fähig sind, ihr Genom in Proteine zu übersetzen in Tumorzellen."
Fritz Andersen ließ sich überzeugen: "Die Ärzte öffneten meinen Schädel und pumpten sechs Stunden lang die Viren in meinen Tumor. Dann zogen sie die Nadel raus - fertig. Es ging mir gut, ich hatte keine Probleme." Drei Milliliter Flüssigkeit - etwa ein Esslöffel voll. Zuerst sahen die Hirnscans schlecht aus. Andersen: "Das Tumorgewebe auf dem Bild war weiß geworden, ich machte mir Sorgen. Die Tumorzellen entzündeten sich. Der Tumor war anfangs so groß wie eine Weintraube. Die Entzündung wurde so groß wie ein Daumen und noch größer."
Fritz Andersen ließ sich überzeugen: "Die Ärzte öffneten meinen Schädel und pumpten sechs Stunden lang die Viren in meinen Tumor. Dann zogen sie die Nadel raus - fertig. Es ging mir gut, ich hatte keine Probleme." Drei Milliliter Flüssigkeit - etwa ein Esslöffel voll. Zuerst sahen die Hirnscans schlecht aus. Andersen: "Das Tumorgewebe auf dem Bild war weiß geworden, ich machte mir Sorgen. Die Tumorzellen entzündeten sich. Der Tumor war anfangs so groß wie eine Weintraube. Die Entzündung wurde so groß wie ein Daumen und noch größer."
Gromeier: "Es dauert wirklich ein Jahr oder auch länger, bis der Tumor schrumpft, wir kennen das, das hat mehrere Gründe, erst mal haben wir eine Immunreaktion, wo der Tumor scheinbar größer wird wegen der Entzündung, es ist auch so, dass totes Tumormaterial im Hirn sehr, sehr langsam abgebaut wird, und aus diesem Grund wissen wir genau, wie wir diese Bilder zu interpretieren haben."
Andersen: "Ich geduldete mich, und die Entzündung begann zu verschwinden. Und dann schrumpfte der Tumor. Jetzt ist da nur noch ein Ding, klein wie ein Reiskorn, nur noch eine Narbe."
An der Duke haben die Forscher die Viren auf Tumorzellen abgerichtet. Forscher sprechen etwas martialisch von Targeting. Andere Ansätze, die im Labor bereits getestet werden, heißen Arming und Stealthing. Auch dabei verändern die Forscher die Viren, um sie noch effektiver zu machen. Beim Arming fügen die Forscher Fähigkeiten hinzu, um Krebszellen effektiver zu töten. Beim Stealthing verstecken sie das Virus, sagt Guy Ungerechts, der in Heidelberg selbst klinische Studien vorbereitet: "Es soll sozusagen benennen, dass wir Viren bauen, die unter dem Radar, unsichtbar unter dem Radar des Immunsystems angewendet werden können."
Andere Ansätze wollen erreichen, dass befallene Zellen Prodrugs, also Vorläufermedikamente aktivieren. Ungerechts: "Der Trick ist letztendlich der, dass die infizierte Zelle das Werkzeug nämlich das Enzym hat, was diese sogenannte Prodrug spalten kann und damit aktivieren kann, dass aus dieser Prodrug eine aktive Drug wird, die dann den Tumor, die Tumorzelle dann auch töten kann. Wir haben also damit tatsächlich eine Chemovirotherapie." Und auch an der Radiovirotherapie wird gearbeitet: Über den Natriumionen-Symporter, wie ihn Roberto Cattaneo für seine Masern zum Beispiel benutzt, könnte man radioaktive Ionen in die kranken Zellen schleusen, die diese dann von Innen zerstören. Doch bis es soweit ist, wird es noch lange dauern.
Beispiel drei: Das Herpesvirus
"Ich habe viele Male gebetet, Gott möge mein Leben beenden. Ich konnte nicht glauben, dass der menschliche Körper solche Schmerzen haben kann." Larry Hegland aus dem US-Bundesstaat Utah erzählt im Blog Gephardt Daily, was ihm solche Schmerzen bereitete: Es war das Interferon, mit dem die Ärzte am Utah Huntsman Cancer Institute in Salt Lake City sein Malignes Melanom, also einen Schwarzen Hautkrebs hindern wollten zurückzukehren. Interferone sind Botenstoffe die im menschlichen Immunsystem eine Rolle spielen. Künstlich hergestellt kommen sie bei der Behandlung mehrerer Krankheiten zum Einsatz. Obwohl der Körper sie kennt, verursachen Interferone starke Nebenwirkungen. Hegland: "Nach fünf Monaten dieser Behandlung sagte ich: Ich will nicht mehr. Mir egal, wenn ich sterbe."
Auch ihm schlugen die Ärzte vor, an einer Studie mit einem onkolytischen Virus teilzunehmen. Sie arbeiteten mit einem genetisch veränderten Herpesvirus. Für den Erreger mit dem unaussprechlichen Namen Talimogene laherparepvec, kurz T-VEC, hatte der amerikanische Pharmakonzern Amgen die Entwicklung so weit vorangebracht, dass Studien zur Sicherheit und zur Effektivität schon abgeschlossen waren. "T-VEC ist ein Virus, das in der natürlichen Form eine akute Infektion der Mundschleimhaut und der Lippen hervorrufen kann, mit wiederkehrenden Fieberbläschen." Kevin Harrington vom Institute of Cancer Research an der Universität London ist einer der Studienleiter. Drei Veränderungen haben die Forscher am Herpesvirus vorgenommen, um T-VEC zu schaffen: "Wir haben T-VEC das Gen entfernt, mit dem es immer wieder ausbricht und diese Bläschen verursacht."
Auch ihm schlugen die Ärzte vor, an einer Studie mit einem onkolytischen Virus teilzunehmen. Sie arbeiteten mit einem genetisch veränderten Herpesvirus. Für den Erreger mit dem unaussprechlichen Namen Talimogene laherparepvec, kurz T-VEC, hatte der amerikanische Pharmakonzern Amgen die Entwicklung so weit vorangebracht, dass Studien zur Sicherheit und zur Effektivität schon abgeschlossen waren. "T-VEC ist ein Virus, das in der natürlichen Form eine akute Infektion der Mundschleimhaut und der Lippen hervorrufen kann, mit wiederkehrenden Fieberbläschen." Kevin Harrington vom Institute of Cancer Research an der Universität London ist einer der Studienleiter. Drei Veränderungen haben die Forscher am Herpesvirus vorgenommen, um T-VEC zu schaffen: "Wir haben T-VEC das Gen entfernt, mit dem es immer wieder ausbricht und diese Bläschen verursacht."
Ohne dieses Gen kann sich der Erreger in gesunden Zellen gar nicht mehr vermehren. Denn gesunde Zellen verhindern mit Interferon, dass Viren aktiv werden. Krebszellen aber fehlt die Interferonantwort.
Als zweites entfernten die Forscher das Gen, mit dem sich Herpesviren vor dem Immunsystem verstecken. Auch das hat fatale Folgen für den Krebs: Denn damit macht das Virus die Tumorzellen, die es infiziert, sichtbar. Harrington: "Schließlich haben wir dem Virus noch ein Gen für das menschliche Protein GM-CSF eingesetzt. Es regt das Immunsystem an. Wir haben also ein Virus, das spezifisch Krebszellen infiziert und tötet, das sich nicht vor dem Immunsystem verstecken kann und das zusätzlich das Immunsystem des Patienten aufweckt. Die Idee ist, mit dieser lokalen Therapie einen Effekt im ganzen Körper des Patienten auszulösen. Und unsere Studien haben sehr deutlich gezeigt, dass uns genau das gelingt."
Hautkrebs eignet sich gut für diese Therapie mit T-VEC, weil auch dieses onkolytische Virus direkt in die Tumoren hineingespritzt werden muss, zweimal im Abstand von mehreren Wochen. Larry Hegland hatte am rechten Unterarm drei Geschwülste, jedes so groß wie eine Murmel: "Da drin ist es wirklich sehr empfindlich. Wenn sie die Viren hineinspritzen, sticht es, und wie es sticht!" Danach bekam der 63jährige hohes Fieber. "Ich habe gefroren, meine Zähne klapperten. Mir wollte gar nicht wieder warm werden! Ich saß da in warme Decken gewickelt, eine Decke über dem Kopf, und ich hielt es nicht aus. So sehr fror ich. Als jedoch nach einer Weile das Fieber nachließ, fühlte ich mich großartig. Keine Schmerzen. Nichts." Hegland hat vier Fotos von seinem Unterarm, aufgenommen im Abstand von jeweils einem Monat. Die Geschwülste schrumpften.
T-VEC wurde bereits in Phase-3-Studien an Patienten in den Vereinigten Staaten und Großbritannien getestet. 496 Patienten wie Larry Hegland mit unterschiedlichen Stadien des Schwarzen Hautkrebses haben an Kevin Harringtons Studie teilgenommen. Zwei Drittel der Teilnehmer wurden in die Gruppe mit T-VEC gelost, ein Drittel erhielt lediglich das Abwehrprotein GM-CSF - als Kontrolle. Harrington: "Insgesamt sprach der Krebs bei 26 Prozent der Patienten auf T-VEC an. Wo wir lediglich GM-CSF gegeben hatten, lag dieser Wert bei sechs Prozent. Es gab also einen aussagekräftigen Unterschied. Patienten, die als erste Therapie gegen ihren Krebs T-VEC erhalten hatten, überlebten sogar doppelt so lange wie die in der Vergleichsgruppe. Das zeigt uns deutlich, dass T-VEC sowohl gegen den Krebs wirkt, als auch das Überleben verlängert."
Als zweites entfernten die Forscher das Gen, mit dem sich Herpesviren vor dem Immunsystem verstecken. Auch das hat fatale Folgen für den Krebs: Denn damit macht das Virus die Tumorzellen, die es infiziert, sichtbar. Harrington: "Schließlich haben wir dem Virus noch ein Gen für das menschliche Protein GM-CSF eingesetzt. Es regt das Immunsystem an. Wir haben also ein Virus, das spezifisch Krebszellen infiziert und tötet, das sich nicht vor dem Immunsystem verstecken kann und das zusätzlich das Immunsystem des Patienten aufweckt. Die Idee ist, mit dieser lokalen Therapie einen Effekt im ganzen Körper des Patienten auszulösen. Und unsere Studien haben sehr deutlich gezeigt, dass uns genau das gelingt."
Hautkrebs eignet sich gut für diese Therapie mit T-VEC, weil auch dieses onkolytische Virus direkt in die Tumoren hineingespritzt werden muss, zweimal im Abstand von mehreren Wochen. Larry Hegland hatte am rechten Unterarm drei Geschwülste, jedes so groß wie eine Murmel: "Da drin ist es wirklich sehr empfindlich. Wenn sie die Viren hineinspritzen, sticht es, und wie es sticht!" Danach bekam der 63jährige hohes Fieber. "Ich habe gefroren, meine Zähne klapperten. Mir wollte gar nicht wieder warm werden! Ich saß da in warme Decken gewickelt, eine Decke über dem Kopf, und ich hielt es nicht aus. So sehr fror ich. Als jedoch nach einer Weile das Fieber nachließ, fühlte ich mich großartig. Keine Schmerzen. Nichts." Hegland hat vier Fotos von seinem Unterarm, aufgenommen im Abstand von jeweils einem Monat. Die Geschwülste schrumpften.
T-VEC wurde bereits in Phase-3-Studien an Patienten in den Vereinigten Staaten und Großbritannien getestet. 496 Patienten wie Larry Hegland mit unterschiedlichen Stadien des Schwarzen Hautkrebses haben an Kevin Harringtons Studie teilgenommen. Zwei Drittel der Teilnehmer wurden in die Gruppe mit T-VEC gelost, ein Drittel erhielt lediglich das Abwehrprotein GM-CSF - als Kontrolle. Harrington: "Insgesamt sprach der Krebs bei 26 Prozent der Patienten auf T-VEC an. Wo wir lediglich GM-CSF gegeben hatten, lag dieser Wert bei sechs Prozent. Es gab also einen aussagekräftigen Unterschied. Patienten, die als erste Therapie gegen ihren Krebs T-VEC erhalten hatten, überlebten sogar doppelt so lange wie die in der Vergleichsgruppe. Das zeigt uns deutlich, dass T-VEC sowohl gegen den Krebs wirkt, als auch das Überleben verlängert."
Nur ein Viertel der Patienten sprach auf eine Behandlung mit dem Virus an. T-VEC ist also kein Wundermittel. Doch Harrington und seine Kollegen haben noch einige Ideen, wie sie die Wirkung weiter verbessern können. Larry Hegland gehört schon jetzt zu den Glücklichen. Er hat nur dunkle Flecken von seinen Tumoren zurückbehalten, Narben: "Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, als man mir sagte, ich sei ohne Krebs. Das hat mich umgehauen, weil ich so lange damit hatte kämpfen müssen."
Buchholz: "Es sind alles andere als Routinearzneimittel, und es sind, das muss man auch sagen, weil immer wieder von solchen Pressemitteilungen von klinischen Studien sich natürlich die Patienten, die an einem Tumor laborieren, dass diese Patienten dann denken, das könnte mir helfen, und da muss man leider sagen, dass all diese Therapien sehr zugeschnitten sind auf eine bestimmte Klientel an Tumorpatienten und das nicht ohne weiteres übertragbar ist sofort auf andere Tumorpatienten." Und noch etwas: Zu oft schon ist in der Vergangenheit der Krebs, den neue Therapien vertrieben hatten, doch zurückgekehrt.
In vielen Fällen kehrt der Krebs zurück
Gromeier: "Wir haben Fälle in unserer Klinik gehabt, wo über zehn Jahre nach einem kompletten Verschwinden des Tumors der Tumor trotzdem zurückgekommen ist, also deswegen ist das ganz schwierig, von Heilung zu sprechen." Buchholz: "Das sind wirklich sicher zehn, fünfzehn verschiedene Virustypen, die zurzeit in klinischen Studien sind, und es kann sein, dass sich das so entwickelt, dass für Tumortyp A wird man Virustyp X finden, für Tumortyp B Virustyp Y, das es dann irgendwann basierend auf den Eigenschaften dieser Viren ganz bestimmte Tumortypen gibt, die dann mit dem einen Virus besser zu behandeln sind als mit dem anderen."
Gromeier: "Das Problem mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium ist, das Immunsystem hat aufgehört, die Tumorzellen zu bekämpfen. Ungerechts: "Das heißt, der Tumor kann wachsen, wird nicht abgeräumt. Zuständig für das Abräumen von Tumoren sind unter anderem zytotoxische T-Zellen und die werden offenbar auch vom Tumor herunterreguliert." Harrington: "In den letzten zehn Jahren haben wir zu verstehen begonnen, dass Tumorzellen dem Immunsystem entrinnen, indem sie auf ihrer Oberfläche Marker oder Proteine zeigen, die die Immunantwort gegen den Tumor unterdrückt." Das ist den Ansätzen mit den onkolytischen Viren gemeinsam, sagt Kevin Harrington vom Institute of Cancer Research in London: "T-VEC-Viren können nicht nur in Krebszellen wachsen und sie töten, sondern sie regen das Immunsystem an."
Gromeier: "Diese Krebszellen sehen nicht genauso aus wie unsere eigenen Zellen, und wenn die Virusinfektion dazukommt und eine Immunantwort stimulieren kann, dann kann es sein, dass das Immunsystem so stark stimuliert wird, dass es beginnt, die Tumorzellen als Fremdzellen zu erkennen." Harrington: "Wir reißen dem Krebs seine Tarnkappe herunter, so dass das Immunsystem ihn wieder sehen und sich mit ihm beschäftigen kann."
Krebs streut im Körper
Das ist wesentlich für den Erfolg der Behandlung. Denn Krebs streut im Körper. Er bildet Metastasen. Sie aufzuspüren, das lehren die Viren das Immunsystem. Harrington: "Wir konnten zeigen - und das ist sehr wichtig - dass der Krebs nicht nur dort verschwunden ist, wo es zu erwarten war, also wo wir Virus hineingespritzt hatten, sondern auch an anderen Stellen im ganzen Körper. Wir haben also zeigen können, dass diese Behandlung auch als Immuntherapie funktioniert hat."
Für T-Vec ist die Zulassung in den USA und Europa bereits beantragt. Harrington: "Wir erwarten die Ergebnisse noch dieses Jahr. Sobald wir die Zulassung haben, können wir T-VEC in der Behandlung nutzen." Buchholz: "Es könnte tatsächlich sein, dass wir in einem halben Jahr, in einem Jahr zum ersten Mal ein Arzneimittel auf dem Markt haben werden, das diese onkolytischen Viren enthält." Christian Buchholz ist am Paul-Ehrlich-Institut für die Zulassung solcher neuartiger Arzneimittel in Deutschland zuständig: "Das ist auf alle Fälle ein großer Erfolg, das ist ein großer Fortschritt, denn es ist ja wirklich ein ganz neuer Typ von Arzneimittel, über den wir hier reden, und das ist, denke ich, das, was die Onkologie, was die Wirkstoffforschung bei Krebspatienten wirklich voranbringt."
Cattaneo: "Sobald so ein Virus zugelassen ist, können wir es auch für andere Krebsarten ausprobieren. Das ist auch bei anderen Mitteln schon oft so gemacht worden." Harrington: "Im Prinzip könnten wir jeden Tumortypen, in den wir eine Spritze setzen können, mit T-VEC behandeln."
Cattaneo: "Sobald so ein Virus zugelassen ist, können wir es auch für andere Krebsarten ausprobieren. Das ist auch bei anderen Mitteln schon oft so gemacht worden." Harrington: "Im Prinzip könnten wir jeden Tumortypen, in den wir eine Spritze setzen können, mit T-VEC behandeln."
Patient Andersen: "Schon bald nach meiner Behandlung weckte mich meine Frau und sagte: Lass uns am Eiffelturm frühstücken gehen. Ich fragte: Wann? Sie sagte: Nächste Woche. Warum sollen wir all das Geld sparen? Lass uns eine gute Zeit haben. Und das machen wir. Wir genießen das Leben nach Kräften."
