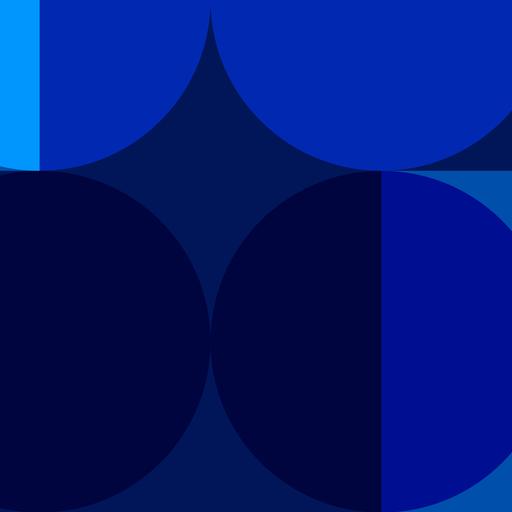Vom Rücksitz eines Motorradtaxis wirkt das Stadtviertel Nsambya wie aus der Zeit gefallen: Obwohl es mitten im Süden der ugandischen Millionenstadt Kampala liegt, fahren wir über eine Sandpiste statt über Asphalt, vorbei an Backstein-Häuschen und Wellblech-Hütten mit kleinen Läden. Bäumen fehlen die unteren Äste, weil sie als Feuerholz geschlagen wurden. Nur wenige Autos kreuzen unseren Weg, Taxen sind nirgendwo zu sehen. Wer nicht zu Fuß laufen will, muss ein Motorrad anhalten und einen Fahrpreis aushandeln.
Mein Ziel hat keine feste Adresse, aber der CD-Shop an der Ecke Hanlon-/Lukuli-Straße sei unüberhörbar, hat man mir versichert. Nun schallt Musik aus einer offenen Bude, aus der ein junger, athletischer Mann tritt, um den einzigen Weißen weit und breit zu begrüßen: Meinen Interviewpartner Angoji Jeslai hat die einheimische Hilfsorganisation YARID vermittelt, weil er dort vor kurzem einen Computer-Kurs abgeschlossen hat.
"Zuvor hatte ich noch nie einen Computer benutzt. Aber dann besuchte ich diesen Kurs und lernte, wie man verschiedene Musiktitel zusammenstellt und auf CDs brennt. Mein Lehrer brachte mir das bei. Ich bin stolz darauf, was ich jetzt so alles kann. Meine Arbeit macht mir Spaß, und von meinem Gehalt kann ich mir jetzt auch mal etwas kaufen."
Flüchtlingen: Oft wird ihnen das Recht auf Arbeit verweigert
Jeslai arbeitet in einem der Tausenden CD-Shops von Kampala: Die Kunden kommen in den Laden und bestellen die Musiken selbst. Jeslai sucht für sie die Titel im Internet, lädt sie herunter und brennt sie auf CDs: 15 Songs für umgerechnet drei Euro. In Europa würde der Shop wegen Urheberrechts-Verstößen geschlossen, aber in Afrika werden so die allermeisten Musik-CDs verkauft. Das Pressen ist eine einfache, häufig nachgefragte Arbeit, und Jeslai nur einer von vielen Verkäufern. Ungewöhnlich ist aber, dass er überhaupt arbeiten darf: Denn Jeslai ist ein Flüchtling aus dem bürgerkriegsgeplagten Nachbarland Kongo. In vielen anderen afrikanischen Ländern wird Flüchtlingen wie ihm das Recht auf Arbeit dauerhaft verweigert.
"Meine Familie ist nach Uganda geflohen, weil dieses Land für uns am schnellsten zu erreichen war. Tansania liegt zum Beispiel viel weiter weg. An der ugandischen Grenze gab es keinerlei Formalitäten: Wir waren eine große Gruppe von Flüchtlingen, und alle rannten. Die Ugander ließen uns einfach passieren. Dafür waren wir sehr dankbar. Wir wurden zuerst nach Katwe gebracht, wo wir uns ein paar Tage lang in einer Kirche ausruhen konnten. Dann brachten uns die Pastoren einer nach dem anderen zur Polizei. Die Polizisten fragten, was geschehen sei."
Auch Katwe liegt südlich des Stadtzentrums von Kampala. Das Viertel wurde zuletzt international bekannt durch den Disney-Film "Queen of Katwe", in dem sich ein einheimisches Mädchen zu einer Profi-Schachspielerin entwickelt. Auch Jeslai kennt "Queen of Katwe" – weil er gerne Hollywood-Filme schaut, spricht er mittlerweile mit US-Akzent. Damit kommt er in Uganda bestens zurecht, denn Englisch ist hier die Verkehrssprache. Im Kongo war es noch Französisch gewesen.

Der CD-Shop sieht für Europäer ziemlich aufregend aus: Er residiert in einer Garage, die nachts mit einem Eisen-Tor verschlossen wird. Hinten ist durch einen Türrahmen ein kleines Zimmer mit einer Matratze zu erkennen. Dort schläft nachts immer mindestens ein Wächter, um Räuber fernzuhalten – wie in Kampala üblich.
"Als Musiker überlebt man hier nur mit Live-Konzerten"
Vorne, zur Straße hin, arbeiten Jeslai und sein Chef an abgewetzten Resopal-Schreibtischen, immer auf der Suche nach dem nächsten Musik-Download. An den Wänden hängen Regale mit bunten Mehrfach-Steckdosen, Adaptern und Kabeln zum Verkauf. Plakate werben für Jesus Christus und preiswerte Sim-Karten. Auf den Tischen stehen Ständer mit bunt gemischten CDs: Angeboten werden alte westliche Pop-Künstler von Kiss bis Phil Collins, einheimische Legenden wie Philly Lutaaya Bongoley, aber auch junge Lokalgrößen wie Megatone. Viele afrikanische Bands akzeptieren, dass ihre Stücke schwarz kopiert werden. Faizel Bashir, ein einheimischer Musik-Manager aus Kampala, hatte mir schon tags zuvor erklärt:
"Als Musiker überlebt man hier nur mit Live-Konzerten. Ansonsten verdienen andere Leute an deiner Musik: Sie brennen sie auf CDs und verkaufen sie in der ganzen Stadt. Die Fans sehen die neuen Musikvideos zuerst im Fernsehen oder im Internet. Dann geben sie dem erstbesten Straßenhändler ein bisschen Geld und sagen: Brenn‘ mir mal diese Songs. Die Musiker kriegen dafür gar nichts. Aber immerhin wandern so ihre Lieder bis in die letzten Dörfer. Das Musikbusiness hat zwei Seiten: Du gibst, weil du die Musik liebst. Und wenn du hart arbeitest, bekommst du auch. Ein Geben und Nehmen halt."
Kampala hat heute ein vibrierendes Nachtleben, und auch auf den Straßen ist überall Musik zu hören. Das war nicht immer so: Viele denken bei Uganda immer noch an Idi Amin und dessen Gräueltaten. Doch der Diktator floh bereits vor knapp vier Jahrzehnten ins Exil, und seit 1986 regiert der aktuelle Präsident Yoweri Museveni das Land und seine Einwohner. Organisationen wie Amnesty International bescheinigen zwar auch Museveni Übergriffe, willkürliche Inhaftierungen und Folterungen, aber gleichzeitig eine deutliche Verbesserung der politischen Lage. Im Kongo herrschen dagegen weiterhin Chaos und Bürgerkrieg. Deswegen muss der CD-Verkäufer Jeslai in Kampala bleiben und kann nicht zurück in seine Heimatstadt Beni, die gleich an der Grenze zwischen den beiden Ländern liegt.
"Ich würde am liebsten nach Hause gehen, um mein Studium fortzuführen. Meine Geschwister sollten dort ganz normal zur Schule gehen und meine Mutter vielleicht einen Job bekommen. Solange wir hier bleiben müssen, sind wir dagegen auf Unterstützung angewiesen. Um einen guten Job zu bekommen, muss man Englisch sprechen und mit Computern umgehen können. Manche Einheimische mögen uns, aber manche auch nicht. Einige sagen, dass wegen Flüchtlingen wie uns die Lebensmittelpreise und die Mieten gestiegen seien. Aber ich arbeite hier doch einfach nur."
Verständnis der Politik für die Flüchtlinge
Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, leben in Uganda inzwischen 500.000 Flüchtlinge aus vielen afrikanischen Ländern, davon allein 70.000 in der Hauptstadt Kampala. Mit ihren Flüchtlingsausweisen dürfen sie arbeiten und auch Betriebe eröffnen. Das UNHCR begründet diese vorbildliche Flüchtlingspolitik mit der Geschichte des Landes: Viele Regierungsmitglieder seien früher selbst verfolgt worden und könnten deshalb die Nöte der Flüchtlinge gut verstehen.
Nsambya und viele anderen Außenbezirke von Kampala wirken luftiger als die übervölkerten Vorstädte vieler anderer Dritte Welt-Metropolen: Große Wohnkomplexe und Fabriken sind von Mauern umgeben, dazwischen liegen hier und da Gassen mit kleinen Häusern sowie Felder, auf denen Kochbananen und Kaffeepflanzen wachsen. Auf Wiesen grasen viele Ziegen, an den matschigen Ufern der Wasserkanäle laufen ein paar Schweine herum. Man kann hier besser atmen als in den Vororten vieler anderer afrikanischer Metropolen, und es weht meist eine Brise.
Auf der Fahrt zurück ins Zentrum ändert sich die Stadtlandschaft mit jedem Straßenblock: Nun sind alle Straßen asphaltiert, die Häuser und Hütten stehen viel dichter und wo noch ein Stückchen Grün zu sehen ist, wird oft Müll darauf verbrannt. Der Verkehr schwillt immer weiter an. Kampala hat eineinhalb Millionen Einwohner, und gerade scheinen alle unterwegs zu sein: Autos, Motorräder, Fußgänger - ein wildes Durcheinander.

Im Epizentrum des Getöses liegt der Owino-Markt: Er gehört zu den größten in Ostafrika - hunderttausende Menschen wirbeln dort täglich Staub auf. Reiseführer warnen vor Räubern, aber gerade sind keine da. Rucksäcke trägt man aber besser vor dem Bauch als auf dem Rücken, und wenn jemand nahe kommt, sollte man ihn genau im Auge behalten, hatte die Rezeptionistin im Hotel gewarnt. Nun sind auf dem Markt viele Träger unterwegs, die von ihren Lasten gekrümmt auf den Boden starren. Um Passanten zu warnen und notfalls auch beiseite zu schubsen, halten sie immer einen Arm weit ausgestreckt nach vorn. Wer das nicht gewohnt ist und von hinten angestoßen wird, erschreckt sich jedes Mal aufs Neue.
Solidarität unter den Flüchtlingen
Am Rande und mitten auf dem Marktgelände liegen enge Gassen mit Blech- und Steinhütten: die Unterkünfte für viele Beschäftigte. In einer Gasse finde ich Angel Fuha, die wie Jeslai aus dem Kongo floh. Das Fenster zu ihrem Zimmer steht auf, und von draußen sind zwei schmale Doppelbetten zu erkennen. Fuha wirkt zwar schüchtern, aber trotzdem klagt sie gleich zur Begrüßung über ihre Unterkunft.
"Mein Zimmer ist zu klein für vier Mädchen. Wir haben nur zwei Betten und stellen unsere Sachen darunter. Die anderen Mädchen sind jünger als ich: Sie sind 13, 14 und 16 Jahre alt. Eines der Mädchen ist allein, wie ich. Die beiden anderen haben wenigstens ihre Mutter. Aber die Mutter hilft auch mir, obwohl ich ja nicht mal aus demselben Bezirk im Kongo komme wie sie. Bevor ich irgendwo anders belästigt würde, könne ich zu ihr kommen und bei ihr leben. Sie hat ein gutes Herz. Sie ist wie eine Mutter zu mir: Wenn ich etwas brauche, besorgt sie es mir."
Fuhas Zimmer ist eher ein Verschlag, mit einem Vorhang statt einer Tür. Das Gebäude ist allerdings eines der wenigen aus Backstein, und deshalb wird es tagsüber nicht ganz so heiß wie in den Blechhütten nebenan. Schon draußen wird es mittags 35 Grad heiß. Fuha arbeitet als Näherin auf dem Owino-Markt.
"Ich muss sehen, wie ich hier irgendwie überlebe. Aber auf dem Dorf wäre es noch schwerer, ein neues Leben zu beginnen. Da bleibe ich lieber hier, obwohl ich hier auch nicht glücklich bin: Meine Nähmaschine funktioniert nicht richtig und so kann ich gerade mal ein paar Kleider pro Tag nähen. Für heute habe ich mir eine Maschine von jemand anderem geliehen. Ich bekomme nur 12 Cents für ein genähtes Kleid. Ich arbeite den ganzen Tag und gehe am Ende mit ungefähr 1,20 Euro nach Hause. Das ist fast so, als würde ich gratis arbeiten. Wenn ich endlich mal eine gute eigene Maschine hätte, käme ich besser voran und würde mehr verdienen."
Bomben, Rebellen und eine Flucht
Der Owino-Markt ist nach Zünften organisiert, wie ein mittelalterlicher Markt in Europa. Fuhas Nähstube liegt neben vielen anderen, die sich auf drei zusammenhängenden Gassen ballen und wie offene Garagen aussehen. In ihrer Stube arbeiten bereits drei andere Frauen an ihren Nähmaschinen. Fertige, sehr bunte Kleider für Frauen und Mädchen hängen dort an Wandhaken. Direkt vor der Stube stehen ein Tisch und eine Glasvitrine, an denen die Näherinnen zusätzlich frisches Gemüse, Modeschmuck und Tee aus Warmhalte-Kannen verkaufen. Die anderen Frauen tragen fröhlich-bunte, quer gestreifte Sommerkleider mit Ausschnitt und machen einen gut gelaunten Eindruck. Fuha trägt eine Stoffhose sowie ein kariertes, bis oben zugeknöpftes Hemd und wirkt traurig.
"Zu Hause im Kongo gab es viele Probleme. Jedes Mal, wenn unsere Schule bombardiert wurde, mussten wir losrennen. Danach dauerte es manchmal zwei oder drei Monate, bis wir unsere Eltern wiedergefunden hatten. Eine Zeit lang wechselten sich die Regierung und die Rebellen ab: Jeder hatte mal die Macht in unserem Stadtteil. Dann kamen eines Nachts die Rebellen, brannten unser Haus nieder und ermordeten meine Eltern. Ich rannte weg. Ein Freund meines Vaters brachte mich zur Grenze. So kam ich nach Kampala."
Dann stand Fuha damals plötzlich in der ugandischen 1,5 Millionen-Metropole. Sie sprach weder die einheimische Sprache Luganda noch die Verkehrssprache Englisch, sondern Swahili und Französisch und kam zuerst bei einem Pfarrer unter. Sie bat Flüchtlingskinder, die in eine Schule gingen, ihr ein wenig Englisch beizubringen. Dabei lernte sie ein Geschwisterpaar kennen, deren Mutter später auch Angel Fuha bei sich aufnahm. Als Näherin kommt Fuha auf einen Tageslohn von etwa 1,30 Euro: zu wenig, um sich ein eigenes Bett oder gar ein eigenes Zimmer leisten zu können.
In den Gassen mit den Nähstuben hört man vor allem Französisch mit afrikanischem Akzent: die Sprache der Flüchtlinge aus dem Kongo. Uganda hat circa 38 Millionen Einwohner, die sogenannte "Demokratische Republik Kongo" um die 80 Millionen. Der Kongo steht auf dem "Demokratieindex" des Magazins Economist auf Platz 162 von 167 Ländern, nur knapp vor Nordkorea. Rund 200.000 Kongolesen sind inzwischen nach Uganda geflohen.
Schräg gegenüber von Fuha sitzt auf der anderen Gassenseite ein Mann, der neugierig herüber schaut: Bamenjabo Sametjeri Eduard war früher im Kongo in einer Näherei der Chef gewesen. Nun gehört er hier zur Minderheit der nähenden Männer, und er ist unzufrieden:
Eine Nähmaschine als Startkapital
"Ich dachte zuerst, dass ich in Uganda vielleicht als Bauer beginnen könnte. Tatsächlich bekam ich gleich ein Stück Land zugeteilt. Aber die Probleme begannen schon beim Umgraben: Ich war das nicht gewöhnt und habe es wohl nicht gut hinbekommen. Hier spreche ich die Sprachen nicht, und die besseren Jobs haben schon andere Leute weggeschnappt. Deshalb ging ich anschließend in ein Flüchtlingslager, aber das war auch nicht so einfach: Denn dort bekommst du immer einen ganzen Monatsvorrat auf einen Schlag zugeteilt, und die Portionen reichen oft nicht über einen so langen Zeitraum. Deshalb zog ich am Ende weiter nach Kampala: Hier verdiene ich nun ein bisschen Geld mit Nähen."
In Kampala erhielt Herr Eduard von einer Hilfsorganisation eine Nähmaschine als Startkapital. Die Konkurrenz ist groß: Die Näherinnen, die neben ihm arbeiten, verstehen anscheinend sein Swahili, das nicht nur im Kongo, sondern auch in Ländern wie Burundi und Ruanda gesprochen wird. Wahrscheinlich sind sie aus einem dieser Länder hierhergekommen. Die Burunder und Ruander stellen die viert- und fünftgrößte Flüchtlingsgruppe in Uganda, gleich hinter den Somaliern. Als ehemaliger Unternehmer kam Herr Eduard wohl mit hohen Erwartungen, und nun sieht er die Lage der Flüchtlinge kritisch:
"In Uganda werden Flüchtlinge zwar begrüßt, aber nicht ausreichend versorgt: Manchmal bekommen sie in einem Flüchtlingslager Proviant mit abgelaufenem Verfallsdatum, zum Beispiel Reis, Zucker und Speiseöl. Oder verrotteten Mais. Und einige Camp-Bewohner sollen am Verhungern sein."
Sich irgendwie durchzuschlagen und dabei manchmal auch zu hungern - das passiert in Uganda und vielerorts in Afrika allerdings nicht nur Flüchtlingen: Noch zur letzten Jahreswende räumte die ugandische Regierung nach einer Dürre ein, dass mehr als eine Million der eigenen Staatsbürger vorübergehend hungern mussten. Auf dem UN-Index der menschlichen Entwicklung belegt Uganda den 164. von insgesamt 187 Plätzen. Der Gründer der Hilfsorganisation YARID, Robert Hakiza, meint deshalb:
"Auch viele Ugander müssen eine Menge erleiden: Viele arme Menschen können nicht mal zwei Mahlzeiten pro Tag essen. Vor kurzem kam sogar heraus, dass sich einige Ugander als Flüchtlinge ausgeben, um an Notrationen zu kommen."
Nun hat die ugandische Regierung angeordnet, in Notsituationen die ausländischen Flüchtlinge gemeinsam mit den einheimischen Bürgern zu versorgen – damit Flüchtlinge wie Eduard, Fuha und Jeslai weiter friedlich in Kampala leben können.