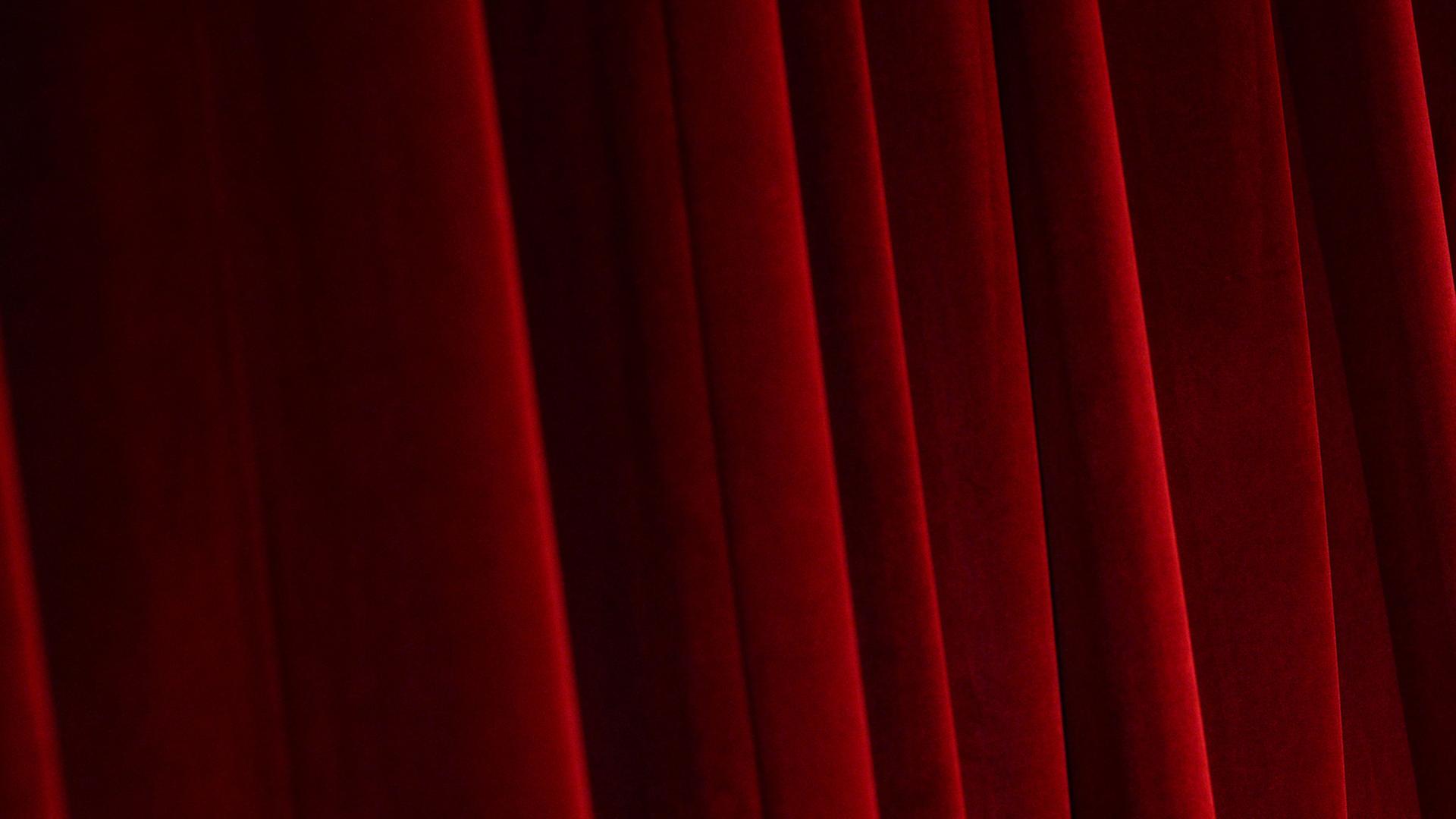
Die berühmte Toccata zu Beginn des "Orfeo" kennt fast jeder. Herrlich brausen da die Trompeten, eine Trommel sorgt für turbulente Begleitung. Im Münchner Prinzregententheater erscheinen die Musiker zunächst im Saal und schmettern dem Publikum mehrfach ein kräftiges "Gleich geht's los" entgegen. Wenig später hebt sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf eine schmutzig graue, ziemlich kahle Welt. Ein völlig heruntergekommenes Fräulein irrt umher, sie trägt zerschlissene Kleidung und hat ziemlich kaputte Flügel auf dem Rücken. Es handelt sich um die Musik höchst selbst, berichten will sie uns von einer unerhörten Geschichte.
Held im labbrigen Leinenanzug
Es geht um den Wunderbarden Orfeo, seine von einer Natter gebissene Geliebte Eurydike, die er dank seiner Sangeskünste - kurzzeitig - aus der Unterwelt befreien kann. Und bald hören wir nicht nur davon, sondern sehen, nun ja, keine fernen mythologischen Figuren, sondern handfeste Hippies, die mit einem alten VW-Bus anreisen, viel Bier und anderes konsumieren und sich heftigst amüsieren. Blumen beginnen bühnenhoch zu spriessen, man feiert Hochzeit und nur das Brautpaar ist halbwegs ordentlich angezogen. Die Braut kommt ganz in Weiss, der Gatte auch, allerdings in einem leicht labbrigen Leinenanzug.
Witz schlägt in Trauer um
Es ist tatsächlich Christian Gerhaher, den Regisseur David Bösch als überaus partyfreudigen, aber auch etwas tumben Zeitgenossen zeigt. Orfeo schnappt sich ein Mikro und legt eine wilde Performance hin, rockt seine Angebetete und auch alle weiteren Mädels, schmeisst ein Schweisstuch ins Publikum, turnt auf dem Bus herum. Später verschwindet er mit Eurydike im Bus für ein Schäferstündchen, doch daraus wird allenfalls ein Minütchen, da die Entourage sich ohne die beiden langweilt und für Störungen aller Art sorgt. So weit, so witzig. Doch dann erfährt man vom Natterbiss und plötzlich ändert sich die Temperatur des Abends gewaltig.
Der eben noch so frohe Sänger beerdigt seinen Herzensmenschen in einem rasch ausgehobenen Grab, beziehungsweise er deutet dies nur an, weil Eurydike parallel mit schweren Schritten davon schleicht. Und nun setzt Bösch doch noch auf Mythos und Metaphysik, denn die Unterwelt besteht aus üblen Gestalten. Allen voran der buchstäblich haarige Oberaufseher Pluto, dessen grimmig zotteliges Auftreten so gar nicht zu seiner Gattin Proserpina passt, die ein elektronisch aufgemotztes Glitzerkleid trägt. Beide streiten, wie mit Orfeo zu verfahren sei und man einigt sich aufs bekannte Nicht-Umdrehen-Gebot. Die Unterwelt sieht mit ihren überall herab hängenden Köpfen und projizierten Skeletten übrigens sehr nach Tim Burton aus. Christian Gerhaher gibt hier nicht nur vokal noch mal alles, gleissende Spitzentöne vermischen sich mit sanft verschatteten Rezitativen. Andrew Harris stattet den Pluto mit sattem Orgeln aus, toll auch Mauro Peter als sanftmütiger Obergott Apoll.
Im letzten Drittel zerfasert die oft atmosphärisch etwas an Shakespeares "Sommernachtstraum" erinnernde Inszenierung leider etwas, weil die Verschaltung von Mythos und 70er-Jahre-Moderne recht gewollt wirkt. Monteverdi lässt seinen Orfeo am Ende in den Himmel auffahren, David Bösch hingegen schickt ihn mitsamt seiner Gattin ins Grab. Noch einmal ziehen die glücklichen Zeiten - sowie die Partygesellschaft - an ihm vorüber, dann bleibt es der Musik überlassen, uns mit transzendenten Tönen aus dem Theater zu entlassen.
Doppelrolle als Musik und Hoffnung
Ivor Bolton stand am Pult eines ganz besonderen Klangkörpers, der Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters und des Monteverdi-Continuo-Ensembles zusammen fügte - eine gute Wahl! Die 'normalen' Instrumente wurden etwa durch Chitarronen, Regalen oder eine Lirone ergänzt. Bolton griff oft tief in die Eingeweide der Partitur hinein, das hörte sich dann schmutzig und kratzig an. Exzellent auch die Zürcher Sing-Akademie, am ergreifendsten bei den Damen nicht Anna Virovlanskys leicht über erregte Eurydike, sondern Angela Brower in ihrer Doppelrolle als Musik und Hoffnung.
Das Publikum war ausser sich, nur die Regie bekam ein paar Mini-Buhs ab.
