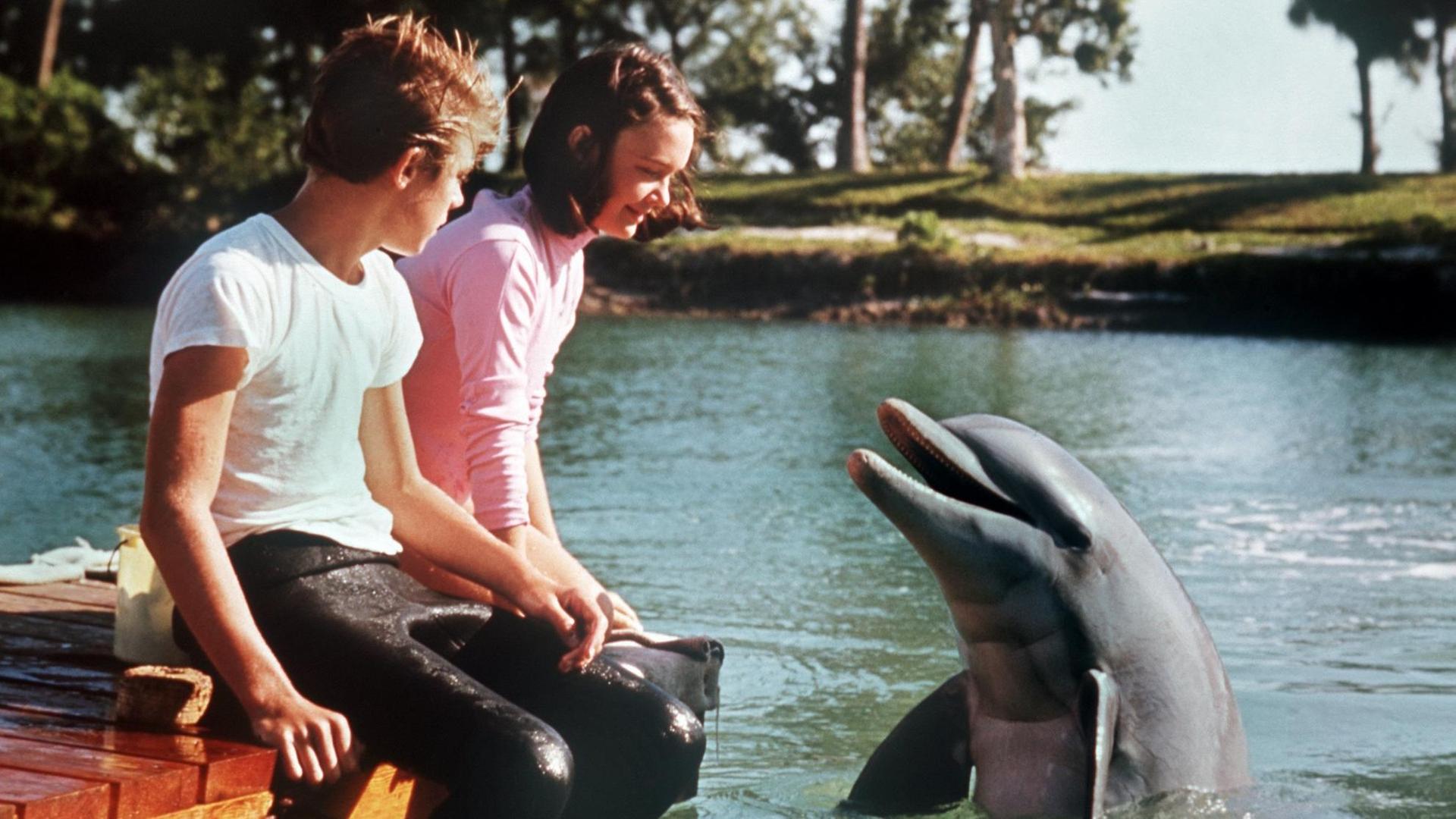Mit Ihrem Sammelband "Vom Binge Watching zum Binge Thinking" wollen der Philosoph Martin Böhnert und der Linguist Paul Reszke von der Universität Kassel zeigen, dass die wissenschaftlichen Analysen von popkulturellen Erzeugnissen durchaus mehr sind, als triviale Anbiederungen an den Zeitgeist.
Es gehe beim Binge Thinking um ein "sehr langes, konzentriertes Auseinandersetzen auf wissenschaftlicher Ebene", erklärte Martin Böhnert im Corsogespräch. Und dabei könne es eben auch um popkulturelle Phänomene gehen, beispielsweise das Binge Watching von Serien. Traditionell werde Popkultur in der Wissenschaft allerdings als trivial verortet, ergänzte Paul Reszke.
Serienwelten als Gedankenexperiment
"Wir können uns eine popkulturelle Sekundärwelt, beispielsweise die Welt von 'Game of Thrones', anschauen und mithilfe von wissenschaftlichen Theorien besser durchdringen." Für Martin Böhnert seien diese Sekundärwelten eine "Art Gedankenexperiment, um daran aktuelle wissenschaftliche Theorien oder Methoden zu erproben". Philosophische Schwergewichte wie Foucault oder Wittgenstein brauche es zwar nicht, um sich mit den genannten Popkultur-Produkten auseinanderzusetzen, aber "wenn man zum Beispiel 'Game of Thrones' mit einer bestimmten Theorie fasst, dann kommt man zu Erkenntnissen, die man vorher nicht gesehen hätte."
Wir haben noch länger mit Martin Böhnert und Paul Reske gesprochen -
hören Sie hier die Langfassung unseres Corsogespräches
In dem entsprechenden Buch-Beitrag zum Beispiel werde die Rolle der Frau in den zugrunde liegenden Romanen mit der filmischen Umsetzung in Beziehung gesetzt. Die Auseinandersetzung mit "Ghost in the Shell" setze sich beispielsweise mit unserer Technikethik auseinander, wenn man - wie in der Serie - Mensch und Maschine nicht mehr trennen könne.
Unpopuläre Wissenschaftssprache
Dass wissenschaftlich-popkulturelle Untersuchungen in einer Sprache geführt werden, die alles andere als populär ist, "ist ein Problem, das mit der Frage danach, inwiefern man Popkultur ernst nehmen kann, zusammenhängt". Es gäbe zahlreiche, spannende Auseinandersetzungen, die sich einer populären Sprache bedienten, wo dezidiert ein Laienpublikum angesprochen würde, "wenn man eine Publikation wissenschaftlich ernst nehmen möchte, dann ist man natürlich einen bestimmten, wissenschaftlichen Diskurs gebunden".
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Martin Böhnert/Paul Reszke (Hg.): Vom Binge Watching zum Binge Thinking
transcript Verlag, Bielefeld 2019. 248 Seiten, 34,99 Euro
transcript Verlag, Bielefeld 2019. 248 Seiten, 34,99 Euro