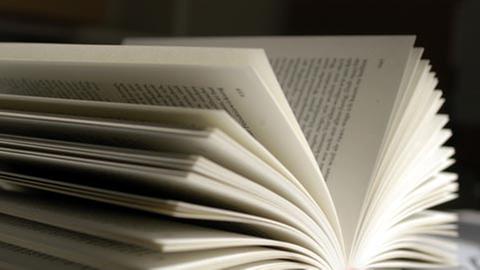Belgrad. Unweit des Zentrums ein kleiner, vom Verkehr umtoster Park. Eine Bronzebüste des Literaturnobelpreisträgers richtet ihren Blick auf einen gesichtslosen Wohnblock. Wer diesem Blick folgt, stößt bald auf eine Tür mit dutzenden Klingeln. Auf einem der Schilder steht noch immer sein Name: Ivo Andric.
Hinter der Tür ein geräumiges Treppenhaus, in dem es nach Scheuermittel riecht. Im zweiten Stock die Wohnungstür. Rasa Stanisavljevic öffnet den Besuchern die Tür. Der stille, schmale Mann mit dem lustigen Schnauzbart hütet seit mehr als 30 Jahren das Erbe des Literaturnobelpreisträgers. Seit Ivo Andrics Tod im Jahre 1975 ist dessen Wohnung Museum. Doch seit dem Zerfall Jugoslawiens ist es still geworden. Nur ab und zu verirren sich noch ein paar Gäste oder Schulklassen hierher.
"Ich versuche Schülern und anderen Besuchern ein wenig von der Atmosphäre nahe zu bringen, in der Ivo Andric gelebt und gearbeitet hat: Ich selbst bin ihm leider nie begegnet. Im Jahr von Ivo Andrics Tod studierte ich gerade Literatur."
Andrics Arbeitszimmer ist immer noch so, wie der Meister es verlassen hat. Ein Sekretär nahe dem Fenster, eine Ohrensessel zum Lesen. Beim Schreiben saß Andric mit dem Rücken zum Fenster. In einem Regal links neben der Tür sein eigenes Gesamtwerk in vielen Sprachen. Dass sich Serben, Kroaten und Bosnier einmal um die Rechte an seinen Büchern streiten könnten, wäre dem feinfühligen Andric wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen
""Da Andric selbst keine Kinder hatte, redet er in seinen Büchern selbst immer wieder von Stiftungen als etwas, das übrig bleibt vom Menschen. Er wollte sein Erbe auch von einer solchen Stiftung verwaltet wissen. Die wurde dann kurz nach seinem Tod hier in Belgrad gegründet. Und nun mehr als 35 Jahre nach seinem Tod fangen Serben, Kroaten und Bosnier an, die Rechte an seinen Büchern für sich allein zu reklamieren. Dabei war er für viele Serben nicht Serbe genug, manchem Kroaten gilt er als Verräter und nicht wenige Bosniaken betrachten ihn heute als Feind."
Rasa Stanisavljevic schüttelt den Kopf und schnalzt mit der Zunge, als ich ihn in Andrics Esszimmer frage, was der Meister wohl zu einem solchen Streit sagen würde.
"Andric war in seiner Jugend Mitglied von Mlada Bosna, einer Organisation, die sich für die Einheit aller Völker dieses Gebiets einsetzte. Er hat das geeinte Jugoslawien begrüßt. Andric hatte immer die Vision von Brücken, die zwei Ufer miteinander verbinden und Menschen zusammenführen - nicht nur in seinen Romanen."
Das ist es auch, was Rasa Stanisavljevic in dieser Wohnung als seine eigene Mission ansieht - Brücken bauen, Andrics Werk erklären, der Dummheit die Stirn bieten. Etwa jenem Besucher aus Bosnien, der behauptete, Andric würde in seinem Hauptwerk "Die Brücke über die Drina" die Bosnier als grausam und blutrünstig darstellen.
"Unsere Muslime, also die Bosniaken des früheren Jugoslawien, Ivo Andric hat nie über sie geschrieben, sondern über alle Bewohner Bosniens unter der osmanisch-muslimischen Okkupation. Neulich besuchte uns der türkische Botschafter. Er schenkte dem Museum die 22. Neuauflage der türkischen Übersetzung der 'Brücke über die Drina'. Obwohl die Türken in dem Buch nicht gerade gut wegkommen, zeigt diese Geste, wie sehr Andric dort geschätzt wird. In der Türkei! Einem Land, das Andric nicht unbedingt mochte."
Was also sollen die Besucher mitnehmen, wenn sie die Wohnung wieder verlassen? Was kann Andrics Werk Serben, Kroaten und Bosniern heute noch erzählen?
"Andric schrieb den Hauptteil seines Werkes nach dem Zweiten Weltkrieg. In einer Zeit, in der bereits Fernseher und Flugzeuge unseren Alltag bestimmten, schrieb er über eine Zeit, in der es all das noch nicht gab. Warum? Vielleicht, weil er uns sagen wollte: Egal in was für einer Welt wir leben, nicht die Technik macht uns Menschen aus, sondern unser eigenes Handeln, unser Humanismus. In diesem Sinne kann jeder in Andrics Werk auch heute noch viel Wertvolles finden. Am Schluss findet jeder das, wonach er sucht."
Hinter der Tür ein geräumiges Treppenhaus, in dem es nach Scheuermittel riecht. Im zweiten Stock die Wohnungstür. Rasa Stanisavljevic öffnet den Besuchern die Tür. Der stille, schmale Mann mit dem lustigen Schnauzbart hütet seit mehr als 30 Jahren das Erbe des Literaturnobelpreisträgers. Seit Ivo Andrics Tod im Jahre 1975 ist dessen Wohnung Museum. Doch seit dem Zerfall Jugoslawiens ist es still geworden. Nur ab und zu verirren sich noch ein paar Gäste oder Schulklassen hierher.
"Ich versuche Schülern und anderen Besuchern ein wenig von der Atmosphäre nahe zu bringen, in der Ivo Andric gelebt und gearbeitet hat: Ich selbst bin ihm leider nie begegnet. Im Jahr von Ivo Andrics Tod studierte ich gerade Literatur."
Andrics Arbeitszimmer ist immer noch so, wie der Meister es verlassen hat. Ein Sekretär nahe dem Fenster, eine Ohrensessel zum Lesen. Beim Schreiben saß Andric mit dem Rücken zum Fenster. In einem Regal links neben der Tür sein eigenes Gesamtwerk in vielen Sprachen. Dass sich Serben, Kroaten und Bosnier einmal um die Rechte an seinen Büchern streiten könnten, wäre dem feinfühligen Andric wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen
""Da Andric selbst keine Kinder hatte, redet er in seinen Büchern selbst immer wieder von Stiftungen als etwas, das übrig bleibt vom Menschen. Er wollte sein Erbe auch von einer solchen Stiftung verwaltet wissen. Die wurde dann kurz nach seinem Tod hier in Belgrad gegründet. Und nun mehr als 35 Jahre nach seinem Tod fangen Serben, Kroaten und Bosnier an, die Rechte an seinen Büchern für sich allein zu reklamieren. Dabei war er für viele Serben nicht Serbe genug, manchem Kroaten gilt er als Verräter und nicht wenige Bosniaken betrachten ihn heute als Feind."
Rasa Stanisavljevic schüttelt den Kopf und schnalzt mit der Zunge, als ich ihn in Andrics Esszimmer frage, was der Meister wohl zu einem solchen Streit sagen würde.
"Andric war in seiner Jugend Mitglied von Mlada Bosna, einer Organisation, die sich für die Einheit aller Völker dieses Gebiets einsetzte. Er hat das geeinte Jugoslawien begrüßt. Andric hatte immer die Vision von Brücken, die zwei Ufer miteinander verbinden und Menschen zusammenführen - nicht nur in seinen Romanen."
Das ist es auch, was Rasa Stanisavljevic in dieser Wohnung als seine eigene Mission ansieht - Brücken bauen, Andrics Werk erklären, der Dummheit die Stirn bieten. Etwa jenem Besucher aus Bosnien, der behauptete, Andric würde in seinem Hauptwerk "Die Brücke über die Drina" die Bosnier als grausam und blutrünstig darstellen.
"Unsere Muslime, also die Bosniaken des früheren Jugoslawien, Ivo Andric hat nie über sie geschrieben, sondern über alle Bewohner Bosniens unter der osmanisch-muslimischen Okkupation. Neulich besuchte uns der türkische Botschafter. Er schenkte dem Museum die 22. Neuauflage der türkischen Übersetzung der 'Brücke über die Drina'. Obwohl die Türken in dem Buch nicht gerade gut wegkommen, zeigt diese Geste, wie sehr Andric dort geschätzt wird. In der Türkei! Einem Land, das Andric nicht unbedingt mochte."
Was also sollen die Besucher mitnehmen, wenn sie die Wohnung wieder verlassen? Was kann Andrics Werk Serben, Kroaten und Bosniern heute noch erzählen?
"Andric schrieb den Hauptteil seines Werkes nach dem Zweiten Weltkrieg. In einer Zeit, in der bereits Fernseher und Flugzeuge unseren Alltag bestimmten, schrieb er über eine Zeit, in der es all das noch nicht gab. Warum? Vielleicht, weil er uns sagen wollte: Egal in was für einer Welt wir leben, nicht die Technik macht uns Menschen aus, sondern unser eigenes Handeln, unser Humanismus. In diesem Sinne kann jeder in Andrics Werk auch heute noch viel Wertvolles finden. Am Schluss findet jeder das, wonach er sucht."