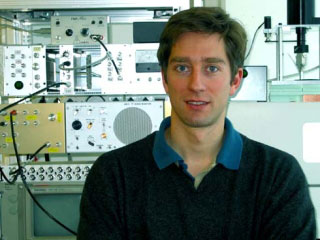Bei Zebrafinken singt jedes Männchen seine ganz eigene Melodie, und mit diesem Lied bewirbt es sich auf dem Heiratsmarkt.
Die Weibchen achten auf einen komplizierten Gesang, das heißt, was der Vogel singt, darf nicht zweisilbig sein, das muss fünfsilbig sein oder noch mehr, aber es muss stereotyp sein, das heißt jeden Tag immer das gleiche.
Bis auf die Millisekunde genau präsentiert der Zebrafink sein akustisches Aushängeschild. Richard Hahnloser, Professor vom Institut für Neuroinformatik der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, versucht herauszufinden, wie eine solche Präzision möglich ist. Vorbild für die jungen Zebrafinken ist der Gesang des Vater. In einer kurzen Lernphase prägt sich der Jungvogel diesen Gesang ein. Sein ganzes Leben lang wird er dann versuchen, die eigenen Lieder diesem Vorbild anzupassen.
Die Zebrafinken lernen einen Gesang und den behalten sie für den Rest ihres Lebens bei. Sie müssen außerordentlich viel üben, die üben während Monaten täglich bis zu mehrere tausend Mal den Gesang, dass summiert sich auf bis zu eine halbe Million auf.
Der Anfang klingt noch unbeholfen. Die Vögel vergleichen ständig den Gesang mit der Erinnerung an die väterlichen Melodie. Selbst der kleinste Fehler wird bemerkt, der Gesang variiert, bis die Melodie nach und nach immer ähnlicher ertönt. Richard Hahnloser hört den Zebrafinken nicht nur mit dem Mikrophon zu, er belauscht auch ihre Nervenzellen, um herauszufinden, wie die Vögel ihren Gesang erzeugen können. Besonders wichtig sind Neurone im oberen Gesangzentrum des Vogelgehirns.
Wir haben festgestellt, dass sich die Neurone sehr präzisere verhalten: In einer Millisekunde, das ist eine Tausendstel Sekunde, kommt die Aktivität eines Neurons immer zur gleichen Zeit. Und was besonders interessant ist, jedes einzelne Neuron ist nur einmal aktiv im Gesang und nicht zweimal. Man nennt das eine Zeitdarstellung, dass jedes Neuron einen bestimmten Moment kodiert im Gesang und nicht eine Note.
Wie gesagt, auf die Millisekunde genau. Das ist für Nerven eine kaum je erreichte Genauigkeit, die wohl nur durch das endlose Üben möglich wird. Im oberen Gesangszentrum sitzt also der Rhythmusgeber der Vogelmelodie. Alle sechs Millisekunden übernimmt hier eine andere kleine Nervengruppe den Taktstock und feuert elektrische Signale. Insgesamt ist der Nervenknoten, den Richard Hahnloser belauscht, so etwas wie der Dirigent des Vogellieds, er gibt den Einsatz für die Musiker. Die finden sich in einem benachbarten Zentrum. Hier haben die Neurone zwar kein Taktgefühl, aber sie können einzelne Klänge erzeugen, indem sie die Hals und Lungenmuskulatur des Vogels gezielt steuern. Aus Takt und Ton ergibt sich dann die Melodie.
Das Gesanglernen wird dann von der Zeitdarstellung abgebildet auf eine Notendarstellung, dass die Vögel nur noch lernen müssen, zu welcher Zeit, welche Note einzufügen. Und die Idee ist, dass diese Zeitdarstellung so universell gültig ist, das der Vogel etwas Beliebiges lernen kann, er hat die Zeitstruktur eines möglichen Gesangs gespeichert, und muss nur noch die Noten einfügen, was das gesamte Gesangslernen sehr vereinfacht.
Neben Dirigent und Musikern gibt es im Vogelhirn noch eine Kritikerstruktur, die prüft, ob der Gesang mit dem abgespeicherten Notenblatt übereinstimmt. Unermüdlich feilt der Vogel so an seiner Melodie. Selbst im Schlaf trainieren die Gesangsnerven, feuern in den Rhythmen ihres Liedes. So entsteht nach Monaten des Übens aus einem unsicheren Zwitschern die reife Melodie. Mit einem einzigen Lied kann ein Zebrafink seine Auserwählte aber nicht überzeugen. Die Weibchen haben ein scharfes Gehör. Erst wenn sie sich über Tage davon überzeugt haben, dass der Sänger immer den richtigen Takt, den richtigen Ton trifft, lassen sie sich endlich verführen. Kein Wunder, dass es für einen Zebrafinken nichts Wichtigeres gibt als seinen Gesang.
Die Weibchen achten auf einen komplizierten Gesang, das heißt, was der Vogel singt, darf nicht zweisilbig sein, das muss fünfsilbig sein oder noch mehr, aber es muss stereotyp sein, das heißt jeden Tag immer das gleiche.
Bis auf die Millisekunde genau präsentiert der Zebrafink sein akustisches Aushängeschild. Richard Hahnloser, Professor vom Institut für Neuroinformatik der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, versucht herauszufinden, wie eine solche Präzision möglich ist. Vorbild für die jungen Zebrafinken ist der Gesang des Vater. In einer kurzen Lernphase prägt sich der Jungvogel diesen Gesang ein. Sein ganzes Leben lang wird er dann versuchen, die eigenen Lieder diesem Vorbild anzupassen.
Die Zebrafinken lernen einen Gesang und den behalten sie für den Rest ihres Lebens bei. Sie müssen außerordentlich viel üben, die üben während Monaten täglich bis zu mehrere tausend Mal den Gesang, dass summiert sich auf bis zu eine halbe Million auf.
Der Anfang klingt noch unbeholfen. Die Vögel vergleichen ständig den Gesang mit der Erinnerung an die väterlichen Melodie. Selbst der kleinste Fehler wird bemerkt, der Gesang variiert, bis die Melodie nach und nach immer ähnlicher ertönt. Richard Hahnloser hört den Zebrafinken nicht nur mit dem Mikrophon zu, er belauscht auch ihre Nervenzellen, um herauszufinden, wie die Vögel ihren Gesang erzeugen können. Besonders wichtig sind Neurone im oberen Gesangzentrum des Vogelgehirns.
Wir haben festgestellt, dass sich die Neurone sehr präzisere verhalten: In einer Millisekunde, das ist eine Tausendstel Sekunde, kommt die Aktivität eines Neurons immer zur gleichen Zeit. Und was besonders interessant ist, jedes einzelne Neuron ist nur einmal aktiv im Gesang und nicht zweimal. Man nennt das eine Zeitdarstellung, dass jedes Neuron einen bestimmten Moment kodiert im Gesang und nicht eine Note.
Wie gesagt, auf die Millisekunde genau. Das ist für Nerven eine kaum je erreichte Genauigkeit, die wohl nur durch das endlose Üben möglich wird. Im oberen Gesangszentrum sitzt also der Rhythmusgeber der Vogelmelodie. Alle sechs Millisekunden übernimmt hier eine andere kleine Nervengruppe den Taktstock und feuert elektrische Signale. Insgesamt ist der Nervenknoten, den Richard Hahnloser belauscht, so etwas wie der Dirigent des Vogellieds, er gibt den Einsatz für die Musiker. Die finden sich in einem benachbarten Zentrum. Hier haben die Neurone zwar kein Taktgefühl, aber sie können einzelne Klänge erzeugen, indem sie die Hals und Lungenmuskulatur des Vogels gezielt steuern. Aus Takt und Ton ergibt sich dann die Melodie.
Das Gesanglernen wird dann von der Zeitdarstellung abgebildet auf eine Notendarstellung, dass die Vögel nur noch lernen müssen, zu welcher Zeit, welche Note einzufügen. Und die Idee ist, dass diese Zeitdarstellung so universell gültig ist, das der Vogel etwas Beliebiges lernen kann, er hat die Zeitstruktur eines möglichen Gesangs gespeichert, und muss nur noch die Noten einfügen, was das gesamte Gesangslernen sehr vereinfacht.
Neben Dirigent und Musikern gibt es im Vogelhirn noch eine Kritikerstruktur, die prüft, ob der Gesang mit dem abgespeicherten Notenblatt übereinstimmt. Unermüdlich feilt der Vogel so an seiner Melodie. Selbst im Schlaf trainieren die Gesangsnerven, feuern in den Rhythmen ihres Liedes. So entsteht nach Monaten des Übens aus einem unsicheren Zwitschern die reife Melodie. Mit einem einzigen Lied kann ein Zebrafink seine Auserwählte aber nicht überzeugen. Die Weibchen haben ein scharfes Gehör. Erst wenn sie sich über Tage davon überzeugt haben, dass der Sänger immer den richtigen Takt, den richtigen Ton trifft, lassen sie sich endlich verführen. Kein Wunder, dass es für einen Zebrafinken nichts Wichtigeres gibt als seinen Gesang.