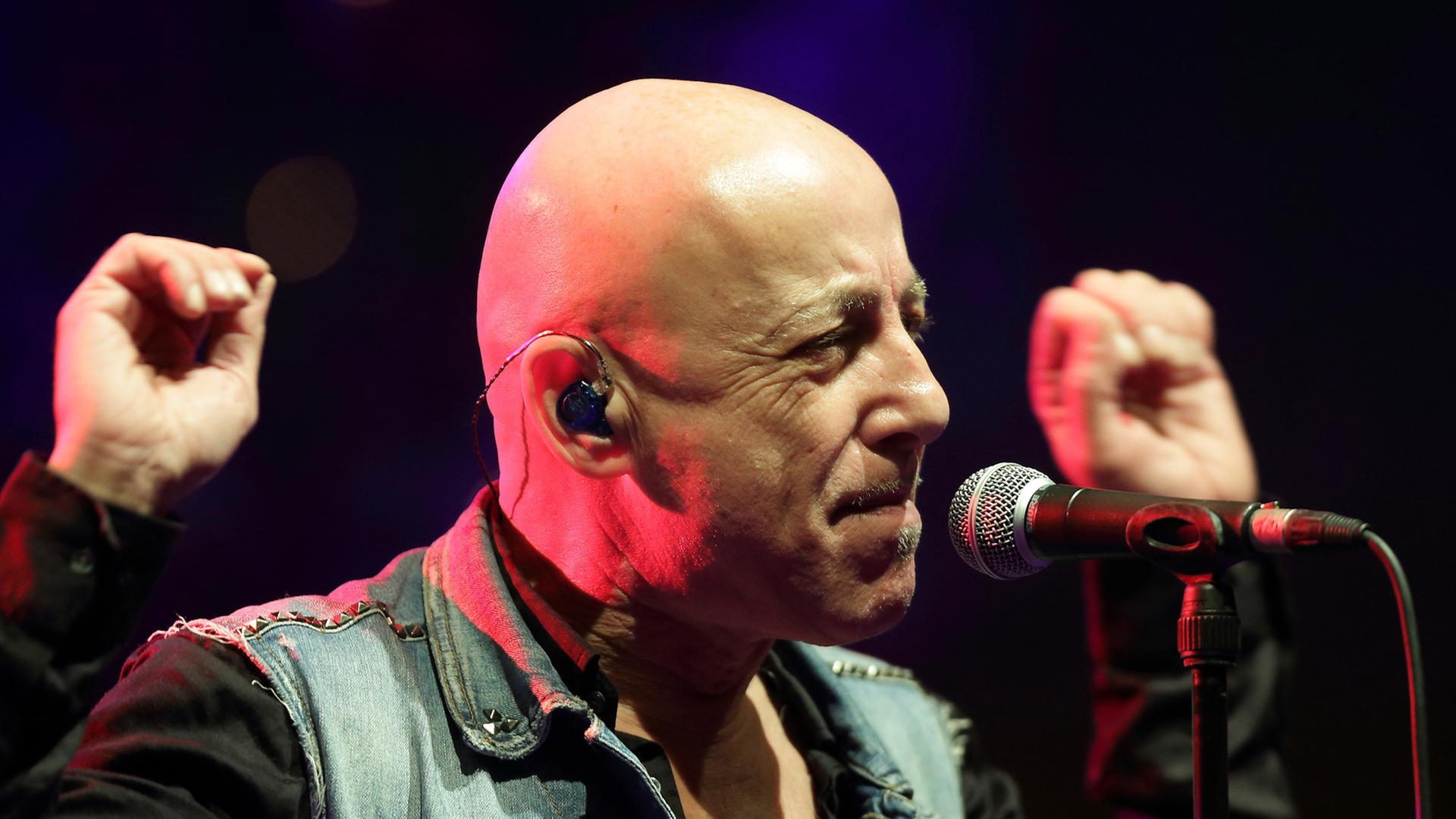"Graue Ruinen starren verblasst aus ihren toten Augenhöhlen.
Wie erstarrte Plastik, es bewegt sich nichts.
Als hätte es hier nie was gegeben in dieser Stadt."
"Der Rest" heißt die Band, "Diese Stadt" der Titel. Punk der 80er-Jahre, wie es ihn überall in Deutschland gab. Aber in Weimar, um diese Stadt geht es, im Osten, hatte Punk eine andere Bedeutung. In der DDR war Punk Widerstand nicht nur gegen die Gesellschaft, sondern auch gegen den Staat. Und der hat das auch verstanden, hat die Punks verfolgt, diskriminiert, gemaßregelt. Durch Schule, Polizei, Staatssicherheit. Deshalb gehört auch der Punk in die Ausstellung "Weimar unangepasst. Widerständiges Verhalten 1950-1989". Axel Stefek hat die Ausstellung kuratiert. Ihm war wichtig zu zeigen, dass Opposition in der DDR nicht erst 1989 begann und dass widerständisches Verhalten viele Facetten haben kann. "Nein" konnte man an vielen Stellen sagen.
"Es gab im Jahre 1968 eine Volksabstimmung, die einzige Volksabstimmung in der Geschichte der DDR. Da sollte über einen neuen Verfassungsentwurf abgestimmt werden. Und da hat ein Weimarer Hunderte Briefe verschickt mit einem Flugblatt, an alle möglichen Adressen. Das ist so ganz prägnant, da stehen nur zwei Worte drauf: "Sage NEIN". Und das kann man vielleicht sogar als Synonym auch ansehen für diese Ausstellung: "Sage NEIN". Wir hätten diese Ausstellung auch "Sage NEIN" vielleicht nennen können sogar."
Weniger konfrontativer, dafür verspielter Widerstand
In einer Vitrine liegen Dutzende der kleinen Flugblätter ausgebreitet, hergestellt 1968 im Kartoffeldruck. Die Stasi hat vergebens ermittelt. Bis heute ist der Absender nicht bekannt. Der Großteil der Ausstellung besteht aus reich bebilderten Schrifttafeln. Es geht um persönliche Schicksale der Nein-Sager. Noch in den 50er-Jahren gab es Todesurteile. 1984 wurden 17jährige zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt für dadaistisch-provokante Graffiti an Weimarer Häusern: "Wacht auf, Verdummte dieser Erde", "Wehr Dich!" oder "Schwertfische zu Pflugenten".
"Das ist ja auch eine bekannte Geschichte, hier in Weimar bekannt: "Macht aus dem Staat Gurkensalat" ist vielleicht die einprägsamste Losung derer, die da im gesamten Stadtgebiet irgendwelche Losungen, böse Losungen an den grauen, bröckelnden Putz der Häuser gesprayt haben."
Widerstand in Weimar, so zeigt die Ausstellung, war anders als in anderen Städten der DDR. Weniger konfrontativ, oft verspielt und geistvoll. Traditionsreiche Gesprächskreise statt Demonstrationen. Auch 1989. Sogar am 17. Juni 1953, als in Berlin die Arbeiter streikten und im benachbarten Jena Gefangene aus dem Gefängnis befreit wurden.
Gesprächskultur lässt sich überall wiederfinden
"Im größten Industriebetrieb hatten sich etwa 1.500 bis 2.000 Arbeiter und Angestellte versammelt und haben zunächst mal diskutiert und geredet. Und dann haben die Abgeordnete gewählt, ganz demokratisch, und einen Beschluss gefasst: Ja, wir wollen demonstrieren! Und dann wurden noch ordentlich Transparente gemalt. Und das alles hat natürlich so lange gedauert - nachmittags halb vier standen sie wohl zum Abmarsch bereit -, dass die Staatsmacht genügend Zeit hatte, das ganze Gelände zu umstellen unter Zuhilfenahme der Roten Armee damals. Also auch da: Zunächst wurde gesprochen, diskutiert. Und das ist vielleicht auch das Besondere hier in Weimar: Vor 200 Jahren hat man Weimar mal die Hauptstadt der Literatur genannt. Also, diese Gesprächskultur - die kann man sogar hier wiedererkennen!"
"Weimar unangepasst" sei erst der Beginn der Auseinandersetzung mit der jüngeren Stadtgeschichte, meint der Kurator, der Stadtarchivar in Weimar ist. Wichtig ist ihm, den Lokalaspekt zu zeigen und in einen größeren Kontext einzuordnen. Christoph Victor, der in Weimar lebt und der Stefek unterstützt hat, blickt nicht nur zurück auf die Wurzeln der 89er-Revolution, sondern auch nach vorn.
"Spannend fände ich: An welchen Wurzeln arbeiten und kratzen und nagen wir gerade für das was ..., also das wäre für mich die Essenz einer solchen Ausstellung: Wir machen ja auch gerade was, wir verhalten uns ja! Was machen wir jetzt für das, was in fünf, in zehn, in 15 Jahren passiert?"