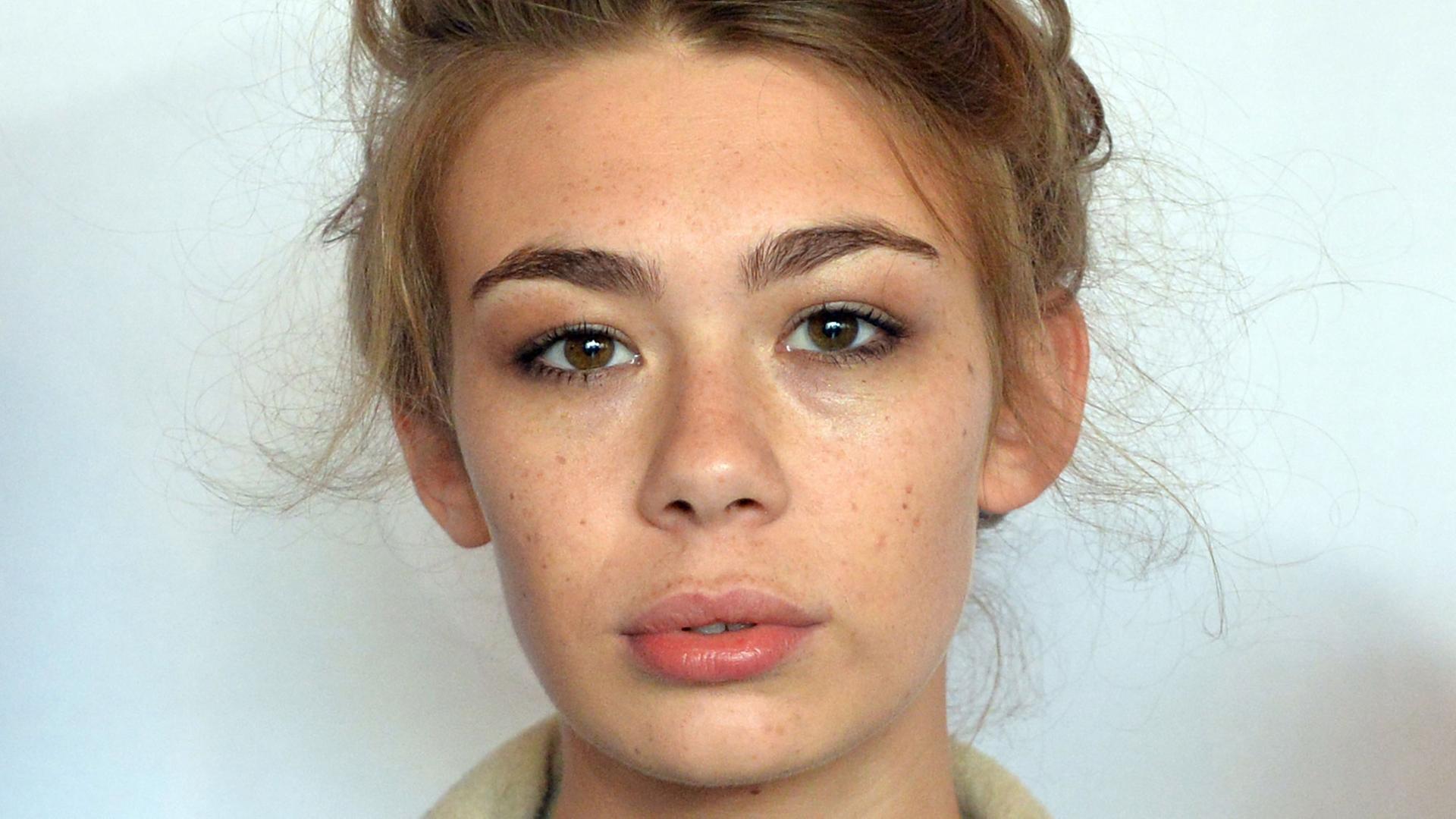
Ob die Autorin selber wohl so richtig glücklich und zufrieden war über den ersten Versuch eines Theaters mit "Wir kommen", dem Debüt-Roman der weithin wortreich gehypeten Bloggerin und Jung-Journalistin Ronja von Rönne? Oder ob sie akzeptiert hat, dass das Theater das eigene Recht eingefordert hat? Das Regie-Team um die ebenfalls junge Regisseurin Tea Kolbe hat jedenfalls den Buch-Text vernünftigerweise eingedampft auf schmale 80 Minuten und so verdichtet auf jenen Kern der Fabel, der auf der Bühne nun durchaus stärker wirkt als das auf 200 Buch-Seiten versammelte Brimborium drum herum.
Obendrein hat die Uraufführung auf der kleinsten Bühne des Staatsschauspiels in Dresden all das ignoriert, was die junge Medien-Frau zum modischen "It-Girl" am journalistisch-medialen Boulevard werden ließ, vor allem auch die wohlfeilen Grobheiten etwa zum zeitgenössischen Feminismus. Das ist dem Material ziemlich gut bekommen. Denn so nimmt nun die latente Finsternis zu im Konstrukt von Rönnes Text. Nora, die zentrale Figur, ist eingekesselt von Traumata und hat starke Depressionen entwickelt. Die Kindheitsfreundin Maja ist gerade gestorben; und noch will Nora das nicht wahr haben: "Maja ist nicht tot. Wenn sie gestorben wäre, hätte sie mir vorher Bescheid gesagt. Solche Sachen haben wir immer vorher abgesprochen. Keine Panik! Ej, wir könnten vielleicht mal was Neues machen, zum Beispiel nen Klassenkameraden entführen oder sowas."
Kampf gegen Kindheitsprägung
Als beide 13, 14 Jahre alt waren, hat Noras durchaus zu Radikalitäten neigende Partnerin Maja offenbar tatsächlich einen Jungen, vielleicht einen Schulkameraden, in einen tödlichen Unfall getrieben. Nun, mit etwa Mitte 20, begleicht sie die Schuld von damals und stürzt sich selber von derselben Brücke - überraschend für Nora, die Freundin. Deren Depressionen wurzeln vermutlich in diesem einen großen Tabubruch, dem Tod des Jungen damals. Und das Sterben der Freundin jetzt verschärft die Lage beträchtlich. Was Nora jetzt erzählt, schreibt sie zunächst auch mit Kreide auf den Bühnenboden. Im Roman geht’s um ein Tagebuch als Teil der Therapie, weil der Psychiater gerade Urlaub hat - Brimborium, kann also wegfallen.
Nora führt den Kampf gegen die frühe Prägung zudem seit einiger Zeit mit völlig untauglichen Mitteln - sie hat sich eingelassen auf ein Leben zu viert, mit Leonie, Jonas und Karl; aus dieser Lebens- und Liebes-Kommune taucht im Spiel auf der Bühne aber nur Leonie taucht, als "alter ego" sozusagen der toten Freundin Maja. Das Quartett aus dem Buch (hier nur im Erzählen herbei beschworen) ist aber fatal gestrickt - denn Noras Ex-Freund ist, mit neuer Partnerin, Teil dieser Gruppe. Das kann ja nicht gut gehen.
In der Nacht kommt die Panik
Aus dem Text heraus destilliert die Inszenierung eine dritte Figur, neben Nora und Maja: die heißt "Panik", drängt sich aber nicht per "Attacke", sondern lieblich säuselnd, schleichend, subkutan immer wieder in Noras Welt. "Es ist früher Morgen. Nora! Ich komme seit zwei Wochen - meistens nachts; begleitet von Atemnot und Herzrasen. Da liegst Du stundenlang wach – bis ich mich wieder verabschiede. Nora!" So gelingt die Verdichtung auf Noras Innenleben, aber auch durch die Bühnen-Idee von Anne-Alma Quastenberg - im Rundbau einer Art "Laterna Magica" sind die Wand-Segmente halbseitig verspiegelt; und in diesem runden Gefängnis befinden alle sich stets im Gegenüber mit dem eigenen Ich. Das klingt einfach, stärkt die Konzentration und Verdichtung des Textes aber enorm.
Und Antje Trautmann, eine der stärksten jüngeren Persönlichkeiten im Dresdner Ensemble, macht die psycho-pathologische Fokussierung auf der Bühne erlebbar; mit Lucie Emons als vielgesichtiger Maja (oder eben Leonie) sowie als "Panik" Hannelore Koch (die eine der Stützen der Dresdner Ensemble-Gesellschaft seit Jahrzehnten ist) gelangt sie an weitere Horizonte als das im Buch möglich ist. Es ist wohl so: Theater kann mehr. Weil es mehr will.

