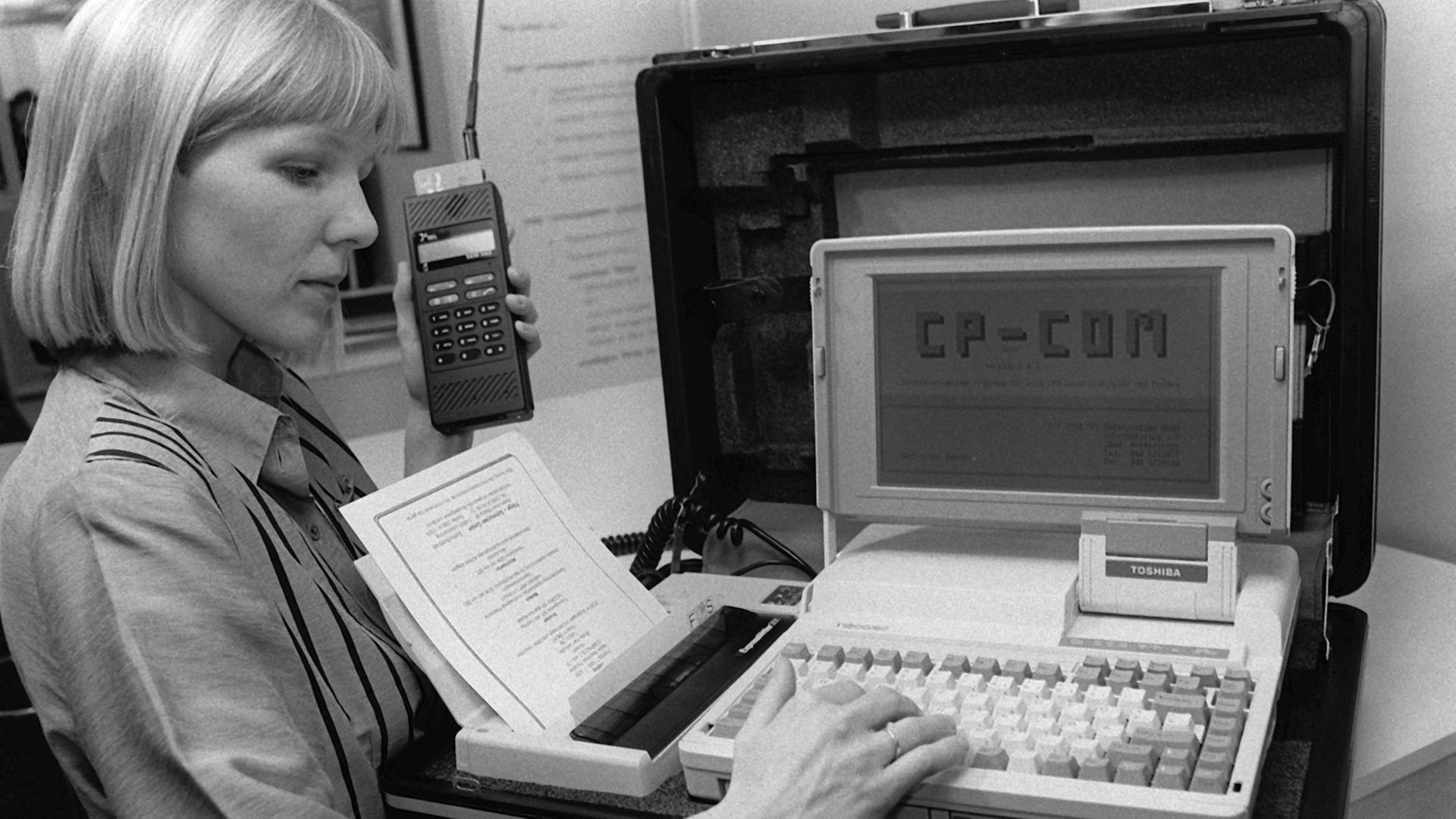Wer in sozialen Netzwerken den Like-Button drückt, mache dem Empfänger ein Geschenk, sagte Johannes Paßmann im Deutschlandfunk. Es handele sich um ein Symbol der Anerkennung. In seinem Buch "Die soziale Logik des Likes" entwirft der Medienwissenschaftler eine Twitter-Ethnografie.
"Man kennt sich nicht, es gibt aber ein Geschenk, mit dem man beginnt, und von da aus beginnt dann eine soziale Beziehung", so Paßmann. Die Praktik des Vergebens und Empfangens von Geschenken in Form von Likes sei zentral für Twitter und erkläre den Erfolg der Plattform. Sie tauche allerdings nicht nur in sozialen Medien auf, sondern sei in anderen Formen auch in vielen älteren Kulturen zu finden, wo sie als vermeintlich primitiv deklassiert werde.
Nicht in reale Begegnungen übertragbar
In Likes könne man jedoch auch viel hineinprojizieren. Die Kommunikation über Twitter ließe sich daher nicht in reale Begegnungen übertragen. Denn da sehe man "die Gesichtszüge des anderen, man sieht, wie auf einen reagiert wird, ob einem mit Respekt begegnet wird oder nicht. Daran kann man dann beobachten, dass die Online-Interaktion deswegen die ganze Zeit so gut funktioniert hat, weil sie eben vage geblieben ist und weil sie eben nicht die Face-To-Face-Interaktion nachgeahmt hat."
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Johannes Paßmann: "Die soziale Logik des Likes: Eine Twitter-Ethnografie"
Campus Verlag Frankfurt am Main, 2018. 388 Seiten, 29,95 Euro.
Campus Verlag Frankfurt am Main, 2018. 388 Seiten, 29,95 Euro.