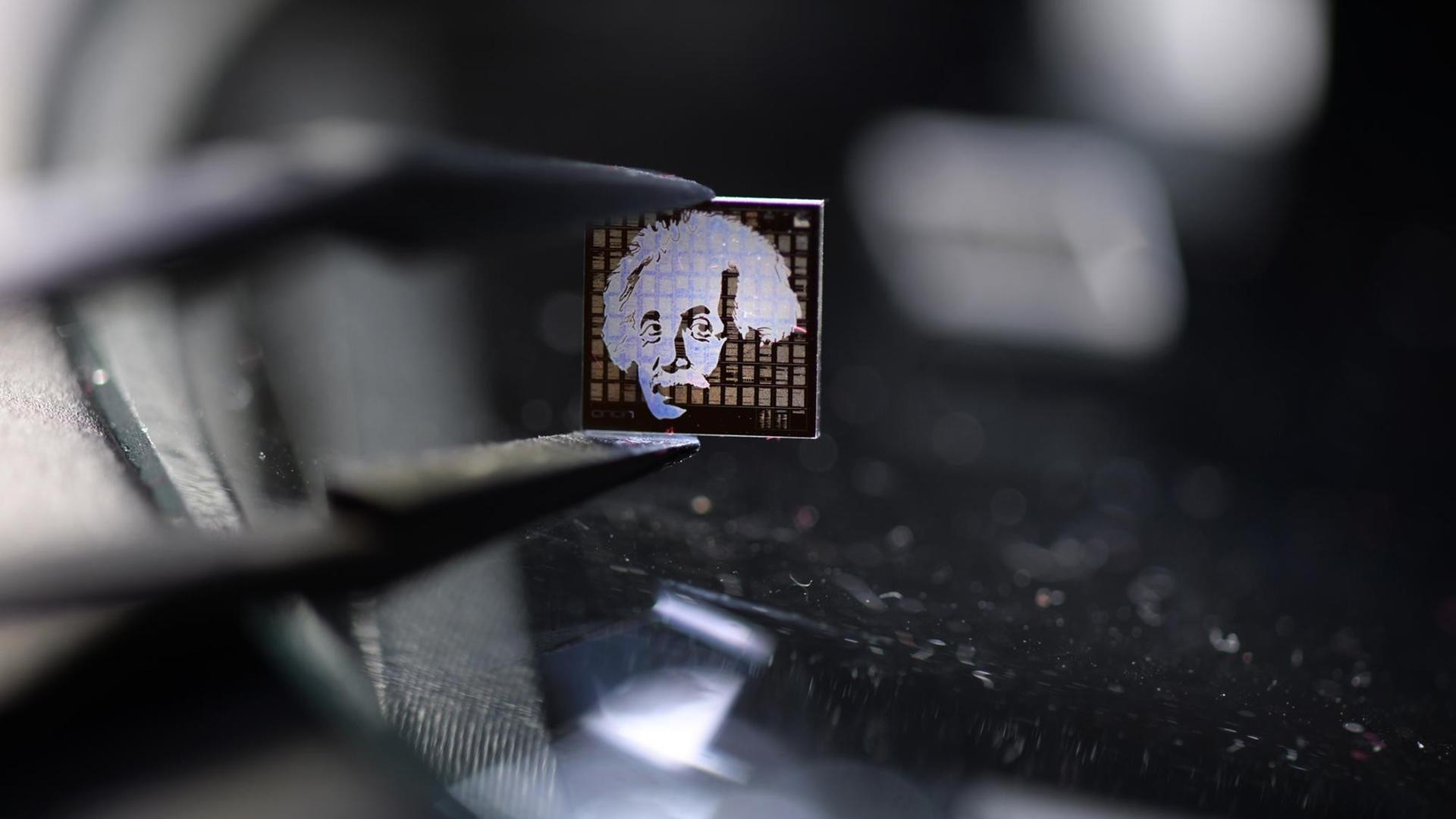LIGO Livingston Observatory. So heißt die Megamaschine eine Autostunde nördlich von New Orleans. Es ist ein Präzisionslineal aus Laserlicht, das Gravitationswellen erstmals direkt nachweisen soll. Das Hauptgebäude ist so groß wie ein Flugzeughangar.
Mike Zucker, der Physiker, der mich durch die Anlage führt, schlägt vor, erstmal aufs Dach zu steigen, um einen Überblick zu bekommen.
Die Aussichtsplattform auf dem Dach bietet perfekten Rundumblick. Niemandsland, topfeben. Wasser, Wald und Sumpf soweit das Auge reicht. Und mittendrin zwei kilometerlange Betonröhren, die im rechten Winkel auseinanderlaufen. Es sind die Messstrecken des ultrapräzisen Laserlineals.
"Wir stehen hier direkt über dem Strahlteiler, der unseren Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufspaltet. Einer davon läuft nach Westen, der andere nach Süden – jeweils vier Kilometer weit.
Am Ende der Betonröhren hängen Spiegel, die die Strahlen wieder hierher zurückschicken. Die beiden Teilstrahlen laufen dann hunderte Male zwischen den Spiegeln hin und her. Und am Ende vergleichen wir die Laufzeit der Lichtwellen in den beiden Armen."
Am Ende der Betonröhren hängen Spiegel, die die Strahlen wieder hierher zurückschicken. Die beiden Teilstrahlen laufen dann hunderte Male zwischen den Spiegeln hin und her. Und am Ende vergleichen wir die Laufzeit der Lichtwellen in den beiden Armen."
Speerspitze internationaler Forschungsarbeit
Laut Theorie sollte eine Gravitationswelle, die den Detektor passiert, die kilometerlangen Messstrecken einen Tick zusammen stauchen – und zwar um den tausendsten Teil eines Atomkerndurchmessers. Solche aberwitzig kleinen Längenänderungen messen zu wollen, galt lange als unmöglich.
Seit 2001 versuchen es die LIGO-Forscher trotzdem. Mit seinem baugleichen Pendant in Hanford, im US-Bundesstaat Washington, bildet der Detektor in Livingston die Speerspitze der internationalen Bemühungen, Gravitationswellen direkt nachzuweisen.
Seit 2001 versuchen es die LIGO-Forscher trotzdem. Mit seinem baugleichen Pendant in Hanford, im US-Bundesstaat Washington, bildet der Detektor in Livingston die Speerspitze der internationalen Bemühungen, Gravitationswellen direkt nachzuweisen.
Herzstück Detektor
Wir machen uns auf den Weg zum Herzstück der Anlage: Dem Detektor, wo die beiden reflektierten Laserstrahlen wieder zusammen treffen, nachdem sie hunderte Male in ihren Betonröhren hin und her gelaufen sind. Dabei entsteht ein Interferenzmuster, dessen Helligkeitsschwankungen verraten, ob einer der beiden Lichtarme gestaucht wurde.
Eine elektrische Schuhbürste wirbelt den Staub von unseren Sohlen. Sauberkeit ist das A und O hier. Ein Staubkorn genügt, um einen der hunderttausend Dollar teuren Spiegel unbrauchbar zu machen.
Mike Zucker drückt mir Überzieher aus blauem Plastik in die Hand. Die muss ich über die Schuhe stülpen, damit der verbliebene Staub keinen Ärger macht.
Wir gelangen in einen wohnzimmergroßen Vorraum, vollgepackt mit mannshohen Elektronikschränken. Überall Kabel und blinkende Leuchtdioden. Ein starkes Gebläse kühlt die Prozessoren.
"Die Elektronik hier kontrolliert die Position und Orientierung aller optischen Komponenten. Außerdem registriert sie alle seismischen und akustischen Ereignisse in der Umgebung. So können wir erkennen, ob ein vermeintliches Gravitationswellensignal nicht durch ganz profane Umwelteinflüsse erzeugt wurde."
Bevor es durch die Stahltür ins Allerheiligste geht, müssen wir klobige Laserschutzbrillen aufsetzen.
Dann öffnet Mike Zucker die Tür zu einer riesigen Halle, in der es erstaunlich still ist.
Kein Lüfterrauschen, keine Vakuumpumpen. Um den sensiblen Detektor nicht zu stören, wurde alles, was Krach macht, vor die Tür gesetzt.
In der Mitte des Raumes: drei große Stahltanks. Meterdicke Metallrohre verbinden sie in Kopfhöhe, laufen weiter bis zur südlichen und westlichen Hallenwand – und von dort ins Freie. Damit die intensiven Laserstrahlen darin freie Bahn haben, ist das komplette System aus Röhren und Tanks luftleer gepumpt. Mike Zucker bleibt vor dem riesigen Vakuumtank in der Mitte stehen.
In der Mitte des Raumes: drei große Stahltanks. Meterdicke Metallrohre verbinden sie in Kopfhöhe, laufen weiter bis zur südlichen und westlichen Hallenwand – und von dort ins Freie. Damit die intensiven Laserstrahlen darin freie Bahn haben, ist das komplette System aus Röhren und Tanks luftleer gepumpt. Mike Zucker bleibt vor dem riesigen Vakuumtank in der Mitte stehen.
"Wir sind jetzt genau unter der Stelle, wo wir vorhin auf dem Dach standen. In diesem Edelstahltank wird der frequenzstabilisierte infrarote Laserstrahl, den wir dort drüben in diesem Verschlag erzeugen, zweigeteilt und in die beiden 4 Kilometer langen Arme geschickt. Der Vakuumtank hat 3 Meter Durchmesser und ist 6 Meter hoch. Darin steckt ein ausgeklügeltes System zur Schwingungsdämpfung: Eine gestaffelte Anordnung von Pendeln, Federn und Edelstahlgewichten, die mehrere Tonnen wiegt und die optischen Komponenten vor Vibrationen schützt."
Suche nach verdächtigen Mustern
Nachdem wir Schutzbrillen und Plastikgamaschen wieder abgelegt haben, geht es ins Kontrollzentrum. Überall Monitore und Steuerkonsolen, an denen sechs junge Männer auf bunte Grafiken starren.
"Von hier überwachen wir alle wichtigen Parameter: die Position und Orientierung der Spiegel, die Laserfrequenz und so weiter. Außerdem laufen hier auch die Daten ein: Das digitalisierte Ausgangssignal, das wir nach verräterischen Spuren von Gravitationswellen durchsuchen."
Computerprogramme durchforsten das Detektorsignal nach verdächtigen Mustern. Gravitationswellen müssten sich durch winzige Helligkeitsschwankungen des Ausgangssignals verraten.