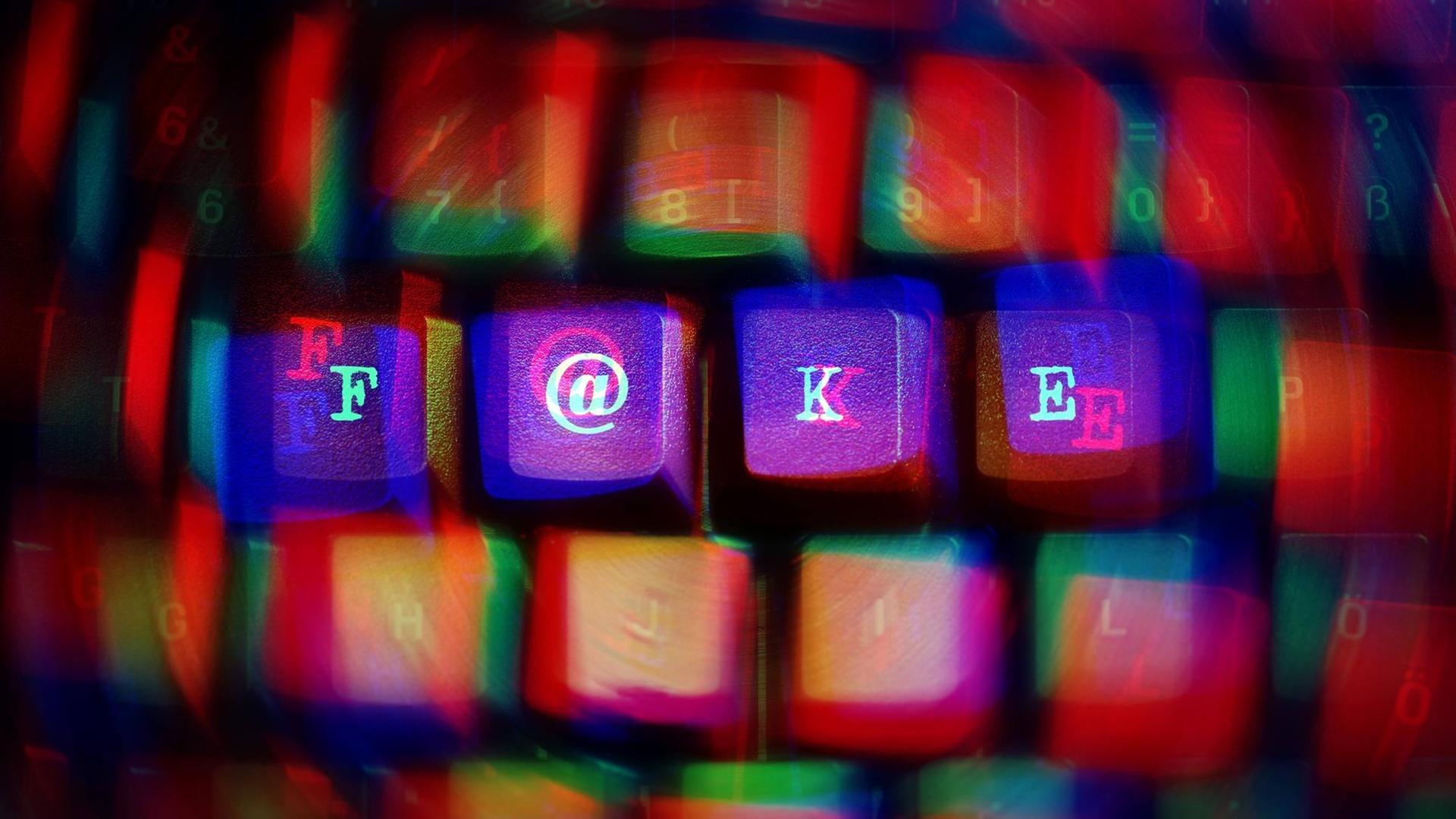Ulrike Winkelmann: Unter dem Titel "Die landläufige Meinung" haben die Deutschlandradio-Korrespondenten seit Mitte Juli jede Woche Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern zur Bundestagswahl gesammelt. Gefragt haben sie unter anderem nach dem Internet, insbesondere den sozialen Medien, also Facebook, Twitter und so weiter. Das "Dlf-Magazin" wollte wissen, ob und wie die Leute das Internet zur politischen Meinungsbildung nutzen. Und es war etwas überrascht zu hören, dass von den Befragten nur zwei Studentinnen sagten, dass sie selbst jemals - und auch nur einmal - etwas gepostet hätten. Nahezu alle anderen antworteten auf die Frage, ob sie sich schon einmal im Netz politisch beteiligt hätten, mit verschiedenen Versionen von "Nein, da wird mir zu viel gehasst", oder auch "Nein, ich lese da höchstens etwas".
Hieß es denn nicht immer: Das Internet ist der Ort, an dem die demokratische Teilhabe wirklich stattfinden kann? Führen denn nicht alle Parteien gerade ganz mächtig Online-Wahlkampf?
Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Herr Bieber, kann es sein, dass der Löwenanteil der Leute sich für den politischen Austausch im Netz gar nicht groß interessiert?
Christoph Bieber: Ganz so verblüffend finde ich das erst mal nicht. Wir sehen in vielen Fällen, dass es einen großen Teil von Menschen gibt, die Online-Inhalte erst mal nur konsumieren. Das heißt, sie lesen mit, sie verhalten sich still, sie kommentieren auch nicht, und posten, das tun sie schon mal gar nicht. Da gibt es die sogenannte 90-9-1-Regel, die eben beschreibt, dass nur der allerkleinste Teil tatsächlich aktiv Inhalte ins Netz stellt, ein etwas größerer Teil dann darauf reagiert und kommentiert, und der allergrößte Teil aber eben sich das nur anschaut. Und im Übrigen, interessant wäre ja auch die Frage, wer sich denn aktiv am Offline-Wahlkampf beteiligt, also Plakate aufhängt oder wirklich auf ein Gespräch in der Fußgängerzone eingeht. Ich glaube, das sind auch nicht so viele Menschen.
Winkelmann: Aber handelt es sich denn bei der Rede von der überragenden Bedeutung des Online-Wahlkampfes um eine rein journalistische Vorstellung?
Bieber: Das mag so sein. Wenn Sie Wissenschaftler fragen, werden die da sicherlich etwas zurückhaltender reagieren. Der Online-Wahlkampf nimmt relativ gesehen in jedem Wahlzyklus an seiner Bedeutung zu. Das heißt, es gibt mehr Angebote, es gibt unterschiedliche Kanäle, die bespielt werden, er wirkt auch immer stärker auf das Kampagnenführen der Parteien selbst ein. Aber dass er den alten Medien den Rang abgelaufen hätte, diese Meinung findet man auch im wissenschaftlichen Bereich eher nicht.
"Bestimmter Ton in der Kommunikation gefragt"
Winkelmann: Sie haben ja schon Online-Wahlkämpfe untersucht, als die sozialen Medien noch gar nicht so hießen. Gelingt den Parteien im Netz denn jetzt eine Ansprache der Wählerinnen und Wähler, die den Parteien sonst nicht möglich wäre?
Bieber: Ich glaube, dass in der Tat die Parteien verstanden haben, dass es Zielgruppen gibt, die sie über alte, traditionelle Medienkanäle gar nicht mehr erreichen können, und sie sich deshalb tatsächlich auf die Gepflogenheiten der Kommunikation in sozialen Medien einlassen müssen. Das heißt, sie sind durchaus in der Pflicht, sich mit Kanälen wie Twitter, Instagram oder Facebook auseinanderzusetzen. Natürlich sollten sie auch ein bisschen ein Auge darauf haben, welche Art von Video vielleicht häufiger angeklickt wird bei YouTube. Das sind Dinge, die gehören zur Modernisierung und Professionalisierung der Kampagnenführung dazu, und das machen die Parteien, so gut sie es eben können. Das variiert auch immer sehr stark mit den jeweils involvierten Personen, denn die Form der Öffentlichkeit, die in den sozialen Medien entsteht, ist eine, die sehr stark persönlich geprägt ist, sowohl von den Anbietern aus der Politik, wie auch von den Bürgern, die das nutzen wollen. Und da ist ein spezifischer Ton, eine bestimmte Art von Kommunikation gefragt, die nicht jedermanns oder jederfraus Sache ist.
"Eine Alters- und Generationsfrage"
Winkelmann: Können Sie sagen, welcher Partei Sache der Ton denn eher ist?
Bieber: Na, bis vor Kurzem hätte man vermutlich noch die Piraten erwähnt an dieser Stelle. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass man das pauschal für eine Partei behaupten kann, ich glaube, es ist eher eine Alters- und Generationenfrage. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Quereinsteiger, die tatsächlich dann auch als Spätberufene gewissermaßen die Online-Kommunikation gut nutzen können, aber in der Breite, glaube ich, hängt es sehr stark davon ab, mit welchen Medien ich sozialisiert worden bin und wie ich dann meinen Medienalltag gestalte.
Winkelmann: Aber ist nach all dem das Argument, dass die sozialen Medien so interaktiv sind und deshalb besonders demokratietauglich, vielleicht nur eins für die Leute, die sich sowieso immer und überall beteiligen? Also, soll heißen, dass es in der Interaktionsfreude gar nicht solche Unterschiede dann gibt, online und offline?
Bieber: Na ja, die Anwesenheit eines Rückkanals alleine trägt noch nicht zu einer Demokratisierung bei. Es braucht auch bei den digitalen Medien Routinen und Prozesse, die eine tatsächlich demokratische Kommunikation auch wirklich ermöglichen und auch die kommunizierten Inhalte dann dorthin bringen, wo sie politisch auch eine Wirkung entfalten können. Lange Zeit gab es das Problem, dass es zwar eine Online-Kommunikation gab, die aber gar nicht wirklich in die parlamentarischen Kreisläufe hineingereicht hat. Das ändert sich jetzt allmählich, weil es immer mehr Schnittstellen gibt. Die YouTube-Interviews in diesem Wahlkampf wären ein solches Beispiel. Aber das reicht natürlich noch nicht, um wirklich politische Wirkung aus den digitalen Medien in den Kernbereich der Politik dann hineinzutragen.
Winkelmann: Was müsste denn geschehen, um das zu erreichen?
Bieber: Hier fehlen noch ganz viele Routinen und Verbindungen, die tatsächlich dann eine etwas direktere Form von politischer Beteiligung ermöglichen. Das ist ein langwieriger Prozess und der findet eben zwischen den Wahlkämpfen statt. Und hier haben wir tatsächlich in Deutschland in den vergangenen Jahren häufig den Fall gehabt, dass für die Politik das Internet und die Online-Kommunikation im Wahlkampf sehr, sehr wichtig war, danach aber nicht mehr. Und das ändert sich nur sehr, sehr langsam, und ein Element kann tatsächlich mal wieder die Diskussion um die Frage eines Internetministeriums sein. Also, gibt es eine starke Struktur nach der Regierungsbildung, die sich - tatsächlich dann auch mit Ressourcen ausgestattet - um die Kultivierung eines politischen Raumes im Netz kümmert und versucht, hier tatsächlich auch in Richtung Digitalisierung zu wirken.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.