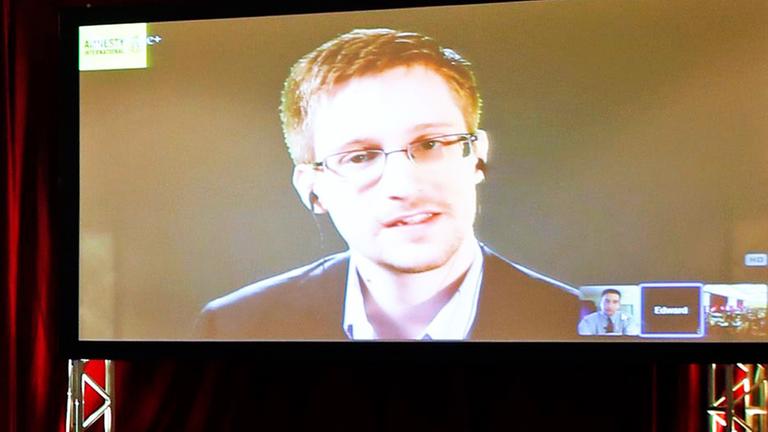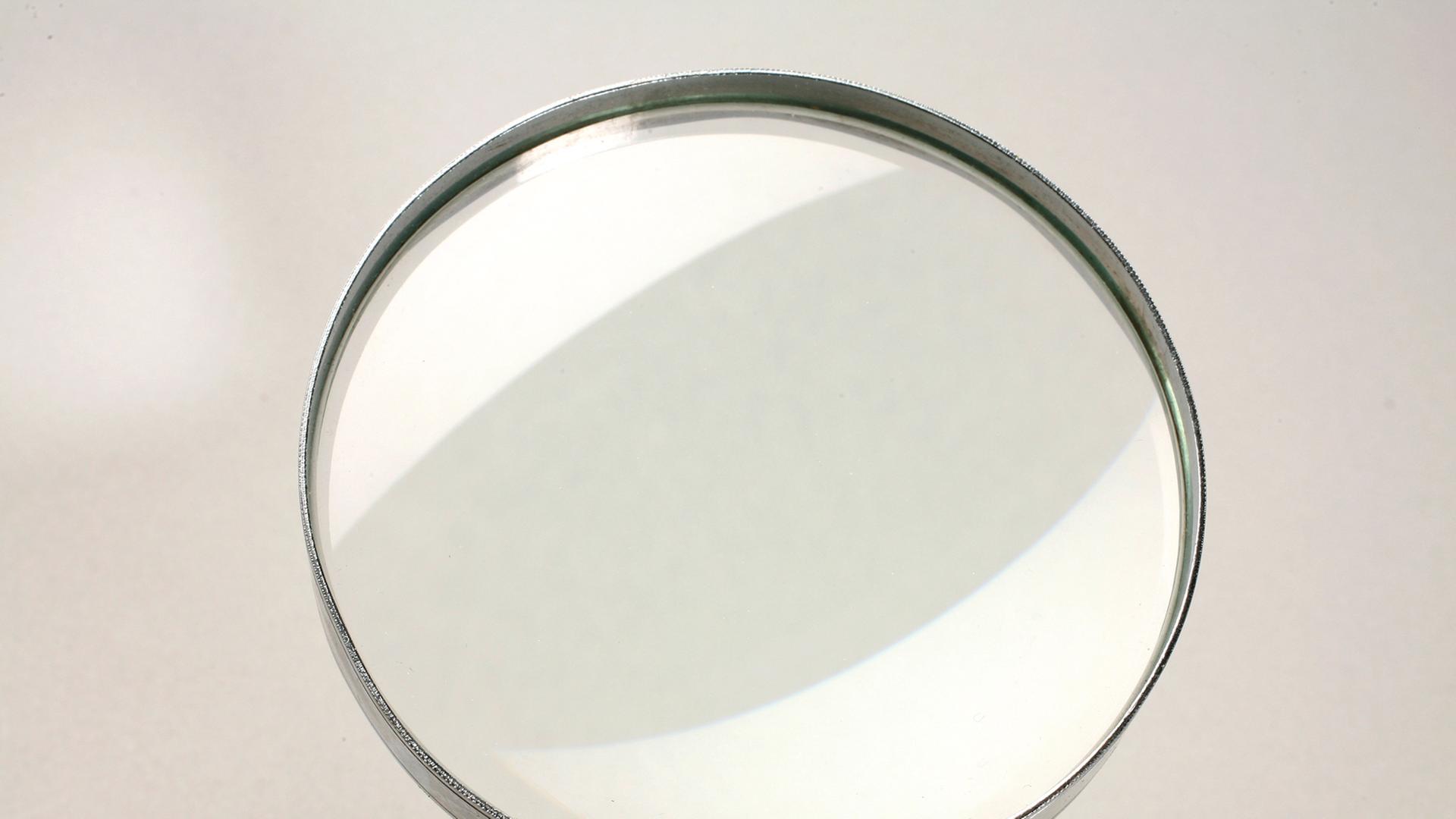
Im Deutschen Bundestag geht die Angst um: Vorsicht, Whistleblower!
"Also es gibt natürlich auch Arbeitnehmer, die nicht aus hehren Gesichtspunkten und Motiven handeln, sondern, ja, als Denunzianten oder vielleicht auch, um sich an dem Arbeitgeber zu rächen. Ich möchte gar nicht behaupten, dass diese Fälle in der Mehrzahl sind."
CSU-Abgeordneter Stephan Mayer – 40 Jahre alt, glattrasiert und im schwarzen Nadelstreifenanzug – legt mit kräftigem bayerischen Akzent los. Der innenpolitische Sprecher der Union begründet, warum seine Fraktion seit Jahren ein Hinweisgeber-Gesetz ablehnt: Einerseits gebe es ja die bösartigen Anschwärzer. Und für ehrbare Informanten reichten die normalen Kündigungsschutz-Paragrafen völlig aus, findet er. Der Kündigungsschutz erlaubt allerdings nur das betriebsinterne Anprangern von Missständen – Mayer ist damit zufrieden.
"So, dass ich beim besten Willen keinen Bedarf sehe, jetzt hier unmittelbar – vielleicht auch etwas aktionistisch – jetzt als Gesetzgeber tätig zu werden."
Bei der deutschen Wirtschaft hört man eine andere Meinung - vor allem bei den Großkonzernen.
Deutsche Wirtschaft hält Whistleblower-Schutz für sinnvoll
"Also der denunziatorische Teil liegt unter fünf Prozent. Und wenn Sie 95 Prozent redliche Hinweise bekommen, rechtfertigt das ein solches System."
Berlin-Mitte, Potsdamer Platz, im gläsernen Tower der Deutschen Bahn. Im fünften Stock stellt "Chief Compliance Officer" Werner Grebe die Weichen für den Hinweisgeberschutz. Der oberste "Regelüberwacher"– 1,98, Brille und Halbglatze – erklärt: Die rund 300.000 Bahnmitarbeiter in aller Welt könnten sich bei Missständen direkt an ihn wenden oder an drei externe Vertrauens-Anwälte. Zudem gebe es ein anonymes Meldesystem im Internet. Die Bahn habe das Whistleblowersystem, ab 2008, als Konsequenz aus Straftaten im eigenen Unternehmen eingerichtet.
"Bei größeren Bauprojekten gab es auch Fälle von Korruption. Diese waren dann Anlass, um darüber nachzudenken, wie man dann entsprechend gegenwirken kann."
Die Bilanz des Konzerns: In den vergangenen zwölf Monaten ist eine dreistellige Zahl von Hinweisen auf Korruptions-, Betrugs- oder Umwelt-Vergehen eingegangen. Grebe skizziert einen gemeldeten Untreue-Verdacht, den er an die Staatsanwaltschaft weiter geleitet hat:
"Also in dem Fall, den ich Ihnen grad geschildert habe, ging es doch um einige Hunderttausend Euro."
Ein neuer Skandal? Wer-was-wo? Vielleicht im Konzern-Bereich "Einkauf"?
"Nein!"
Mehr Details bitte!
Ein Pressesprecher, der mit am Tisch sitzt, winkt ab: Der Compliance-Chef ist von Haus aus Jurist, da können Sie lange nachfragen! Grebe trinkt einen Schluck Kaffee – der seine Zunge aber auch nicht löst.
"Es ging schon um Geschäftsabwicklungen, die nicht in Ordnung waren. Und alles Weitere wird dann aufgeklärt und wir sind selbst auch gespannt, was da im Detail herauskommen wird."
Wenige Unternehmen wollen Auskunft über ihren Whistleblower-Schutz geben
Auch wenn im gläsernen Tower längst nicht alles transparent ist – immerhin: Andere Konzerne äußern sich überhaupt nicht zu ihrem Whistleblower-System. Air Berlin etwa begründet dies mit "Kapazitätsgründen". Sollen etwa registrierte Missstände nicht an die Öffentlichkeit dringen?
"Natürlich ist es so, dass die Hinweisgebersysteme, die die Unternehmen einrichten - das sind Systeme, die den Unternehmen nützen sollen."
Gleich gegenüber der Bahnzentrale, auf der anderen Seite des Potsdamer Platzes, arbeitet Rainer Frank als Vertrauensanwalt für Firmen, wie Vattenfall und die Charité, die ebenfalls Whistleblower-Kanäle aufgebaut haben.
"Eines der Ziele ist sicherlich, dass man lieber etwas auf diesem Wege erfährt, als dass man es dadurch erfährt, dass der Staatsanwalt mit der Polizei anrückt und eine Durchsuchung durchführt."
Rainer Frank ist nicht nur Anwalt, er leitet auch die Arbeitsgruppe Hinweisgeber bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Der Fachmann weiß: Es gibt auch internationalen Druck auf die Wirtschaft, Whistleblower zu schützen. So schreiben beispielsweise die USA und Großbritannien weltweiten Konzernen solche Compliance-Systeme vor. Zudem fragen auch immer mehr deutsche Staatsanwälte, ob Unternehmen nicht Straftaten begünstigen, wenn sie keine Hinweisgeber-Systeme haben. Und bei fehlenden Kontroll-Mechanismen können hohe Geldbußen verhängt werden – wie 2007 in der Schmiergeldaffäre von Siemens.
SPD kämpft für umfassendes Gesetz - Union dagegen
"Siemens hat in München allein aus diesem Gesichtspunkt eine Unternehmensgeldbuße von über 200 Millionen Euro gezahlt."
Zurück zum Bundestag. Während sich die Unionsfraktion gegen ein Gesetz stemmt, dass Informanten mehr Schutz gewähren würde, geht der Koalitionspartner SPD mutig voran: Die Sozialdemokraten fordern – wie auch die Grünen - ein Hinweisgebergesetz für alle Angestellten in Deutschland. SPD-Arbeitspolitiker Markus Paschke will sogar eine Regelung, die über die Ansätze der Wirtschaft hinausgeht: eine Regelung, dass sich Whistleblower auch - ungestraft - an die Medien wenden dürfen.
"Dieses Verfahren sagt, dass man erst mal versuchen muss, beim Arbeitgeber eine Änderung herbei zu führen – oder bei den zuständigen Behörden. Und erst wenn das zu keinem Ergebnis führt, dann hat man auch das Recht, sich an die Öffentlichkeit zu wenden."
Doch die Union lehnt alles ab. So wird es noch dauern, bis Deutschland seine Whistleblower schützt – obwohl große Unternehmen, Justizvertreter sowie andere Staaten - schon viel weiter sind. Antikorruptions-Anwalt Rainer Frank schüttelt fassungslos den Kopf.
"Es ist einfach peinlich, wenn die deutsche Regierung solchen Rechtsentwicklungen hinterher läuft."