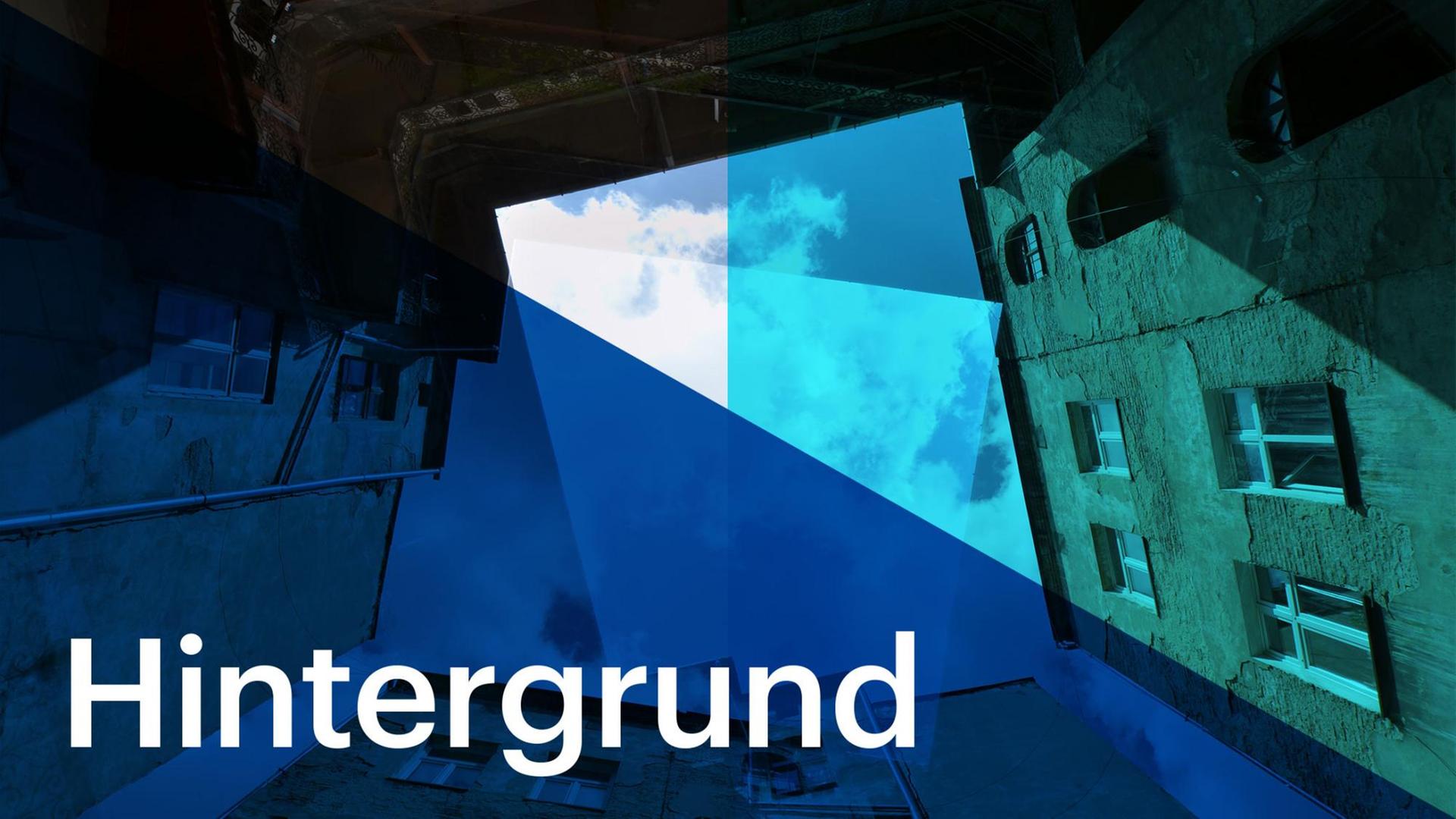Ein offener Schädelbruch. Eine Lebensmittelvergiftung. Ein Schlaganfall. Eine Schusswunde. Ein Schlangenbiss. Ein Schnupfen. Ein perforiertes Auge. Und die Ersthelfer im Rettungswagen kündigen per Funk bereits die Ankunft des nächsten Patienten an. Ein ganz normaler Tag in der Notaufnahme des Erlanger Hospitals in Chattanooga, Tennessee, in einem der größten öffentlichen Krankenhäuser im Südosten der USA. Rund 250 Menschen kommen jeden Tag durch die großen Schwingtüren in den Emergency Room. Tendenz: steigend:
"Die Zahl der Patienten, die wir hier behandeln, hat in den letzten Monaten zugenommen. Landesweit erwarten wir einen Anstieg um etwa fünf Prozent."
Sagt Dr. David Seaberg, Chefarzt der Notaufnahme im Erlanger Hospital. Seaberg ist ein großer Mann Mitte 50, sein Gesicht ist fahl im grellen Neonlicht, die Augen sind gerötet. Gerade ist seine Schicht zu Ende gegangen; es war viel los an diesem Tag.
"60 Patienten in zwölf Stunden, das sind schon ziemlich viele. Aber das Tempo der Behandlung hängt natürlich auch immer vom Zustand der Patienten ab. Schwere Notfälle dauern länger, weil sie komplexer sind."
Seaberg und seine Kollegen wissen nicht, ob ein Patient versichert ist, wenn er eingeliefert wird. Für die Ärzte ist das auch uninteressant. Denn im Emergency Room muss jeder behandelt werden – das ist das Gesetz in Amerika – ob reich oder arm, versichert oder unversichert; ob er mit einem Herzinfarkt kommt oder mit einem Husten oder einfach nur, weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll.
130 Millionen Menschen suchen in den USA jedes Jahr die Notaufnahmen der Krankenhäuser auf; das ist mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung.
Seit dem 1. Januar, seit einem halben Jahr also, ist die Gesundheitsreform von US-Präsident Barack Obama in Kraft. Obamacare - so wird das politische Mammutprojekt von Freund und Feind gleichermaßen genannt - hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl von 48 Millionen Nichtversicherten - das sind 15,4 Prozent der amerikanischen Bevölkerung - drastisch zu verringern.
Amerikaner, die nicht über ihren Arbeitgeber versichert sind und sich bislang keine Krankenversicherung auf dem freien Markt leisten konnten, haben jetzt die Möglichkeit, an staatlich regulierten Online-Börsen Krankenversicherungen zu erschwinglichen Preisen zu erwerben. Einer der erhofften Nebeneffekte: Die notorisch verstopften Notaufnahmen sollen entlastet werden. Doch danach sieht es bislang nicht aus. David Howard ist Gesundheitsökonom an der Emory Universität in Atlanta.
"Es gibt eine Studie, die zeigt, was im Bundesstaat Oregon passierte, als dieser noch vor Obamas Gesundheitsreform den Krankenversicherungsschutz erweitert hatte. Dort sind die Leute in dem Moment, in dem sie versichert waren, häufiger in die Notaufnahme gegangen, nicht seltener."
Entlastung der Notaufnahmen, aber Überlastung von Hausärzten?
Es gibt viele Gründe, warum Patienten mit Versicherungsschutz auch in weniger dringenden Fällen statt zum Hausarzt noch immer in die überfüllten Emergency Rooms gehen. Gewohnheit ist einer. Hinzu kommen andere Faktoren, die nur indirekt mit der Gesundheitsreform zu tun haben. Notfallmediziner Seaberg:
"Wir haben eine alternde Bevölkerung. Und wenn man älter wird, wird man öfter krank. Außerdem werden in Zukunft zwar mehr Menschen eine Versicherung haben, aber es gibt zu wenig Hausärzte, um sie alle zu behandeln. Und deshalb landen sie am Ende dann doch wieder im Emergency Room."
Überlastete Hausärzte als Folge von Obamacare: Zwar sei es zu früh für eine umfassende Auswertung von Daten, sagt Gesundheitsökonom Howard. Doch zeichne sich bereits ein Trend ab:
"Ich glaube nicht, dass die Wartezeiten in Hausarztpraxen dramatisch länger werden. Vielmehr werden sich die Ärzte den steigenden Patientenzahlen anpassen; sie werden mehr Patienten im Terminplan unterbringen und weniger dringende Fälle von ihren Assistenten behandeln lassen."
Immer mehr Patienten im Terminplan unterbringen: Genau das will Dr. Juliet Mavromatis vermeiden. Deshalb hat die Internistin schon vor Jahren die Ärztegruppe verlassen, für die sie arbeitete, hat eine private Hausarztpraxis eröffnet und die Zahl ihrer Patienten auf 400 beschränkt.
Doch auch Mavromatis, eine schmale, hochgewachsene Frau mit klaren Gesichtszügen, erlebt in ihrem Praxisalltag die ersten Auswirkungen von Obamacare, die guten wie die schlechten.
Doch auch Mavromatis, eine schmale, hochgewachsene Frau mit klaren Gesichtszügen, erlebt in ihrem Praxisalltag die ersten Auswirkungen von Obamacare, die guten wie die schlechten.
"Ich habe fünf bis zehn Patienten, die eine der neuen Versicherungen gekauft haben. Einige von ihnen sind jung, unter 30, leiden aber unter chronischen Krankheiten. Andere sind älter und haben ebenfalls mit komplexen Problemen zu kämpfen."
Bevor der Affordable Care Act, das ist der offizielle Name der Gesundheitsreform, in Kraft trat, konnten Versicherungen Patienten mit Vorerkrankungen wie Krebs, Diabetes oder hohem Blutdruck abweisen. Oder deren Beiträge so hoch ansetzen, dass sich viele keinerlei Versicherung leisten konnten. Ein Unfall oder eine schwere Krankheit endete dann nicht selten in der Privatinsolvenz.
"Das ist das große Plus für Patienten, die infolge der Gesundheitsreform jetzt endlich Zugang zu bezahlbaren Versicherungen haben - trotz bestehender Vorerkrankungen."
Nachteile, Hürden und Grauzonen
Aber es gibt auch Nachteile, Hürden und vor allem: Grauzonen. So müssen Vorsorgeuntersuchungen nach den Regeln von Obamacare zwar zu 100 Prozent von den Versicherungen bezahlt werden. Allerdings ist nicht immer klar, was als Vorsorge gilt. Beispiel: Darmspiegelung. Die wird in den USA - ebenso wie in Deutschland - ab dem 50. Lebensjahr für jeden empfohlen, und sie gilt im Leistungskatalog der Versicherungen als Vorsorge.
"Wenn die Ärzte während der Darmspiegelung einen Polypen finden, schneiden sie ihn heraus und schicken ihn ins Labor. Selbst wenn der Polyp harmlos ist, sollte der Patient nach drei Jahren eine weitere Darmspiegelung machen lassen. Die gilt dann allerdings nicht mehr als Vorsorge, sondern als Diagnostik. Und je nach Art der Versicherung zahlt der Patient dafür locker 2000 Dollar aus der eigenen Tasche dazu."
Außerdem haben die neuen Versicherungen die Liste der erstattungsfähigen Medikamente deutlich zusammengestrichen. Auch für viele bildgebende Verfahren wie CTs und MRTs sowie spezialisierte Tests müssen Hausärzte jetzt noch detailliertere Anträge stellen.
"Viele Ärzte klagen über den zunehmenden bürokratischen Aufwand, für den sie im Alltag oft gar keine Zeit haben."
Sagt Mavromatis. Für Hausärzte, die in den USA im Durchschnitt 25 bis 30 Patienten am Tag betreuen, heiße das auch:
"Noch weniger Zeit für die Patienten - und einen größeren Bedarf an Personal. Und das bedeutet auch höhere Kosten für die Praxis."
Gesundheitsökonom Howard geht indes davon aus, dass die meisten Hausärzte langfristig von der Reform eher profitieren werden - ganz einfach, weil sie in der Masse mehr versicherte, und damit zahlende Patienten hätten.
Dagegen sieht er einen klaren Nachteil für jene Patienten, die von einer alten Versicherung auf dem freien Markt zu einer neuen, subventionierten Obamacare-Versicherung wechselten: Sie müssen sich häufig neue Ärzte suchen.
"Viele der neuen Versicherungen bieten nur sehr begrenzte Netzwerke von Krankenhäusern und Ärzten an. Manche Patienten sind überrascht, wenn sie herausfinden, dass sie die Ärzte, zu denen sie seit Jahren gehen, nun nicht mehr sehen können."
Eine solche Erfahrung machte Frani Green. Green ist 54 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Philadelphia und lebt heute in Atlanta. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, 16 und 19 Jahre alt, arbeitet als Yogalehrerin und macht nebenbei verschiedene Bürojobs. Green, klein und im Blumenkleid, ist eine Obamacare-Versicherte der ersten Stunde. Sie hatte auch vorher eine Krankenversicherung.
"Ich habe dafür zuletzt knapp 400 Dollar gezahlt, für mich alleine. Das war lächerlich und wirklich sehr, sehr teuer", sagt sie. So entschied sie sich im Oktober vergangenen Jahres für eine der neuen Versicherungen. Sie brauchte sechs Wochen, um sie zu beantragen, verbrachte Stunden und Tage am Computer und am Telefon, weil die Website der Regierung, über die die Anträge gestellt werden, nicht richtig funktionierte.
Schließlich klappte es; sie bekam eine Krankenversicherung - für sich und ihre 19-jährige Tochter. Die jüngere Tochter ist über ein staatliches Programm für Jugendliche versichert. 34 Dollar und 23 Cent, ein Schnäppchen im Vergleich zum früheren Beitrag von knapp 400 Dollar. Frani Green war glücklich.
Bis zu jenem Tag im Dezember, als ihr Gynäkologe Gebärmutterkrebs diagnostizierte. Sie vereinbarte einen OP-Termin für Februar; da war sie bereits nach Obamacare-Kriterien versichert. Doch dann fand sie heraus, dass das Krankenhaus, in dem sie operiert werden sollte, ihre neue Versicherung nicht akzeptierte. Sie war am Boden zerstört, tobte und weinte.
"Dann habe ich zu mir gesagt: Atme tief, atme noch tiefer, atme zehn Millionen mal tief. Und dachte schließlich, okay, es gibt noch andere Ärzte und noch andere Krankenhäuser auf dieser Welt und in Atlanta."
Sie suchte, und sie fand: einen neuen Arzt und eine neue Klinik. Die Operation verlief gut, der Krebs hatte nicht gestreut. Ihre Gebärmutter wurde entfernt, aber sie brauchte keine Chemotherapie und keine Bestrahlung. Und auch finanziell war Frani Green nicht ruiniert.
"Ich bekam zwar eine saftige Rechnung von insgesamt 37.000 Dollar, aber am Ende musste ich selbst nur 700 Dollar dazuzahlen."
Nicht alle Ärzte akzeptieren Obamacare-Versicherungen
Green hatte Glück, dass sie einen guten Arzt für ihre Operation gefunden hatte - und dass Arzt und Krankenhaus ihre Versicherung akzeptierten. Das ist nicht selbstverständlich; denn vor allem Fachärzte in den USA stehen der Gesundheitsreform - bislang zumindest - eher skeptisch gegenüber. Der Grund sei vor allem ein finanzieller, sagt Wirtschaftswissenschaftler Howard:
"Um Krankenversicherungen für die Patienten erschwinglicher zu machen, zahlen die Obamacare-Versicherungen niedrigere Vergütungsraten an Ärzte, vor allem an Spezialisten, als die kommerziellen Versicherungen."
Dr. Evander Fogle ist Orthopäde und Sportmediziner in Atlanta. Er arbeitet in einer Gruppe mit 95 Ärzten. Seine Praxis hat sich entschieden, bis auf Weiteres keine Obamacare-Versicherungen zu akzeptieren. Nicht allein wegen der schlechten Vergütung, betont Fogle.
"Als Fachärzte haben wir manchmal auch die Sorge, dass Patienten, die früher keine Versicherung hatten, sich in einem schlechteren Allgemeinzustand befinden als Patienten, die ihr Leben lang krankenversichert waren. Und das heißt dann auch, dass die Ergebnisse der Operationen nicht so gut verlaufen."
Fogle ist Anfang 40, drahtig, mit kurzem grauen Haar. Er hat als Austauschschüler in Oldenburg gelebt, hat an den Eliteschmieden Stanford und Vanderbilt studiert und war als Feldarzt auf der US-Militärbasis in Guantanamo Bay, Kuba, stationiert.
"Das mag hartherzig klingen, aber es ist eine Tatsache: Als Ärzte werden wir an der Qualität der Ergebnisse gemessen, die wir liefern. Und wenn meine Ergebnisse nicht so gut sind, wie die meines Kollegen, der gesündere Patienten behandelt, dann sehe ich als Arzt schlechter aus."
Fogle hält inne, zuckt mit den Schultern. Medizin sei ein Dienst am Menschen, sagt er, aber auch ein Geschäft, ob einem das nun gefalle oder nicht. Er selbst habe nur wenige langjährige Patienten, die zu einer Obamacare-Versicherung gewechselt seien und nun von seiner Praxis - theoretisch - abgewiesen würden.
"Wenn diese Situation eintritt, dann behandele ich den Patienten weiter. Wenn er die Rechnung aus eigener Tasche bezahlen kann: prima. Wenn wir eine Ratenzahlung vereinbaren können: auch gut. Und wenn er gar nicht zahlen kann, erlasse ich ihm die Kosten."
Bislang keine Reform des US-Schadenersatz-Systems
Viele Fachärzte hatten darauf gehofft, dass Obamacare auch eine Reform des Schadenersatz-Systems anstoßen werde. Doch das ist bislang nicht geschehen.
Gesundheitsökonom David Howard:
Gesundheitsökonom David Howard:
"Die USA ist eine klagefreudige Gesellschaft. Patienten verklagen Ärzte häufig auf mögliche Behandlungsfehler, und Ärzte müssen, um sich zu schützen, teure Haftpflichtversicherungen abschließen."
Die Jahresbeiträge für diese Versicherungen variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat und Fachgebiet zu Fachgebiet - und können bis zu 200.000 Dollar betragen. Besonders hoch sind sie für Gynäkologen sowie für alle chirurgischen Disziplinen.
Die Folge einer derart ausgeprägten Klagekultur: ein defensiver Diagnose- und Behandlungsstil. Und der treibe die Kosten noch weiter in die Höhe, sagt Evander Fogle:
Die Folge einer derart ausgeprägten Klagekultur: ein defensiver Diagnose- und Behandlungsstil. Und der treibe die Kosten noch weiter in die Höhe, sagt Evander Fogle:
"Als Ärzte praktizieren wir mit großer Vorsicht, weil wir auf keinen Fall einen Fehler machen oder etwas übersehen wollen. Das führt oft dazu, dass wir bisweilen mehr Tests und Therapien anordnen, als unbedingt nötig wären."
Jedes CT und MRT, jede spezialisierte Blutuntersuchung und jede Biopsie ist eine zusätzliche Belastung für ein Gesundheitssystem, das ohnehin als das teuerste der Welt gilt. 2,8 Billionen Dollar geben Amerikaner pro Jahr für medizinische Versorgung aus - das sind 17,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: In Deutschland machen die Gesundheitsausgaben 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Sportmediziner Fogle:
"Wir wären bessere Ärzte, wenn wir uns einfach auf unsere Erfahrung verlassen könnten, als ständig daran zu denken, wie wir unsere Entscheidungen vor Gericht verteidigen können."
Millionen haben eine Versicherung inzwischen erworben
Sechs Monate Obamacare: Amerika schwankt zwischen Ernüchterung und Erleichterung, Frustration und Freude. Und niemand weiß so ganz genau, wohin die Entwicklung geht. Mehr als acht Millionen Menschen haben mittlerweile eine der neuen Versicherungen auf dem Online-Marktplatz erworben, mehr als die Regierung erwartet und erhofft hatte. Und auch die technischen Pannen auf der offiziellen Website sind mittlerweile weitgehend behoben.
Frani Green jedenfalls würde immer wieder eine Obamacare-Versicherung abschließen.
"Ich habe dafür gekämpft. Es hat mich Nerven gekostet. Aber es funktioniert. Ich muss keine 37,000 Dollar für eine Operation bezahlen, sondern nur 700. Und das ist machbar für Menschen wie mich, Menschen in der wirklichen Welt."
Im Emergency Room des Erlanger-Krankenhauses in Chattanooga wirft Dr. David Seaberg derweil einen letzten Blick auf die Monitore, informiert seine Kollegen von der nächsten Schicht knapp über den Zustand der Patienten. Seit 28 Jahren arbeitet er als Notfallmediziner, und er wolle nicht tauschen, sagt er, nicht einen Tag.
Er sei am Ende seiner Schicht vielleicht müde, aber er habe immer das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles getan zu haben.
Wie auch immer sich Obamacare auf das Gesundheitswesen Amerikas auswirkt: Die Notaufnahmen werden noch auf lange Zeit die Orte bleiben, an denen alle Patienten gleich sind: die Versicherten und die Unversicherten, die Reichen und die Armen, die Schwerverletzten und die Simulanten, die mit Schlaganfall und die mit Schnupfen.
"Weil die Menschen bei uns gut versorgt werden. Weil wir immer da sind, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr."