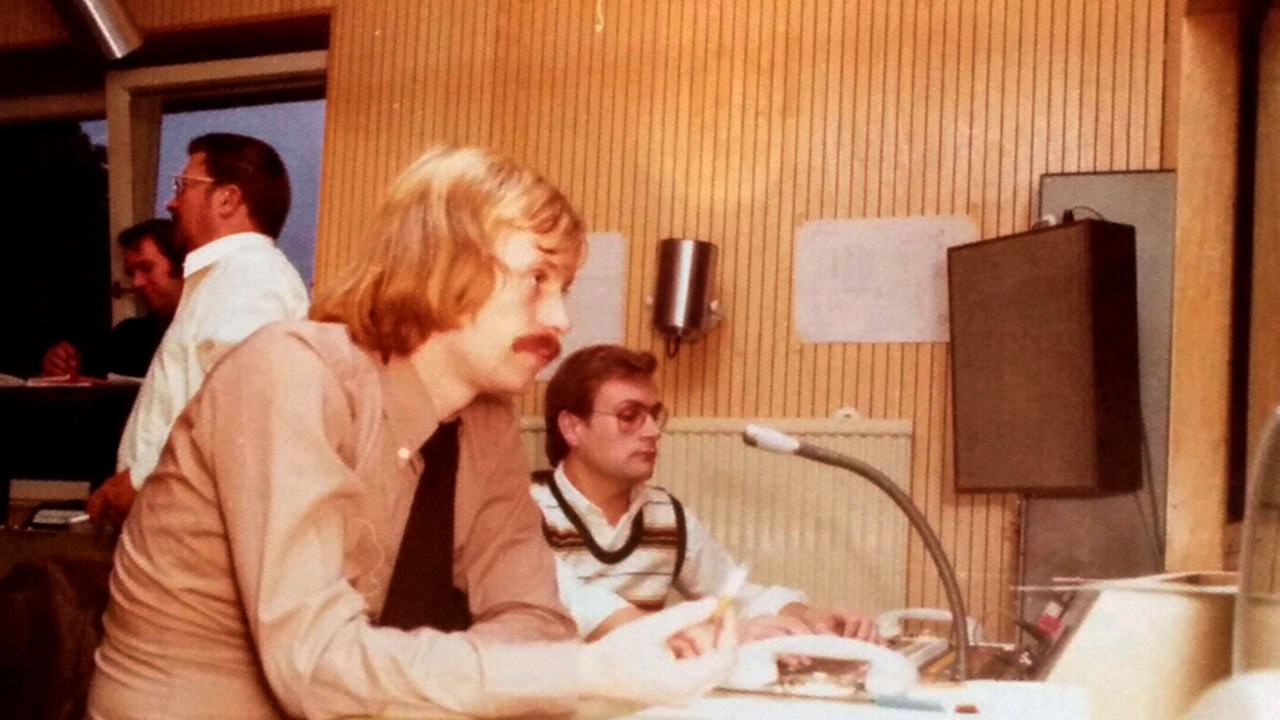
Jasper Barenberg: Mitgehört hat Jürgen Krönig, damals auch Deutschlandfunk-Redakteur, auch in der Mannschaft, die diese Frühsendung im Deutschlandfunk auf die Beine gestellt hat. Schönen guten Morgen nach London!
Jürgen Krönig: Ja, guten Morgen nach Köln!
Barenberg: Heribert Schwan hat gerade gesagt, das war für ihn schon eine große Herausforderung. Die Kolleginnen, die Kollegen haben lange geübt. Wie groß war aus Ihrer Sicht die Veränderung damals?
Krönig: Na ja, es war natürlich schwierig, einen so wilden Kollegen wie Heribert Schwan unter Kontrolle zu halten. - Nein, Spaß beiseite: Es war schon eine sehr aufregende, eine sehr schöne Zeit. Es war eine große Chance, etwas Neues zu machen. Vor allem hatten wir ja Freiland. Es war unerprobt. Es gab dieses Format nicht, nicht nur im Deutschlandfunk, sondern da versuchten wir auch, ein Magazin zu machen, das es in der deutschen Rundfunklandschaft nicht gab.
Und wir orientierten uns - das müssen wir ganz ehrlich sagen - natürlich wie immer, wie viele in Deutschland, an der großen, hehren BBC und deren politischem Journalismus und deren Fragetechnik, und wir versuchten, das auch ein bisschen kritischer zu machen, ausführlicher zu machen, bohrender zu machen in Interviews. Das ist nicht immer gelungen, vieles ist schief gegangen, aber insgesamt hat sich das doch bewährt. Die Tatsache, dass wir jetzt 40 Jahre danach reden, ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür.
Und wir orientierten uns - das müssen wir ganz ehrlich sagen - natürlich wie immer, wie viele in Deutschland, an der großen, hehren BBC und deren politischem Journalismus und deren Fragetechnik, und wir versuchten, das auch ein bisschen kritischer zu machen, ausführlicher zu machen, bohrender zu machen in Interviews. Das ist nicht immer gelungen, vieles ist schief gegangen, aber insgesamt hat sich das doch bewährt. Die Tatsache, dass wir jetzt 40 Jahre danach reden, ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür.
"Das Live-Prinzip hat sich behauptet"
Barenberg: Wenn Sie ein bisschen einen Blick darauf werfen, was sich seitdem getan und verändert hat - Sie arbeiten lange schon in London, aber möglicherweise werfen Sie ja ab und zu mal ein Auge, haben ein Ohr dafür, was in den Informationssendungen bei uns sich verändert hat -, was ist heute anders geworden als damals?
Krönig: Na ja, ich meine, ich habe nicht das Vergnügen, den Deutschlandfunk täglich zu hören. Wenn ich in Deutschland bin, was häufig der Fall ist, dann höre ich natürlich meinen alten Sender und bin angenehm überrascht über die insgesamt hohe Qualität auch in anderen Bereichen des Programms, nicht nur am Morgen oder Mittag, sondern auch generell. Die Moderationen sind sehr gekonnt. Das Live-Prinzip hat sich behauptet. Heribert Schwan erwähnte ja eben, dass Live als gefährlich galt. Das kann man sich schlecht vorstellen, aber das war tatsächlich so. Es gab weniger Kontrolle über das, was gesagt wurde. Insofern ist das etabliert.
Aber was mir auffällt ist, dass insgesamt gesehen es einen großen Unterschied nach wie vor gibt, und das ist vielleicht eines der wenigen Dinge, die man von der BBC noch lernen kann. Die BBC kocht auch nur mit Wasser, sollte man dabei sagen. Und zwar, das ist Folgendes: Wir haben ja in Deutschland - vielleicht liegt das auch an der Sozialstruktur insgesamt - die Situation: Das Leistungsprinzip ist verpönt im öffentlich-rechtlichen System in gewisser Weise. Jeder soll alles machen und können und soll gleichbehandelt werden.
Bei der BBC wäre es beispielsweise undenkbar, dass jemand am Morgen in der "Today"-Sendung, die jeden Tag von sechs bis neun läuft, moderiert, der nicht ein ausgewiesener Könner ist. Das heißt, der wird auch höher bezahlt. Der wird ausgesucht und das ist eine große Entscheidung, wer dann jeweils nachrückt, wenn einer diesen Job verlässt, und das sind ganz besondere Charaktere, während bei uns in Deutschland es eigentlich so üblich ist, dass jedem in der Redaktion das Recht zusteht. Man scheut sich davor zurück, Leistungskriterien anzuwenden. Auch in vielen anderen Bereichen ist mir das natürlich aufgefallen.
Aber was mir auffällt ist, dass insgesamt gesehen es einen großen Unterschied nach wie vor gibt, und das ist vielleicht eines der wenigen Dinge, die man von der BBC noch lernen kann. Die BBC kocht auch nur mit Wasser, sollte man dabei sagen. Und zwar, das ist Folgendes: Wir haben ja in Deutschland - vielleicht liegt das auch an der Sozialstruktur insgesamt - die Situation: Das Leistungsprinzip ist verpönt im öffentlich-rechtlichen System in gewisser Weise. Jeder soll alles machen und können und soll gleichbehandelt werden.
Bei der BBC wäre es beispielsweise undenkbar, dass jemand am Morgen in der "Today"-Sendung, die jeden Tag von sechs bis neun läuft, moderiert, der nicht ein ausgewiesener Könner ist. Das heißt, der wird auch höher bezahlt. Der wird ausgesucht und das ist eine große Entscheidung, wer dann jeweils nachrückt, wenn einer diesen Job verlässt, und das sind ganz besondere Charaktere, während bei uns in Deutschland es eigentlich so üblich ist, dass jedem in der Redaktion das Recht zusteht. Man scheut sich davor zurück, Leistungskriterien anzuwenden. Auch in vielen anderen Bereichen ist mir das natürlich aufgefallen.
"Es gibt einen gewissen Anpassungsdruck"
Barenberg: Manche sagen ja auch, die ich gefragt habe, dass die Moderatoren, dass die, die die Fragen stellen, die die Interviews führen, früher kritischer gewesen sind ihren Interview-Partnern gegenüber, vielleicht auch frecher. Sehen Sie das auch so?
Krönig: Ja, da ist was dran. Der Druck, der Konformismus ist natürlich stark. Es ist natürlich auch eine Frage der Beschäftigungsmöglichkeiten im Journalismus generell. Damit sieht es ja mittlerweile sehr viel schlechter aus. Insofern gibt es einen gewissen Anpassungsdruck, der vielleicht dazu führt, dass man zahmer ist. Es ist immer schwer, rückblickend zu vergleichen.
Ich denke, dass in der Zeit, wo Schwan, Lenz und ich und andere moderierten, wir immer versuchten, zum Teil sehr kritisch oder bohrend zu fragen, und manchmal, wenn man zurückschaut, dann denkt man, die jungen Kollegen, die hier nachgewachsen sind, sind da etwas zahmer oder etwas ängstlicher, etwas vorsichtiger. Aber vielleicht ist das auch ungerecht. Das ist schwer, dieses generell zu beurteilen.
Ich denke, dass in der Zeit, wo Schwan, Lenz und ich und andere moderierten, wir immer versuchten, zum Teil sehr kritisch oder bohrend zu fragen, und manchmal, wenn man zurückschaut, dann denkt man, die jungen Kollegen, die hier nachgewachsen sind, sind da etwas zahmer oder etwas ängstlicher, etwas vorsichtiger. Aber vielleicht ist das auch ungerecht. Das ist schwer, dieses generell zu beurteilen.
Barenberg: Ich würde, Jürgen Krönig, gern noch über Geschwindigkeit sprechen, denn zumindest wenn ich akustisch mir anhöre, was vor längerer und langer Zeit über den Sender gegangen ist, dann fällt mir schon auf, dass die Informationsdichte zugenommen hat. Ist das auch Ihr Eindruck?
Krönig: Ja, das ist ganz sicherlich so, weil wir ja viele andere Medien, Sekundärmedien als Quellen benutzen. Es ist ein ungeheurer Informationsfluss, der oft eher verwirren kann, denn erleuchten kann. Aber lassen Sie mich noch zu einem anderen Aspekt was sagen.
Barenberg: Können wir leider nicht mehr, Jürgen Krönig, weil wir noch eine andere historische Erinnerung unterbringen müssen, nämlich die an den Mauerfall vor 25 Jahren. Danke für das Gespräch!
Krönig: Bitte schön.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
