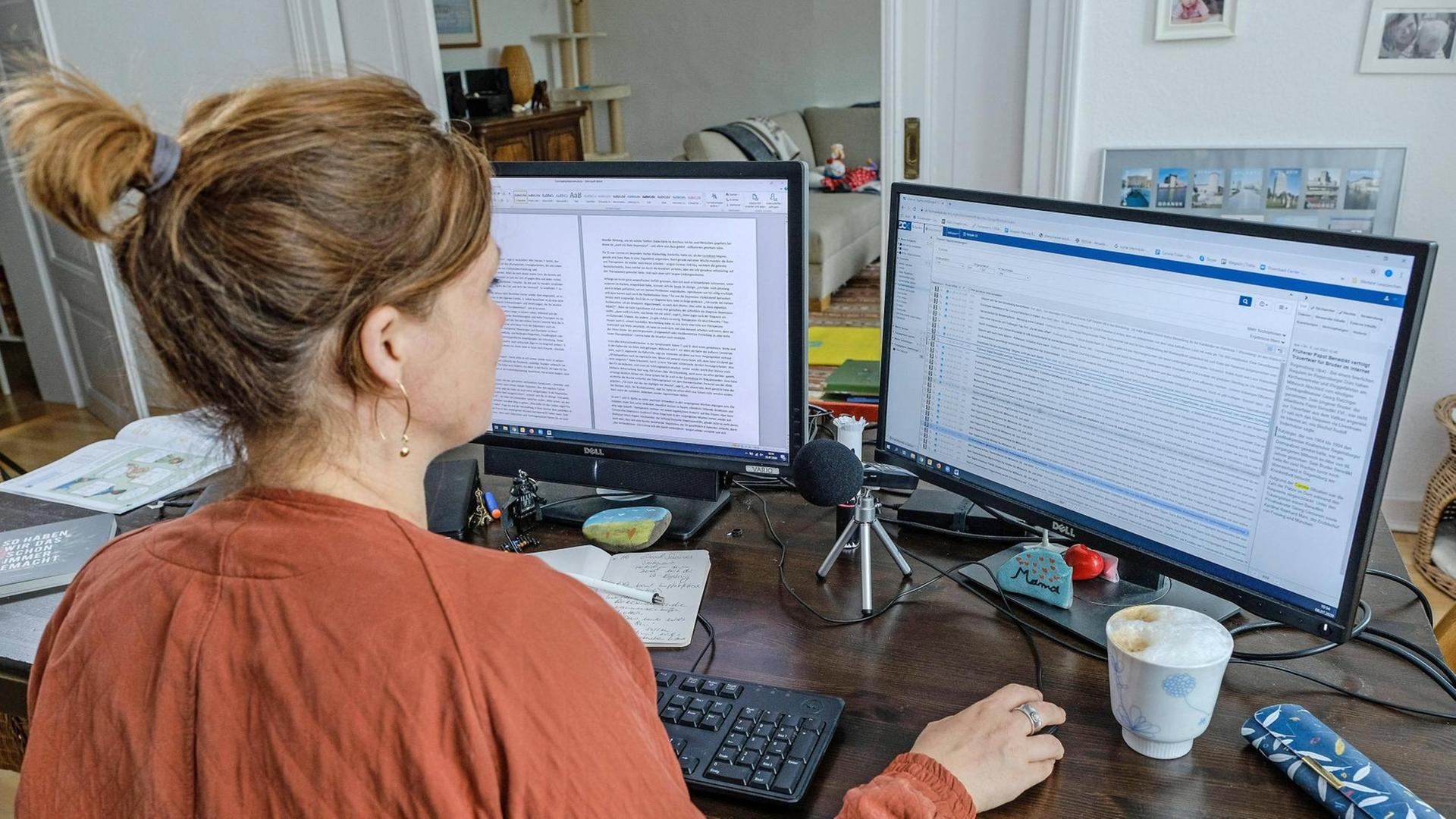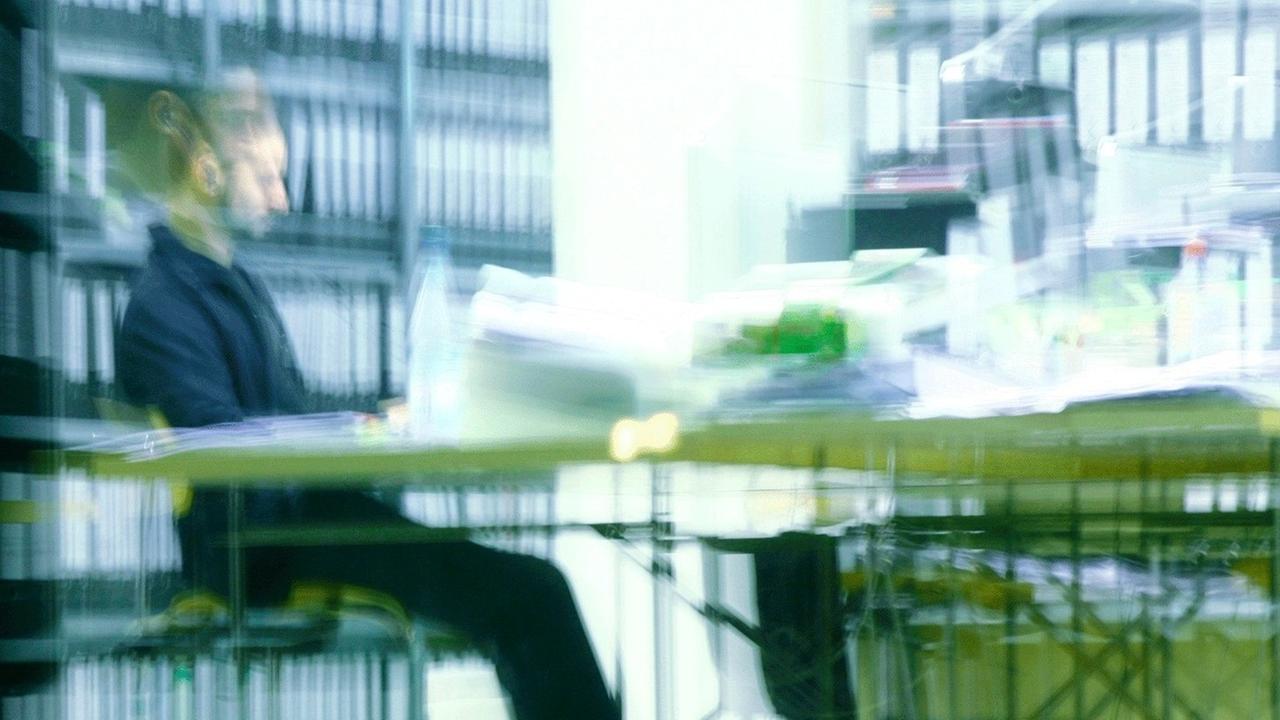Es klingt für europäische Ohren ungewohnt, wenn der Anthropologe James Suzman seinen Namen und seinen Wohnort in der Sprache der Menschen nennt, deren Leben im Norden Namibias er lange Zeit erforscht hat. Das Interesse des gebürtigen Südafrikaners, der inzwischen im britischen Cambridge lebt, gilt allerdings weniger den Klicklauten, die etliche Völker im Süden Afrikas verwenden. Suzman interessiert sich mehr dafür, welchen Blick auf die Welt Menschen haben, die ihr Leben bis vor wenigen Jahrzehnten als Jäger und Sammler gestalteten. Sie sind in seinen Augen ein Beleg dafür, dass man die Welt nicht als einen Ort sehen muss, an dem Wettbewerb ein Naturgesetz sei.
"Die Ju/'Hoansi zum Beispiel sehen Ökosysteme nicht als auf Wettbewerb angelegt."
In seinem Buch mit dem deutschen Titel "Sie nannten es Arbeit – eine andere Geschichte der Menschheit" befasst sich Suzman immer wieder mit Menschen, die sich jeden Tag aufs Neue aus ihrer direkten Umwelt beschaffen, was sie zum Leben brauchen. Er arbeitet aus Erkenntnissen der Archäologie und Anthropologie heraus, dass unsere Vorfahren über mehrere hunderttausend Jahre hinweg von dem lebten, was sie in der Natur fanden. Das genügte ihnen. Suzman überrascht seine Leser mit Berechnungen, wonach Jäger und Sammler im Schnitt nur rund 15 Stunden pro Woche mit der Beschaffung von Nahrung verbrachten.
Auch wenn man die Zeit dazu rechnet, die sie für die Zubereitung ihrer Nahrung oder die Herstellung von Werkzeugen aufwendeten, steckten sie deutlich weniger als 40 Stunden pro Woche in das, was man in westlichen Gesellschaften Arbeit nennt – also Erwerbsarbeit und Hausarbeit.
Suzman wendet sich gegen die These der Güterknappheit
Die in der Volkswirtschaftslehre oft vertretene These, dass Wirtschaften immer bedeutet, knappe Güter optimal zu nutzen, passe nicht zum dem, wie die Menschen nachweislich über lange Zeit hinweg gelebt haben, schreibt Suzman.
"In vielen Jäger- und Sammlergesellschaften – und womöglich in allen menschlichen Gemeinschaften während des größten Teils der Menschheitsgeschichte – war Knappheit nicht das Organisationsprinzip des menschlichen Wirtschaftens. Und ergo bestand das 'fundamentale ökonomische Problem' eben nicht, wie die klassische Wirtschaftslehre es postulierte, in einem immerwährenden Kampf ums Überleben."
Suzman schaut aber nicht nur auf die gesamte Menschheitsgeschichte, er macht einen noch weiteren Horizont auf. Er denkt über die Naturgesetze nach, denen die Welt seit dem Urknall folgt. Schließlich ist "Arbeit" auch ein Begriff, der in der Physik Anwendung findet. Wenn ein Baum Kohlenstoff und Energie einsetzt, um Holz aufzubauen, oder wenn Termiten in Afrika turmartige Bauten errichten, dann sei das auch Arbeit, erklärt Suzman, und er stellt eine Frage, die erst einmal kurios klingt:
"Wodurch unterscheidet sich die Arbeit, die beispielsweise ein Baum, ein Tintenfisch oder ein Zebra leistet, von der Arbeit, mit der sich unsere Spezies an die Schwelle zur künstlichen Intelligenz herangearbeitet hat?"
Suzman stellt bei seiner Antwort auf diese Frage die These auf, dass ab dem Moment, in dem Menschen begannen, ihre Energie auf den Anbau bestimmter Ackerprodukte zu konzentrieren, das Konzept der Arbeit eine Eigendynamik entwickelte. Ackerbau-Gesellschaften wurden weit stärker als Jäger und Sammler von Klima-Schwankungen und Missernten getroffen. Und sie hatten immer wieder damit zu kämpfen, dass die Bevölkerung schneller wuchs als die Produktivität der Felder – Was tatsächlich für die Knappheit sorgte, die in der modernen Ökonomie als der wesentliche Grundantrieb menschlichen Wirtschaftens gilt.

Sozialpolitik - Brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen?
Die Coronakrise bringt neuen Schwung in die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Jede Bürgerin und jeder Bürger würde es erhalten. Was spricht also dagegen? Wie soll es finanziert werden? Und welche Erfahrungswerte existieren bereits?
Die Coronakrise bringt neuen Schwung in die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Jede Bürgerin und jeder Bürger würde es erhalten. Was spricht also dagegen? Wie soll es finanziert werden? Und welche Erfahrungswerte existieren bereits?
Selbstausbeutung und Selbstbestätigung
Suzman setzt sich aber auch mit dem Phänomen auseinander, dass Menschen eben nicht nur arbeiten, um das zu befriedigen, was man Grundbedürfnisse nennt – sondern dass sie nach mehr streben. Als Beispiel kann er überraschenderweise eine Firma aus den USA nennen, die ja eigentlich als ein Land gelten, wo lange Arbeitszeiten und wenig Urlaub üblich sind. Aber der Cornflakes-Hersteller Kellogg‘s habe im Jahr 1935 die Arbeitszeit von acht auf sechs Stunden pro Tag verkürzt, um seiner Belegschaft etwas Gutes zu tun, berichtet Suzman.
"Bis in die 1950erjahre hinein blieb die 30-Stundenwoche in den Werken der Firma Kellogg’s der Normalfall. Dann stimmten zur Überraschung der Unternehmensleitung dreiviertel der in den Kellogg’s-Fabriken Beschäftigten für eine Rückkehr zur 8- Stunden-Schicht und zur 40-Stundenwoche. […] Sie wollten mehr Stunden arbeiten, um mehr Geld nach Hause tragen zu können, mit dem sie wiederum ihren Bestand an Konsumgütern […] um das jeweils neueste und beste Produkt ergänzen konnten."
Wer mehr arbeitet, kann sich aber nicht nur mehr leisten. In modernen Gesellschaften ziehen viele Menschen aus ihrer Arbeit einen großen Teil der Selbstbestätigung, die wir alle offenbar brauchen. Anekdotenhafte Geschichten wie die von Kellogg’s ziehen sich durch das Buch des Anthropologen. Bis auf wenige Ausnahmen vermeidet er Wissenschafts-Jargon. Seine Erläuterungen der Theorien einer ganzen Reihe von Geistesgrößen sind gut verständlich: Vom französischen Philosophen und Mathematiker René Descartes bis zum britischen[*] Ökonomen John Maynard Keynes. Und an den Stellen, an denen Suzman aus seinen Beobachtungen gesellschaftliche Schlüsse zieht, wird seine Sprache besonders deutlich:
"In allererster Linie geht es mir darum, den krakenhaften Klammer-Griff, mit dem die Knappheits-Ökonomie unser Arbeitsleben im Schwitzkasten hält, zu lockern und unsere damit verbundene, nicht durchhaltbare Fixierung auf wirtschaftliches Wachstum aufzubrechen."
Mit seinem Blick auf die Geschichte der Arbeit sozusagen vom Urknall bis heute will Suzman aber niemanden missionieren. Er will Argumente liefern, über die er sich eine breite Diskussion wünscht. Der Anthropologe weiß zu würdigen, was die Menschheit gewonnen hat, als sie sich entschied, viel, und immer mehr zu arbeiten. Doch diese Arznei mache den Patienten inzwischen krank, sagt Suzman – das ist die Botschaft seines Buches, das den Blick seiner Leser auf die Welt ein ganzes Stück verändern kann.
James Suzman: "Sie nannten es Arbeit. Eine andere Geschichte der Menschheit".
C.H.Beck, Übersetzung: Karl Heinz Siber, 398 Seiten, 26,95 Euro.
C.H.Beck, Übersetzung: Karl Heinz Siber, 398 Seiten, 26,95 Euro.
[*] Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle haben wir die Nationalität von Keynes korrigiert.