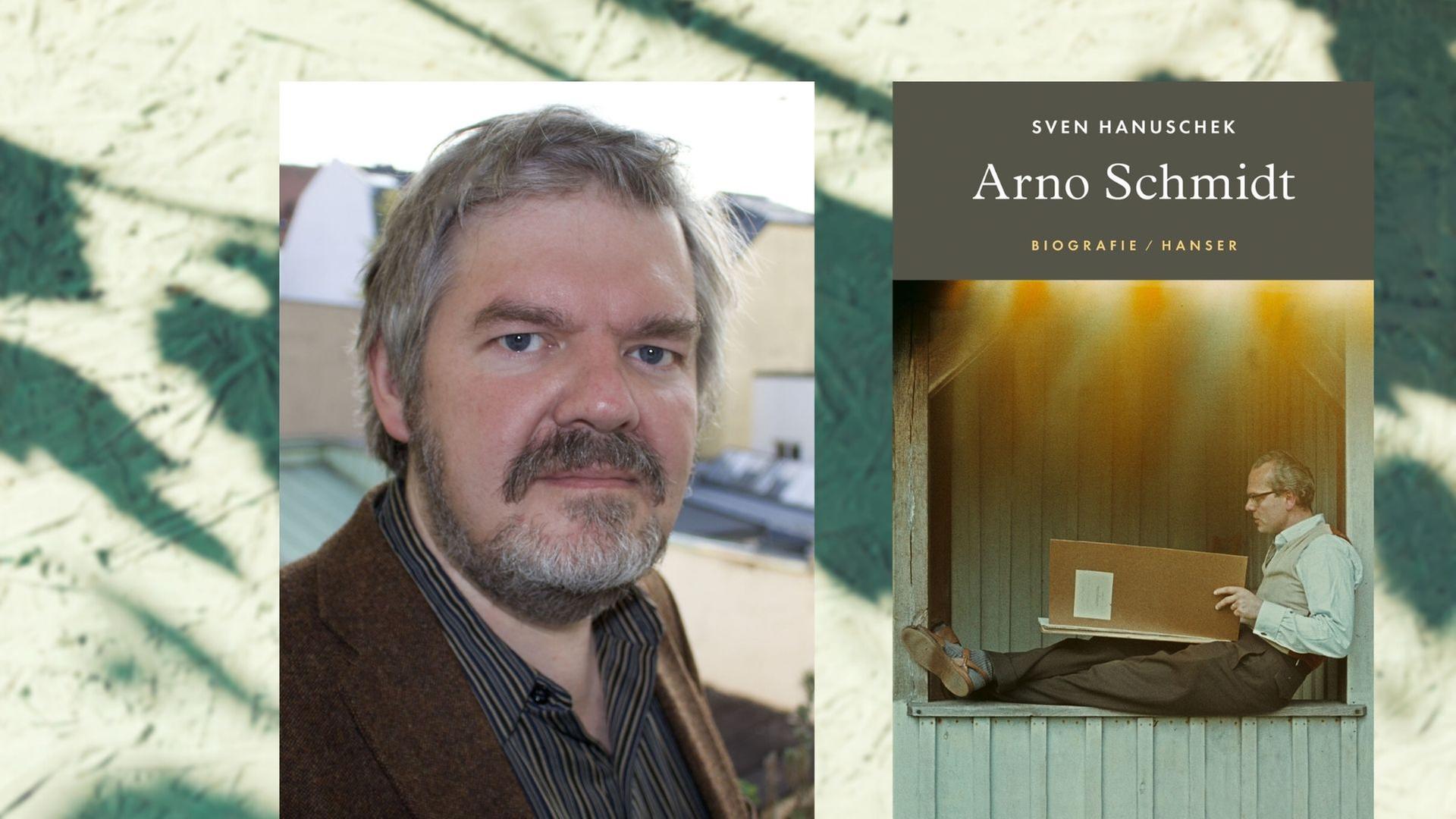
Es ist eine Mammutaufgabe, die sich Sven Hanuschek gestellt hat, und seine Biografie streift zwangsläufig die auch von Arno Schmidt selbst immer wieder listig umspielte 1000-Seiten-Grenze. Dass er dem Meister dabei endgültig erlegen ist, versteht sich fast von selbst.
„Er ist ein Autor, der über einen sprachlichen Einfallsreichtum verfügte wie kein anderer Autor des 20. Jahrhunderts, hier ist wirklich einmal James Joyce bei allen Unterschieden die adäquate Referenz.“
Es liegt nahe, dass eine Biografie Arno Schmidts nicht brav mit der Schilderung von Geburt und Kindheit beginnen kann, sondern mit einer Betrachtung darüber, dass bei diesem Autor das Leben buchstäblich in die Literatur überging und von der Biografie nichts weiter als ein „schäbiger Rest“ übrigblieb, wie Arno Schmidt selbst proklamierte. Nach einem Tribut an literaturwissenschaftliche Termini wie die von Gérard Genette definierte „Metalepse“, also die permanente Durchlässigkeit verschiedener Ebenen, widmet sich Hanuschek aber ausgiebig den Details von Arno Schmidts Sozialisation. Der Autor entstammte einer sozialen Sphäre, die ihn sehr stark prägte und letztlich auch nicht mehr losließ: dem spezifisch deutschen Kleinbürgertum. Hanuschek schildert die Verhältnisse dabei neutral und ohne Wertung. Arno Schmidts Vater Otto war unter anderem im Jahr 1900 mit dabei, in China den sogenannten „Boxeraufstand“ niederzuschlagen.
Ständige Sexualisierung
Er verstieß dann allerdings gegen die offizielle Truppenmoral und schwängerte eine 16jährige, die er 1912 auch heiratete – und zwar genau am ersten Geburtstag der Tochter Lucy, der älteren Schwester Arno Schmidts, der drei Jahre später geboren wurde. Die Sozialisation des Schriftstellers bestand in der Konfrontation mit „rohen Eindeutigkeiten“, wie er es selbst nannte. Zu seinen Vorwürfen gehörte vor allem die permanente Sexualisierung, mit der ihn seine Eltern konfrontierten. Beide hatten Affären, und der Sohn erinnert sich, dass die Mutter fünf oder sechs Mal abgetrieben hätte. Otto Schmidt starb im Alter von 45 Jahren 1928 an einem Herzinfarkt. Clara, Arno Schmidts Mutter, zog daraufhin mit den Kindern zu ihrer Familie ins schlesische Lauban. Sven Hanuschek registriert, dass sich die Mutter in ihren engsten Beziehungen entweder abwertend oder idealisierend verhalten habe:
„Solche Symptome zeigen sich bei emotional instabilen Menschen, die eine schwer diagnostizierbare, dabei nicht seltene Persönlichkeitsstörung aufweisen, für die es seit 1938 (Adolph Stern) einen Namen gibt – umgangssprachlich ist hier von einer Borderline-Störung die Rede.“
In Hanuscheks Darstellung erscheint es sehr nachvollziehbar, wie sich Arno Schmidt früh in die Welt der Bücher zurückzog. Bereits als 6jähriger las er Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“, eine stark identifikatorische Lektüre, die ihm dabei half, um sich herum Ordnungsstrukturen zu errichten. Es sagt sehr viel aus, dass sich Jahrzehnte später kaum einer seiner Hamburger Klassenkameraden näher an den berühmten Mitschüler erinnern konnte.
Wenn sich die Nüstern blähen
1932 legte Arno Schmidt in Görlitz das Abitur ab, und hier lernte er einen seiner wenigen engeren Freunde kennen. Heinz Jerofsky erzählte später, Arno Schmidt habe enorm viel gelesen und brauchte dafür offenbar einen Zuhörer. Zusammen mit Fritz Bernhard und dem Mathematiklehrer Willy Hasenfelder gründeten sie eine philosophisch-mathematische Arbeitsgemeinschaft. Biograf Hanuschek zitiert die Mitschüler, wie sie Arno Schmidt erlebten, zunächst Fritz Bernhard:
„Er sei schon ‚kollegial‘ gewesen, ‚ein bißchen arrogant, das ja; eine gewisse Platzhirschwirkung ging von ihm aus. Manchmal haben wir gerungen, unsere Kräfte gemessen. Er war immer der Stärkere. Typisch bei ihm war, daß er sich so aufpumpte und die Nüstern blähte.‘ Jerofsky bestätigt: ‚Mahlte auf den Zähnen und zog die linke Augenbraue hoch‘, aber die Arroganz habe manchmal schon auch ihre Berechtigung gehabt. Sie hätten nicht selten im Biologieunterricht unter dem Tisch Dame gespielt, wenn sie der Biologie- und Chemie-Lehrer Hugo Doebelt langweilte. Schmidt wusste dennoch am nächsten Tag über den Stoff Bescheid.“
Bis Ende der vierziger Jahre wusste Schmidt nicht, ob er sich nicht doch eher der Mathematik widmen sollte. So bezeichnete er eine Logarithmentafel, die er nach dem Zweiten Weltkrieg in eineinhalbjähriger Arbeit erstellte, als „Lebenswerk“. Die Parallelen zwischen Schmidts literarischer Ästhetik und seiner Vorliebe für exakte Berechnungen und sich ins Unendliche verzweigenden Zahlenspiele drängen sich auf, man könnte das auch kritischer reflektieren.
Rosa Junge ohne Ambitionen
Während Arno Schmidts dreijähriger kaufmännischen Lehre bei den Greiff-Werken in Greiffenberg trat aber noch etwas Wichtiges hinzu. Zunächst schien es den Namen Rosa Junge zu haben, eine Mitarbeiterin Schmidts. Dann aber tauchte Alice Murawski auf, eine enge Freundin Rosas, mit der sie regelmäßig nach der Frühstückspause im Stadtwald spazieren ging. Eines Tages stieß Arno Schmidt dazu, und es dauerte nicht lange, bis er und Alice heirateten, am 21. August 1937. Instinktiv erkannte er, dass Alice Murawski die Richtige für ihn war – die ideale Begleiterin für seine Form der Existenz.
„Rosa Junge scheint trotz der Freundschaft mit Arno Schmidt selbst keine Ambitionen gehabt zu haben, ihm noch näher zu kommen; sie mochte ihn, meint sie in einem späteren Gespräch, hörte ihm auf den Spaziergängen auch gern zu, es habe aber immer eine leichte Differenz gegeben; Schmidt wollte nicht diskutieren, sondern dozieren. Sie meint, er habe jemand völlig Loyalen gebraucht, und diesen Anspruch habe Alice ja dann lange erfüllt.“
Alice war ein großer Glücksfall für Arno Schmidt. Sie ordnete sich seinen Vorstellungen vollkommen unter, tippte seine Manuskripte ab und bildete seine Verbindung zur Außenwelt. Wenn es dabei, aus heutiger Sicht, allzu prekär wird, nimmt der Biograf seinen Protagonisten selbstverständlich in Schutz.
„Schmidt hat mehrfach die ideale Schriftstellerfrau mit dem Satz beschrieben: ‚Stumme Anbetung, die auch Maschine schreiben kann‘. Die unangenehme Frage, ob denn Alice Schmidt diese Rolle erfüllt hat, lässt sich entschieden beantworten: mit mnja, aber … Die Sentenz ist zuallererst ein Kalauer Schmidts, eines der Klischees, die deutlich komisch instrumentiert und nicht ernsthaft diskutierbar sind – so etwas wie die Slawen, die ‚typisch kulturlos‘ seien; oder der ‚größte Einwand gegen Musik, daß Österreicher darin exzelliert haben‘.“
Zur radikalen Schreibweise
Diese Passage ist typisch für den Zugriff des Biografen: Er benennt alles, lässt die eigensinnigen und unangenehmen Erscheinungsformen seines Helden nicht aus, aber ernsthafte Kratzer bekommt das Bild des Jahrhundertgenies nie. Zu den wichtigsten Leistungen dieser Biografie gehört die geduldige Nachzeichnung der Entwicklung Arno Schmidts von Texten einer inneren Emigration, die sich ins kleinteilige deutsche 18. und 19. Jahrhundert vergräbt, zu einer äußerst modernen und seine deutschen Zeitgenossen in den 50er Jahren ziemlich verstörenden Schreibweise. Wie das genau vonstatten gegangen ist, ist eine der zentralen Fragen der Arno Schmidt-Forschung und bleibt weiterhin eines der großen Rätsel. In der Zeit des Nationalsozialismus und der ersten Jahre des Zweiten Weltkriegs ist von seiner späteren radikalen Sprache kaum etwas zu ahnen. Seinem Freund Heinz Jerofsky, der in die Wehrmacht eingerückt ist, schreibt er:
„Bleibt dir noch Zeit und Lust für schwerere Sachen, Ganghofer und so?! Ich bin seit einigen Jahren so weit, dass die deutsche Literatur für mich mit Stifter und Storm aufhört.“
Interessant ist, wie der Biograf diese Sätze interpretiert:
„Der vielzitierte Satz über Storm und Stifter richtet sich in seinem Entstehungszusammenhang gegen die deutschnationale Kitsch- und Heimatliteratur, nicht gegen die Moderne.“
Intensive Privatmythologie
Ob man das so eindeutig sagen kann, ist wohl eher fraglich. Stifter und Storm waren für Arno Schmidt in dieser Zeit wirklich das Modernste, was er wahrnahm. Er konnte sich nicht „gegen die Moderne“ richten, weil er sie gar nicht kannte. Nach der Heirat entwickelte das Paar Ende der dreißiger Jahre in der Werkswohnung in Greiffenberg eine intensive Privatmythologie. 1940 schenkte Arno seiner Frau Alice ein dickes Konvolut mit dem Titel „Dichtergespräche im Elysium“, und seine Widmung spricht Bände:
„Wir sind allein zusammen, ganz allein in unserer Welt – wie sollten wir uns nicht Alles sagen?!“
Während seiner dreijährigen Wehrmachtszeit in Norwegen von März 1942 bis Januar 1945, als Arno Schmidt in seiner Schreibstube saß und mit dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nie konfrontiert war, schrieb er lange so weiter – bis sich allmählich etwas Rauheres, Brüchigeres in seinen Texten einstellte. Allgemein wird „Pharos oder von der Macht der Dichter“ als erster wahrnehmbarer autochthoner Schmidt-Text gehandelt, mit einer expressiven Sprache, die den vorangegangenen süßlich-romantischen Ton hinter sich gelassen hat. Hanuschek sieht jedoch bereits in der abgebrochenen Erzählung „Mein Onkel Nikolaus“ von 1943 erste Signale dafür. Der Biograf zeichnet eine eher organische Entwicklung nach und deutet zunächst an, dass er nicht allein die traumatische Erfahrung des Tods von Arno Schmidts Schwager Werner Murawski im November 1943 an der Kriegsfront als Grund für die Veränderung der Schreibweise ansehen möchte.
Auseinanderlaufen der Tagebuchstruktur
Hanuschek formuliert sogar ausdrücklich, man könne Arno Schmidt keineswegs „Eskapismus nachsagen“, und das ist wohl doch etwas zu forciert. Schlüssig ist allerdings, dass während der zermürbenden drei norwegischen Jahre die romantischen Fluchtwelten ihre Funktion immer weniger erfüllen konnten. Über den Zeitpunkt der Entstehung von „Pharos“ ist viel diskutiert worden. Hanuschek vermutet dafür, und das wirkt sehr überzeugend, den Zeitraum zwischen November 1943 und Januar 1944 und akzeptiert damit implizit doch den Tod Werner Murawskis als einen entscheidenden Auslöser. Arno Schmidts Debüt „Leviathan“ war 1949 das erste, und zwar bereits formvollendete Zeugnis seines charakteristischen Stils.
„Modern an Schmidts frühen Texten ist (…) die schiere Dichte der Anspielungen und Kryptozitate, die tatsächlich immer schon im Bewusstsein einer Gesamtheit literarischer Texte erfolgen, seit Ende der sechziger Jahre hätte man da von Intertextualität gesprochen.“
Gotteslästerung und Pornografie
Seine Verkaufszahlen waren zwar sehr schlecht, sein Ruf wurde aber schnell zu einem geradezu mythischen. Spätestens Ende der fünfziger Jahre war er berühmt und brauchte keine allzu quälenden Geldsorgen mehr zu haben. Hier kann der Biograf aus einer noch größeren Fülle von bereits veröffentlichten Materialien schöpfen. Er beschreibt die kärgliche Wohnung im niedersächsischen Cordingen direkt nach dem Krieg, die erste Anerkennung durch den Mainzer Akademiepreis mit deren Präsidenten Alfred Döblin 1951 oder Schmidts Weigerung, den diversen Einladungen zur Gruppe 47 zu folgen. Vor allem aber skizziert er sehr ausführlich die entscheidenden Bücher aus den fünfziger Jahren und die manchmal bizarren Umstände ihrer Entstehung. Sie bilden den Kern des Werks: „Aus dem Leben eines Fauns“ etwa, „Seelandschaft mit Pocahontas“ oder „Das steinerne Herz“.
„‘Jeder Schriftsteller sollte die Nessel Wirklichkeit fest anfassen; und uns Alles zeigen: die schwarze schmierige Wurzel; den giftgrünen Natternstengel; die prahlende Blume(nbüchse).‘ Dieser Satz ist einer der meistzitierten im Werk von Schmidt überhaupt; aber was heißt schon Wirklichkeit, in einem Erzählwerk dieses Autors?“
Attacken gegen klerikale Stimmungen
Schmidt war mit diesen Texten der formal avancierteste Autor in der Bundesrepublik. Er verkörperte provokativ den Geist einer Gegenwart, die man in Deutschland so noch gar nicht wahrgenommen hatte. Gleichzeitig attackierte er vehement die klerikalen Stimmungen in der Adenauer-Ära und die Wiederaufrüstung durch die Bundeswehr. Das Bestreben des Biografen ist es, bei der Darstellung der vielen Einzelheiten vor allem „Klischees“ zu vermeiden. Manchmal scheint das aber auch dazu zu führen, allzu eindeutige Einschätzungen zu relativieren. So informiert er ausführlich über die Anklage wegen Gotteslästerung und Pornografie, die „Seelandschaft mit Pocahontas“ 1955 hervorgerufen hatte, und er zitiert auch ausführlich aus Quellen, die erst 2013 veröffentlicht wurden und aus denen hervorgeht, dass hinter der von Anwälten vorgebrachten Anklage direkt das Erzbistum Köln stand. Dessen Prälat Wilhelm Böhler war einer der einflussreichsten Kleriker überhaupt, mit direkter Verbindung zur Bundesregierung. Es kostete einen enormen Kraftaufwand, dieser Verfolgung zu entgehen, und Schmidts Verzweiflung angesichts seiner minoritären Position in der politischen Landschaft war äußerst groß. Es ist merkwürdig, wie Hanuschek das zueinander in Bezug setzt:
„Es ist von Zeithistorikern mehrfach diskutiert worden, ob die Adenauer-Ära wirklich schon eine vollständige Demokratie gewesen ist oder doch eine ‚Kanzlerdiktatur‘. So nannten seine Gegner den autoritären Führungsstil und die ‚halbautokratischen Strukturen‘, die in den 14 Jahren seiner Regierung entstanden; er selbst sprach von der ‚Kanzlerdemokratie‘. Schmidt als zeitgenössischer Adenauer-Kritiker stand mit seiner Einschätzung also keineswegs allein.“
Kein unsozialer Sonderling
Was dieser letzte Satz genau meint, bleibt unklar. Will Hanuschek Arno Schmidt vor dem Märtyrerstatus schützen, der einzige Adenauer-Kritiker gewesen zu sein? Oder will er, wie es die Zeithistoriker mittlerweile tatsächlich eher betonen, doch den Pluralismus unter Adenauer und die Etablierung demokratischer Selbstverständlichkeiten hervorheben? Es gibt ein paar weitere solcher Relativierungen, was aber angesichts der gewaltigen Leistung, das gesamte Schmidt-Material biografisch, ästhetisch und soziologisch zu ordnen und zu präsentieren, kaum ins Gewicht fällt. Generell versucht Hanuschek gegen das übliche Bild Schmidts als ein isolierter Einzelgänger und unsozialer Sonderling anzuschreiben, nicht immer mag man ihm dabei folgen. Und während mittlerweile etliche Stimmen zu vernehmen sind, die die fünfziger und frühen sechziger Jahre als die große Zeit Schmidts ansehen und bemerken, dass das vermeintliche Hauptwerk „Zettel’s Traum“ dageben eher abfalle, huldigt Hanuschek diesem gewaltigen Vorhaben ohne irgendwelche Zwischentöne:
„Schmidt ist zu keinem Zeitpunkt seines Lebens der elitäre Autor, als der er sich zeitweise gegeben hat, und hier nehme ich Zettel’s Traum ausdrücklich nicht aus.“
Sehr instruktiv und hilfreich sind Hanuscheks ausführliche Analysen der Werke Schmidts, und bei „Zettel’s Traum“ geht er dabei sehr ins Detail. Die Auseinandersetzung mit Edgar Allan Poe, einem der zentralen Bezugspunkte des Autors, nimmt breiten Raum ein, und der organische Übergang von der Übersetzung der Werke Poes für den Schweizer Walter-Verlag zur Niederschrift von „Zettel’s Traum“ zeigt sich in der Verfolgung einiger wesentlicher Motive. Man erfährt auch viel über die Obsessionen Schmidts, der sich für „Zettel’s Traum“ fast vollständig von der Außenwelt abgekoppelt hat, dabei täglich eine Flasche Korn leerte und auch viel zu viel Nescafé trank, auch der Tablettenkonsum und der gesundheitliche Ruin vermitteln sich hautnah. Ästhetisch werden jedoch bei „Zettel’s Traum“ wie auch bei den darauf folgenden Spätwerken keinerlei Abstriche gemacht, obwohl man gegen die spezielle, an Sigmund Freud nicht unbedingt sehr konzis anschließende „Etym“-Theorie Schmidts durchaus ernsthafte Einwände äußern könnte. Die zahlreichen Kalauer mit Sexualbezug gehen häufig nicht über den Status von Pennälerwitzen hinaus, und dass Schmidt das Vorbild für die 16-jährige Franziska aus dem Quelle-Katalog ausgeschnitten hat, mit einem roten Badeanzug, verrät die engen Grenzen seiner sexuellen Vorstellungen, die mehr mit dem spießigen Horizont der bundesdeutschen 50er und 60er Jahre zu tun haben als man eigentlich möchte.
Altmänner-Sexualität
Selbst bei der manifesten Sexualisierung der auffälligen Kindsbräute und jungen Mädchen im Spätwerk wehrt der Biograf mögliche Einwände gleich ab und verweist mit souveräner Geste auf literarische Motive:
„Martina und ihre Schulfreundinnen im selben Roman sind 15, Suse Kolderup und ihre Freundin Nipperchen in der Schule der Atheisten sind 17, Franziska Jakobi ist wie ihre Freundin Christa Junge 16. Der erste Reflex vor einem solcherart ausgebauten Personal ist heutzutage sicher, von Altmänner-Sexualität und -Phantasien zu sprechen und dergleichen mindestens peinlich zu finden, wenn nicht Schlimmeres, obwohl der Topos so alt ist wie die Literatur selbst. Was die Kindsbräute angeht, ist es vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass Nabokov mit Lolita (1955) keine Tradition begründet hat, er hat sie beendet oder es doch versucht, die Rezeption seines Buches ist ein ganz anderes Thema.“
Schmidts Beziehung zu Edgar Allan Poe, der als Endzwanziger eine 13-Jährige geheiratet hat, ist vor diesem Hintergrund nur ein Spiel mit rein literaturgeschichtlichen Versatzstücken. Natürlich lassen sich dafür zahlreiche Indizien finden, und Arno Schmidts virtuose Form-Arrangements und seine ausgefeilte Spalten-Ästhetik entwickeln durchaus ihre Eigendynamik. Eines ist auf jeden Fall klar: Diese Arno-Schmidt-Biografie hat das Bestreben, ihrem Helden eindeutig zu huldigen und die Größe dieses Autors entsprechend zu feiern, mit allem Aufwand an philologischem Besteck. Und grundsätzlich ist dagegen nun wirklich nichts einzuwenden.
Sven Hanuschek: „Arno Schmidt. Biografie“.
Carl Hanser Verlag, München.
989 Seiten, 45 Euro.
Carl Hanser Verlag, München.
989 Seiten, 45 Euro.

