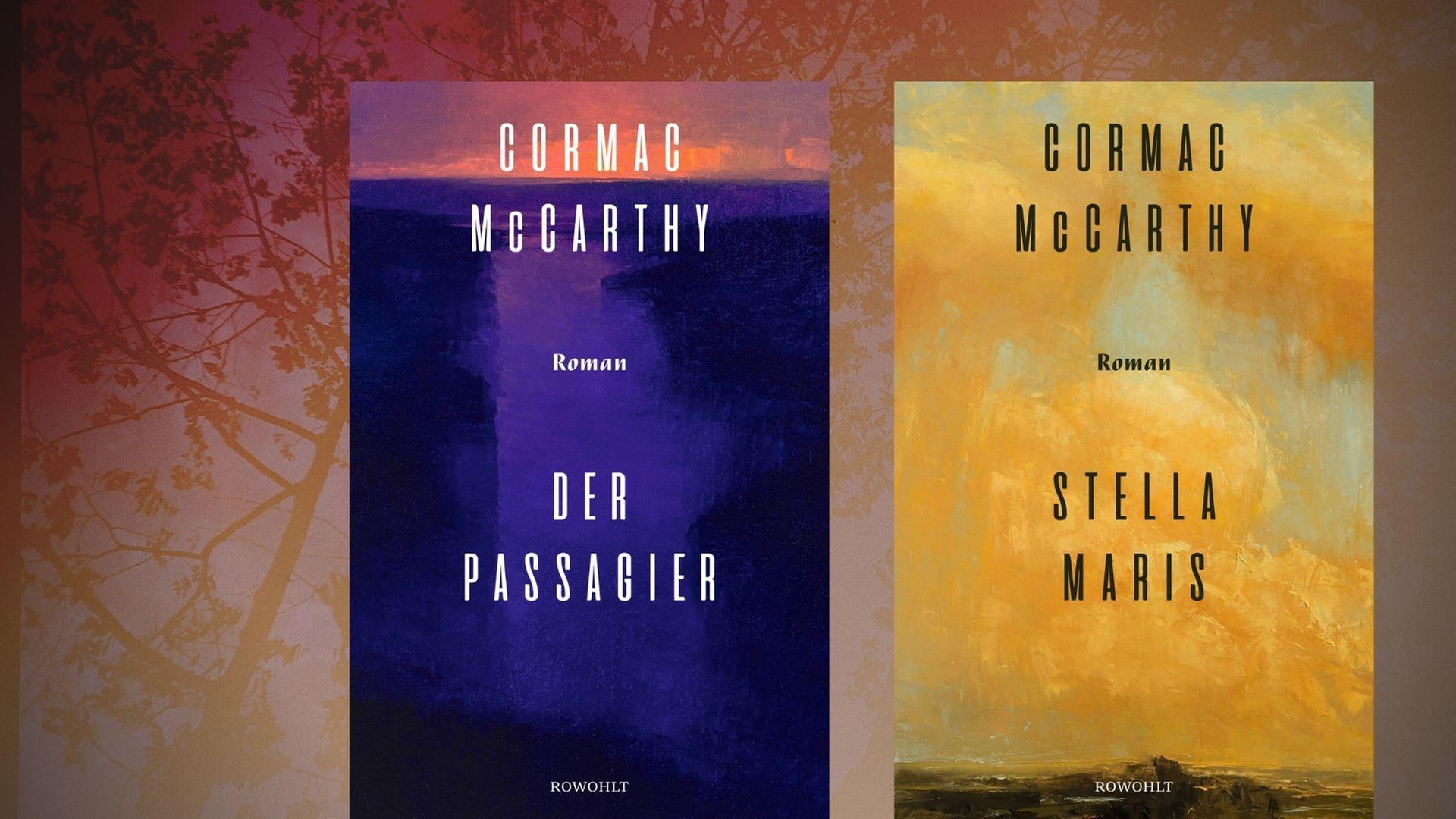
Schon immer war Cormac McCarthy ein Meister der effektvollen Exposition. In seinem frühen Roman „Draußen im Dunkel“ lässt er zum Auftakt eine Horde apokalyptischer Reiter auftreten und zu den Sternen aufblicken. In dem Roman „Verlorene“, der vielen seiner Bewunderer als McCarthys Hauptwerk gilt, unternimmt er zu Beginn eine Kamerafahrt durch eine nächtliche, dem Verfall preisgegebene Stadt und deren historische Schichten. „Der Passagier“, der neue Roman, eröffnet mit einer gespenstischen winterlichen Szene, in der die Intensität und Schönheit von McCarthys Tonfall und dessen hervorragende Übertragung ins Deutsche durch den Übersetzer Nikolaus Stingl gleichermaßen aufscheinen:
„In der Nacht hatte es leicht geschneit, und ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen, ihre Augen starr, kalt und hart wie Steine. Einer ihrer gelben Stiefel war vom Fuß gerutscht und stand unter ihr im Schnee. Ihre Jacke zeichnete sich weiß bestäubt im Schnee ab, wo sie sie fallen gelassen hatte, und sie trug nur ein weißes Kleid und hing zwischen den nackten grauen Stämmen der Winterbäume, den Kopf geneigt und die Hände leicht nach außen gedreht wie bestimmte christliche Statuen, deren Haltung dazu auffordert, ihre Geschichte zu bedenken. Den Urgrund der Welt zu bedenken, wo sie ihr Dasein im Leiden ihrer Geschöpfe hat. Der Jäger kniete sich hin, stellte sein Gewehr senkrecht neben sich in den Schnee, streifte die Handschuhe ab, ließ sie fallen und faltete die Hände. Er dachte, dass er beten müsste, doch für so etwas kannte er kein Gebet.“
Die junge Frau, die ihrem Leben in den Wäldern von Wisconsin ein Ende gesetzt hat, heißt Alicia Western und ist eine der beiden Hauptfiguren der Romane „Der Passagier“ und „Stella Maris“. Die Bücher sind im tatsächlichen Wortsinn Geschwister, erzählen sie doch auf formal radikal unterschiedliche Weise aus dem Leben der Geschwister Bobby und Alicia Western und ergänzen sich dabei, schließen Lücken des jeweils anderen Romans, stiften zugleich aber auch immer wieder neue Verwirrung. McCarthy selbst hat die Reihenfolge der Lektüre vorgegeben, indem er „Stella Maris“ auch im Original einen Monat nach „Der Passagier“ erscheinen ließ, doch lässt sich jedes der beiden Bücher auch unabhängig vom anderen lesen.
Tiefseetaucher mit Tiefenangst
„Der Passagier“ ist in seiner Anlage und in seinen Motiven ein klassischer McCarthy-Roman. Im Jahr 1980 kommt der Tiefseetaucher Bobby Western nach Pass Christian, etwa 100 Kilometer nordöstlich von New Orleans gelegen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Oiler hat er den Auftrag, ein abgestürztes und im Meer versunkenes Privatflugzeug zu bergen. Bobby leidet an Tiefenangst, und die Passagen, in denen Bobby das auf den Meeresgrund abgesunkene Flugzeug durchstreift, sind von einer düsteren Intensität:
„Langsam schwamm er über den Sitzen durch den Passagierraum, seine Druckluftflaschen schleiften an der Decke entlang. Die Gesichter der Toten nur Zentimeter entfernt. Alles, was aufschwimmen konnte, hing an der Decke. Stifte, Kissen, Styropor-Kaffeebecher. Papierblätter, auf denen die Tinte zu hieroglyphischen Schlieren zerlief. Immer beklemmendere Klaustrophobie. Er vollführte eine Rolle, wendete und schwamm zurück.“
Schnell sind Bobby und sein Kollege Oiler sich einig, dass hier etwas nicht stimmt. Nicht nur der Umstand, dass das Flugzeug trotz des angeblichen Absturzes unversehrt ist, macht die beiden Taucher misstrauisch. Es fehlen auch der Flugschreiber und der Koffer des Piloten. Vor allem aber befinden sich statt der auf den Listen angegebenen acht Passagiere nur noch sieben an Bord. Bobby und Oiler ahnen, dass hier Unannehmlichkeiten auf sie zukommen werden, zumal alles dafür spricht, dass die Insassen des Jets bereits tot waren, als das Flugzeug ins Meer stürzte. Als Bobby Western in der Nacht nach dem Tauchereinsatz in seine Unterkunft kommt, wird er bereits erwartet. Zwei Männer stehen vor seiner Tür und zeigen Bobby undefinierbare Dienstmarken. Was nun anhebt, ist einer jener aus dem Schweigen herausgemeißelten Dialoge, wie man sie von McCarthy kennt, balancierend auf dem Grat zwischen Komik und Bedrohlichkeit:
„Mr. Western, wir würden Sie gerne nach dem Tauchgang von heute Morgen fragen.
Nur zu.
Bloß ein paar Fragen.
Klar.
Der andere Mann beugte sich vor und legte die Hände, eine über der anderen, auf die Kante des Couchtischs. Er tätschelte die untere ein paarmal mit der oberen und blickte auf.
Eigentlich haben wir gar nicht viele Fragen. Sondern nur eine, allerdings ziemlich knifflige.
In Ordnung.
Offenbar fehlt ein Passagier.
Ein Passagier.
Ja.
Fehlt.
Ja.
Sie beobachteten ihn. Er hatte keine Ahnung, was sie wollten.“
Nur zu.
Bloß ein paar Fragen.
Klar.
Der andere Mann beugte sich vor und legte die Hände, eine über der anderen, auf die Kante des Couchtischs. Er tätschelte die untere ein paarmal mit der oberen und blickte auf.
Eigentlich haben wir gar nicht viele Fragen. Sondern nur eine, allerdings ziemlich knifflige.
In Ordnung.
Offenbar fehlt ein Passagier.
Ein Passagier.
Ja.
Fehlt.
Ja.
Sie beobachteten ihn. Er hatte keine Ahnung, was sie wollten.“
Inzest als Sehnsuchtsziel
Eines der Grundmotive im Werk Cormac McCarthys ist das Unterwegssein in den Weiten des Landes. In McCarthys berühmtestem, wenn auch nicht bestem Roman „Die Straße“ ziehen Vater und Sohn durch eine apokalyptisch verwüstete Landschaft. In „Draußen im Dunkel“ folgt eine junge Frau der Spur ihres in Blutschande mit ihrem Bruder gezeugten und nach der Geburt verschleppten Kindes. Bobby Western in „Der Passagier“ gerät in eine zunehmend unangenehme Situation: Sein Kompagnon Oiler stirbt bei einem angeblichen Arbeitsunfall; Bobbys Konto wird gesperrt, seine Post durchsucht. Er macht sich auf eine Reise, die naturgemäß auch einen Aufbruch ins Metaphysische darstellt. Nach und nach enthüllt McCarthy die Geschichte einer tragischen familiären Verflechtung. Bobby, der sein Physikstudium abgebrochen, sich als Autorennfahrer verdingt hat und schließlich zum Taucher wurde, ist nach wie vor in tiefer Trauer um seine Schwester Alicia. Ihr Suizid liegt etwa zehn Jahre zurück. Die beiden Geschwister waren in einer Liebe miteinander verbunden, die den Inzest als unerfülltes Sehnsuchtsziel in sich trug.
Cormac McCarthy ist ein Anti-Psychologe. Seine Figuren stehen in der Welt und handeln situativ; sie reagieren auf das, was ihnen geschieht. Sie suchen nach Erkenntnis, nach Erlösung und landen dabei nicht selten in einem Zustand, der nach gewöhnlichen Maßstäben als Wahnsinn bezeichnet wird. So ist es auch Alicia ergangen, einer hochbegabten Mathematikerin, die an Schizophrenie leidet. Den Erzählungen von Bobbys Flucht vor der diffusen Bedrohung sind vor jedem Kapitel Szenen aus Alicias Leben vorangestellt, die in der Logik der Chronologie bereits viele Jahre zurückliegen müssen. In ihnen befindet Alicia sich abgesondert in einem Wohnheim, hat ihre Medikamente abgesetzt und wird allnächtlich von einem Zwerg heimgesucht. Abgesehen davon, dass der Zwerg in Alicias engem Zimmer ganze Varieté-Shows auffährt, dringen die beiden in so grotesken wie scharf geführten Dialogen immer weiter in existentielle Bereiche vor. Der Zwerg, das ist Alicias dunkle Seite, die Inkorporation ihrer manifesten Ängste vor der Nutzlosigkeit der Wissenschaften:
„Hör zu, Süßerchen, flüsterte er. Du wirst nie erfahren, woraus die Welt besteht. Sicher ist nur eins, nämlich dass sie nicht aus der Welt besteht. Während du dich irgendeiner mathematischen Beschreibung der Realität näherst, geht dir das Beschriebene zwangsläufig verloren. Jede Untersuchung verdrängt, worauf sie sich richtet. Ein Moment in der Zeit ist ein Faktum, keine Möglichkeit. Die Welt wird dir das Leben nehmen. Aber vor allem und zu guter Letzt weiß die Welt gar nicht, dass es dich gibt. Du glaubst, dass du das verstehst. Aber das tust du nicht. Jedenfalls nicht im tiefsten Inneren. Denn wenn, dann würde dir grauen.“
Der ewige Leerlauf als Bauprinzip
„Der Passagier“ ist ein erzählerisch zerklüftetes Buch. Als Einstieg in das dunkle, faszinierende Universum des Schriftstellers Cormac McCarthy ist es nur bedingt geeignet. Das liegt zum einen daran, dass McCarthy sich in seinem Alterswerk kaum noch um einen stringenten Plot oder um Erzählökonomie kümmert. Über Seiten hinweg folgt man wortkargen Dialogen in Kneipen und Bars, die im Grunde keine andere Funktion haben, als ewigen Leerlauf zu illustrieren. Und auch den spektakulären, beinahe als Kriminalgeschichte angelegten Auftakt mit dem abgestürzten Privatflugzeug lässt McCarthy im Sande verlaufen.
Oder gerade doch nicht? Möglicherweise sind die riesigen Lücken, die „Der Passagier“ aufreißt, eben gerade nicht dem Desinteresse des Autors geschuldet, sondern Bestandteil eines theoretischen Gerüsts, das dem Roman zugrunde liegt. Wie sein Protagonist Bobby Western ist McCarthy stets ein Autodidakt gewesen. Glaubt man den Erzählungen der wenigen Vertrauten des zurückgezogen lebenden Autors, so hat McCarthy in den vergangenen Jahrzehnten viel Zeit am Sante Fe Institute in New Mexico verbracht.
An diesem Institut, gegründet von Murray Gell-Mann, Träger des Physiknobelpreises 1969, werden interdisziplinäre Forschungen zu Theorien von komplexen Systemen angestellt. McCarthy ist kein postmoderner Spieler, er meint es ernst, und er hat dieses Material aufgesaugt und verarbeitet. Geradezu verzweifelt stellen sich Bobby in „Der Passagier“ und auch seine Schwester Alicia in „Stella Maris“ Fragen, die das Verhältnis von Welt und Individuum betreffen und letztendlich allesamt in Sackgassen führen. Auch in dieser Hinsicht ist McCarthy ein Verkünder des Grauens: Er kennt die Welterklärungsversuche und verwirft sie als untauglich. Schlimmer geht es nicht. Realität und Traumebenen verschwimmen nach und nach, auch in Bobbys Bewusstsein, dem seine Schwester Alicia zu jeder Tages- und Nachtzeit vor dem inneren Auge steht:
„Er erwachte schwitzend, schaltete die Nachttischlampe ein, schwang die Füße auf den Boden und saß da, das Gesicht in den Händen vergraben. Hab keine Angst um mich, hatte sie geschrieben. Wann hat der Tod jemals irgendwem geschadet?“
Ist die Zeit nur ein subjektives Konstrukt?
Schon die Namensgebung Alicia und Bobby ist im Übrigen kein Zufall. „Stella Maris“, der mit rund 200 Seiten wesentlich straffere der beiden Romane, besteht ausschließlich aus sieben langen Gesprächen, die Alicia kurz vor ihrem Tod in einer geschlossenen Einrichtung mit ihrem Therapeuten führt. Ein flirrendes Wort-Pingpong, bestehend aus mathematischen Theorien, Reflexionen über die Konsistenz einer vom Wahnsinn grundierten Welt und der wie nebenbei mitlaufenden Rekonstruktion einer Familiengeschichte. Ihr Vater, so Alicia, habe Sinn für Humor gehabt, denn Bob und Alicia seien im akademischen Betrieb die Platzhalternamen für die Formulierung wissenschaftlicher Problemstellungen.
Zugleich verweisen die Anfangsbuchstaben der Namen auch auf die in den 1960er-Jahren aufgekommenen so genannten A- und B-Theorien der Zeit, in denen die Frage diskutiert wird, ob es so etwas wie ein Zeitkontinuum überhaupt gibt, oder ob es sich dabei lediglich um ein wahllos subjektives Konstrukt handelt. Genau diese Frage werfen „Der Passagier“ und „Stella Maris“ auf raffinierte erzählerische Weise auch auf, denn in Alicias Erzählungen im Jahr 1972 ist ihr Bruder Bobby bereits tot, gestorben bei einem Rennunfall. Ein Irrtum? Eine Wahnvorstellung? Oder eine parallele Realität? Das bleibt offen. Im Gespräch mit ihrem Therapeuten dreht Alicia immer wieder die Verhältnisse um und setzt ihre vermeintlich schizophrene Perspektive als die eigentlich Gültige:
„Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sich Patienten mit ihren Halluzinationen gewöhnlich nicht wohlfühlen. Meist verstehen sie, dass diese Erscheinungen eine Disruption der Realität darstellen, und das kann für sie nur beängstigend sein.
Für sie.
Ja.
Ich verstehe davon Folgendes: Im Kern der Welt der Verrückten ist die Erkenntnis, dass es eine andere Welt gibt und sie nicht Teil davon sind. Sie sehen, dass von ihren Wärtern nur wenig verlangt wird, von ihnen selbst aber viel.
Glauben Sie, das ist wahr?
Nein. Aber sie.“
Für sie.
Ja.
Ich verstehe davon Folgendes: Im Kern der Welt der Verrückten ist die Erkenntnis, dass es eine andere Welt gibt und sie nicht Teil davon sind. Sie sehen, dass von ihren Wärtern nur wenig verlangt wird, von ihnen selbst aber viel.
Glauben Sie, das ist wahr?
Nein. Aber sie.“
Mitarbeit am Manhattan-Projekt
Während „Stella Maris“, Cormac McCarthys erster Roman mit einer weiblichen Hauptfigur seit „Draußen im Dunkel“ aus dem Jahr 1968, den mikroskopischen Blick auf ein sich in Auflösung befindliches Bewusstsein wirft, geht es dem knapp 90-jährigen Autor in „Der Passagier“ um die großen amerikanischen Themen des 20. Jahrhunderts. Alles wird noch einmal angerissen: Der Vietnamkrieg, der Kennedy-Mord – und die Atombombe, für McCarthy der Sündenfall des 20. Jahrhunderts.
In dem Roman „Grenzgänger“, dem zweiten Teil seiner so genannten Border-Trilogie, wacht der Protagonist Billy Parham eines Morgens in der Wüste New Mexicos auf und wird vom Blitz einer in der Ferne gezündeten Atombombe geblendet, bevor Stunden später, wie es heißt, die echte, von Gott erschaffene Sonne aufgeht. Der Vater von Bobby und Alicia Western wiederum hat gemeinsam mit Robert Oppenheimer am Manhattan-Projekt gearbeitet, das schließlich zur Entwicklung der ersten Atomwaffe und zu deren Abwurf in Hiroshima führte. Alicias und Bobbys Eltern sind schon vor Jahren an Krebs gestorben. Auf seiner Flucht quer über den Kontinent macht Bobby auch an einem Ort seiner Kindheit Station und steigt dort auf einen Hügel, um in die Landschaft zu blicken:
„Er konnte das Haus seiner Großmutter sehen, die Scheune, den Fahrweg, die kleinen Nachbarfarmen dahinter, die gestückelten Felder, die Umzäunungen und Gehölze. Im Osten die gewellten Hügel und Kämme. Irgendwo dahinter, in Oak Ridge, die Anlage zur Uran-Anreicherung, die seinen Vater 1943 von Princeton hierhergeführt hatte, wo er die Schönheitskönigin kennenlernte, die er später heiraten sollte. Western war vollkommen klar, dass er seine Existenz Adolf Hitler verdankte. Dass die Kräfte der Geschichte, die sein bewegtes Leben in den Gobelin eingewebt hatten, die von Auschwitz und Hiroshima waren, jenen Schwesterereignissen, die das Schicksal des Westens für immer besiegelten.“
Wissenschaft, Wahnsinn, Erbschuld und Liebe. Nichts Pathetisches haftet diesen Geschwisterromanen an, die möglicherweise die letzten großen Romane eines Jahrhundertschriftstellers sind, und auch nichts Moralisches. Die Moral war für diesen Autor schon immer etwas, was an höhere Instanzen delegiert wird und außerhalb des menschlichen Zugriffs liegt. Das Wort „Gott“ kommt in „Der Passagier“ exakt 135mal vor. Zu seiner Großmutter sagt Bobby, an seinen guten Tagen hätten er und Gott die gleichen Ansichten.
Eine Sprache für die Schönheit und für den Schrecken
McCarthy hat ein ungeheures Gespür für Tonlagen. Er hat eine Sprache für den Schrecken der optisch und haptisch erfahrbaren Welt und ein unerschöpfliches Sensorium für die Schönheit der Natur. Dazwischen, und das ist kein Widerspruch, bewegen sich die Menschen als das Grausamste, das die Natur jemals hervorgebracht hat. In „Stella Maris“, der Titel ist identisch mit dem Namen der Heil- und Pflegeanstalt, in die Alicia sich selbst eingewiesen hat, unternimmt eine hochbegabte junge Frau den Versuch, im zynisch-resignierten Sprechen über sich selbst noch einmal die Potentiale aufzurufen, aus denen sich Schönheit und Sinn schöpfen lassen: die Musik, die Kunst, die Mathematik als eine in sich makellose und formvollendete Form des Denkens. Jedoch:
„Mathematik ist nichts als Schweiß und Mühsal. Ich wollte, sie wäre romantisch. Ist sie aber nicht. Im schlimmsten Fall gibt es hörbare Einflüsterungen. Es ist schwer, Schritt zu halten. Man wagt nicht zu schlafen, man war vielleicht schon zwei Tage wach, aber so ist das eben. Man trifft eine Entscheidung und stellt fest, dass einen zwei weitere Entscheidungen erwarten und dann vier und dann acht. Man muss sich zwingen, innezuhalten und zurückzugehen. Von vorn anzufangen. Man sucht nicht Schönheit, sondern Einfachheit. Die Schönheit kommt später. Wenn man ein Wrack ist.
Ist es das wert?
Wie nichts anderes auf der Welt.“
Ist es das wert?
Wie nichts anderes auf der Welt.“
Es ist kein Zufall, dass die Geschwisterromane mit Alicia beginnen und enden. Alicia ist der Gravitationspunkt der beiden Romane; das heimliche Zentrum, auf das sich die Sehnsüchte richten, um das die Gedanken kreisen. Alicia selbst wiederum ist keine Projektionsfläche, sondern vielmehr die pulsierende Kraft, die das Denken vorantreibt. Zwischen dem ewigen Schweigen der unendlichen Weiten und Meerestiefen, die Bobby auf der Suche nach Worten durchkreuzt, zwischen den Kneipengesprächen und stummen Selbstrückholversuchen, leuchten Alicias Brillanz und ihr Intellekt hervor. Wie die rote Schärpe, die sie sich am Tag ihres Suizids um ihr weißes Kleid gebunden hatte, um wie es heißt, im Schnee gefunden zu werden. Bei allen Brüchen und Leerstellen, die McCarthy lässt, rundet sich die Geschichte im letzten Gespräch zwischen Alicia und dem Therapeuten:
„Ich glaube, unsere Zeit ist um.
Ich weiß. Halten Sie meine Hand.
Ihre Hand?
Ja. Das möchte ich.
Na gut. Warum?
Weil es das ist, was Menschen tun, wenn sie auf das Ende von etwas warten.“
Ich weiß. Halten Sie meine Hand.
Ihre Hand?
Ja. Das möchte ich.
Na gut. Warum?
Weil es das ist, was Menschen tun, wenn sie auf das Ende von etwas warten.“
Im Wissen darum, wie dieses Ende sich konkret gestaltet, klingen diese Sätze nur noch umso eindrucksvoller, ja erschütternder nach. So sehr sich „Der Passagier“ und „Stella Maris“ den Lesern in ihrer Rätselhaftigkeit und ihrer Komplexität auch zunächst verschließen mögen – es sind die Romane eines Schriftstellers, der die dunkle Last seiner Geschichten in Literatur von Weltrang verwandelt.
Cormac McCarthy: „Der Passagier“
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Rowohlt Verlag, Hamburg. 526 Seiten, 28 Euro.
Cormac McCarthy: „Stella Maris“
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren*
Rowohlt Verlag, Hamburg. 240 Seiten, 24 Euro.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Rowohlt Verlag, Hamburg. 526 Seiten, 28 Euro.
Cormac McCarthy: „Stella Maris“
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren*
Rowohlt Verlag, Hamburg. 240 Seiten, 24 Euro.
*Wir haben den Namen des Übersetzers des Romans „Stella Maris“ in den bibliografischen Angaben korrigiert. Der Roman wurde von Dirk van Gunsteren ins Deutsche übersetzt.

