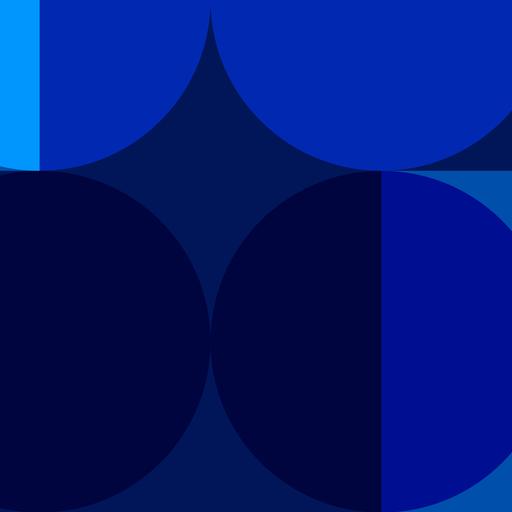Olga María Sánchez, eine freundliche dicke Frau mit langen schwarzen Haaren, führt uns einen schmalen Pfad bergab. Hindurch geht es zwischen satt grünen Kaffeesträuchern, an denen kleine gelbe und rote Bohnen und weiße sternförmige Blüten blitzen. Unten im Tal hört man den Río Quindío rauschen. Am Horizont, von Nebel umhüllt, liegen die Ausläufer der kolumbianischen Anden. Vorsichtig pflückt Olga ein paar der reifen Früchte.
"Schau mal, wir haben hier die Sorten Caturro, Arabica und eine eigene kolumbianische Varietät. Möchtest du eine Kaffeebohne probieren? Du musst die Haut leicht zusammendrücken. Aber beiß nicht rein."
Frisch vom Strauch schmecken die reifen Kaffeefrüchte säuerlich-süß. Die kleine Finca von Familie Sánchez liegt etwa eine Stunde zu Fuß außerhalb von Salento, einem kleinen Ort im Herzen des bergigen Eje Cafetero, dem wichtigsten Kaffeeanbaugebiet Kolumbiens. Wegen des gemäßigten Höhenklimas kann Familie Sánchez hier das ganze Jahr über ernten:
"Die Hälfte der Ernte behalten wir hier, um sie selbst zu verarbeiten. Wir verkaufen den Kaffee fertig geröstet - als ganze Bohnen oder gemahlen. Die andere Hälfte verkaufen wir an die Genossenschaften der Kaffeebauern und die exportieren dann den fertigen Kaffee."
Zwischen den Kaffeesträuchern stehen hohe Bananenstauden als Schattenspender. Mais, Bohnen und Yuca-Wurzel dienen der Selbstversorgung. Die Pflanzenvielfalt soll auch verhindern, dass der Boden zu schnell auslaugt. Familie Sánchez erntet und verarbeitet den Kaffee komplett von Hand. Da der Anbau weitgehend biologisch ist, gibt es häufig Ärger mit Schädlingen:
"Es gibt hier ein kleines Tier, namens Broca - Bohrer - das ernährt sich vom süßen Saft der Kaffeebohnen. Dabei durchbohrt es die Frucht und die kann dann nicht weiter reifen. Dieser Café brocado wird nicht exportiert, er bleibt hier für die Kolumbianer."
Viel Arbeit für eine Tasse Kaffee
Olga María führt uns in den winzigen Hinterhof des niedrigen Holzhauses, in dem ihre Familie wohnt. Unter einem Gewächshaus aus Bambusstangen und Plastikfolie liegen die gelben Kaffeebohnen zum Trocknen aus. Olga María füllt ein paar Hände voll in eine Metallschüssel.
"Die Bohnen muss ich jetzt gut säubern, die Haut muss ab, seht ihr? Und jetzt kommen sie auf´s Feuer zum Rösten. Eine mittlere Hitze, und man darf nicht aufhören sie umzurühren, eine volle Stunde lang."
Die gerösteten Bohnen verströmen ein verführerisches Aroma. In der Küche nebenan, die ebenfalls aus Bambusrohren besteht und nach zwei Seiten offen ist, macht Olga uns einen frischen Tinto - so nennen die Kolumbianer einen schwarzen Kaffee:
"Ganz schön viel Arbeit für eine Tasse Kaffee, nicht wahr?"
Wir verabschieden uns und gehen zu Fuß in Richtung Salento.
Die Höhensonne brennt auf der Haut. Die riesigen Eukalyptusbäume am Wegrand verströmen ein intensives Aroma. Grünlich schimmernde Kolibris schwirren blitzschnell zwischen Sträuchern mit roten kelchförmigen Blüten hindurch.
Die Sonne steht schon tief, als wir die Hauptstraße, die Calle Real, erreichen. Die alten bunt gestrichenen Häuser sind im für die Region typischen Bahareque-Stil erbaut: die Wände aus Reisig und Lehm, die Verandas und das Gebälk aus dem oberschenkeldicken Guadua-Bambus. Türen und Fensterrahmen sind blau, gelb oder rot gestrichen. Viele ältere Salentinos tragen den breitkrempigen Hut der Kaffeebauern, über der Schulter den Poncho und am Gürtel eine Machete.
Wir betreten ein kleines, zur Straße hin offenes Restaurant. An den einfachen Holztischen sitzen kolumbianische Familien und Rucksacktouristen aus Europa. Der stämmige Besitzer, Jorge Cañas, blau-weiß gestreiftes Hemd und beigefarbene Baseballmütze, führt uns in seine Küche.
Touristen treiben Mieten und Preise nach oben
Es riecht nach Frittierfett, der Boden ist rutschig. Jorges Neffe steht am Gasherd und schwenkt abwechselnd die Pfannen mit Forellen, Chorizo und Hühnerfilets. Jorges Tochter rührt in einem großen Topf mit kleinen roten Bohnen. Jorge Cañas:
"Heute gibt es bei uns Hühnchen, Forelle und Chorizo, für nur sechstausend Pesos, drei Dollar. Es gibt Maissuppe und diese kleinen Maistörtchen mit Käse und Zucker. Das ist hier ein beliebtes Gericht. Genau so wie Banane mit Suppe. Das bekommt man sonst selten, aber wir bieten das an. Die Touristen lieben es."
Die Touristen bringen aber nicht nur Geld, sagt Jorge Cañas, sie treiben auch die Mieten und die Preise in der Gastronomie nach oben. Viele Salentinos können es sich kaum noch leisten, essen zu gehen.
"Da sind wir auf die Idee gekommen, einen Corrientazo anzubieten, ein günstiges Menü für drei Dollar. Das ist dann zwar keine ganze Forelle, aber dadurch kommen auch Familien zu uns. So wie diese. Das sind sieben, acht Leute. Die haben draußen nichts unter sechs Dollar pro Person gefunden. Bei uns werden sie alle zusammen für 20 Dollar satt. Das schätzen die Leute an uns und so haben wir jeden Tag Gäste."
Vor wenigen Jahren noch gab es keine Touristen in Salento, erzählt Jorge Cañas. Denn damals kontrollierte die Guerilla die Region. Der Restaurantbesitzer lobt das umstrittene harte Vorgehen des damaligen Präsidenten Álvaro Uribe:
"Er schickte das Militär, um die Landstraßen zu bewachen. Daraufhin fingen die Menschen wieder an, sich frei zu bewegen und hierher zu kommen. Mit der Guerilla und der Zerstörung hier war es dann vorbei. Die Guerilla zog sich zurück und die gesamte Gegend hier war am Ende wieder vollkommen ruhig."
Wie Jorge Cañas sind viele Kolumbianer froh darüber, dass es nach jahrzehntelangem Konflikt inzwischen relativ friedlich ist in ihrem Land. Dabei erwähnen sie nur ungern, dass es bei Uribes Kampf gegen die Guerilla zu massiven Menschenrechtsverletzungen auch durch das Militär kam.
Tejo ist der Nationalsport Kolumbiens
Draußen auf der Straße wird es langsam dunkel, es ist still und bereits menschenleer. Wir verlassen die Calle Real und biegen in eine kleine mit Kopfstein gepflasterte Gasse ein. In einer kleinen Bar brennt noch Licht.
Durch einen schmalen düsteren Raum geht es an der Theke vorbei in eine große Halle aus Bambus und Wellblech. In dem erdigen Boden haben sich Kronkorken festgetreten. Eine Gruppe Jugendlicher trinkt Bier und spielt Tejo. Barbesitzer Víctor Alfonso Pérez, schwarze hoch gegelte Haare zeigt uns das Spiel.
In seiner rechten Hand wiegt Víctor eine etwa ein Pfund schwere Metallscheibe. In gebeugter Haltung, wie beim Boule, fixiert er einen etwa zwanzig Meter entfernten Holzkasten, der mit Lehm gefüllt ist. Er nimmt kurz Anlauf. Dann schleudert er die Metallscheibe kraftvoll durch die Halle.
Die Tejo-Scheibe hat ein kleines mit Schwarzpulver gefülltes Papierbriefchen getroffen. Drei Punkte gibt das. Víctor lächelt breit. Die übrigen Würfe landen dumpf klatschend im Lehm. Wer dem Zentrum des Kastens am nächsten kommt, der hat die Runde gewonnen. Víctor Pérez:
"Das hier ist ein typischer Sport, den schon unsere Großeltern gespielt haben. Tejo gibt es seit über 500 Jahren. Erfunden haben es indigene Kulturen aus der Region Boyacá. In ihrer Sprache nannten sie es Turmequé. Damals spielten sie es mit Scheiben aus Gold. Über die Jahrhunderte veränderte sich Tejo und heute spielen wir es eben mit diesem Metall. Gold ist einfach zu teuer."
Der Neunzehnjährige mit den abstehenden Ohren betreibt die Bar Los Amigos zusammen mit zwei Freunden:
"Das hier ist ein Familiengeschäft, es gehörte meinem Großvater. Am 29. Oktober ist er drei Jahre tot. Ich habe das Geschäft von ihm übernommen. Vor fünfzehn Jahren hat er die Bar aufgemacht. Damals gab es nur einfachere Unterhaltungsspiele. Aber dann hat er die Tejo-Plätze in der Halle angelegt. Damit hat alles angefangen."
Schon als Kind hat Víctor Tejo gelernt. Und mit den Jahren ist es zu einer Leidenschaft geworden. Als Betreiber der Tejo-Halle Los Amigos sieht er sich als eine Art Botschafter dieses Sports:
"Tejo ist der Nationalsport Kolumbiens. Mittlerweile spielt man es aber auch außerhalb des Landes. In Spanien gab es bislang erst ein Turnier. Aber inzwischen fangen sie auch in Venezuela mit dem Tejo-Spielen an und sogar in Argentinien. Wer weiss, vielleicht gibt es bald eine Weltmeisterschaft und wir nehmen an den Olympischen Spielen teil."
Víctor verabschiedet sich und wendet sich wieder seinen Freunden zu. Er will noch ein wenig trainieren. Nur noch wenige Besucher stehen auf dem sandigen Boden neben den Tejo-Bahnen. Ein Bier in der einen Hand, in der anderen die metallne Tejo-Scheibe.