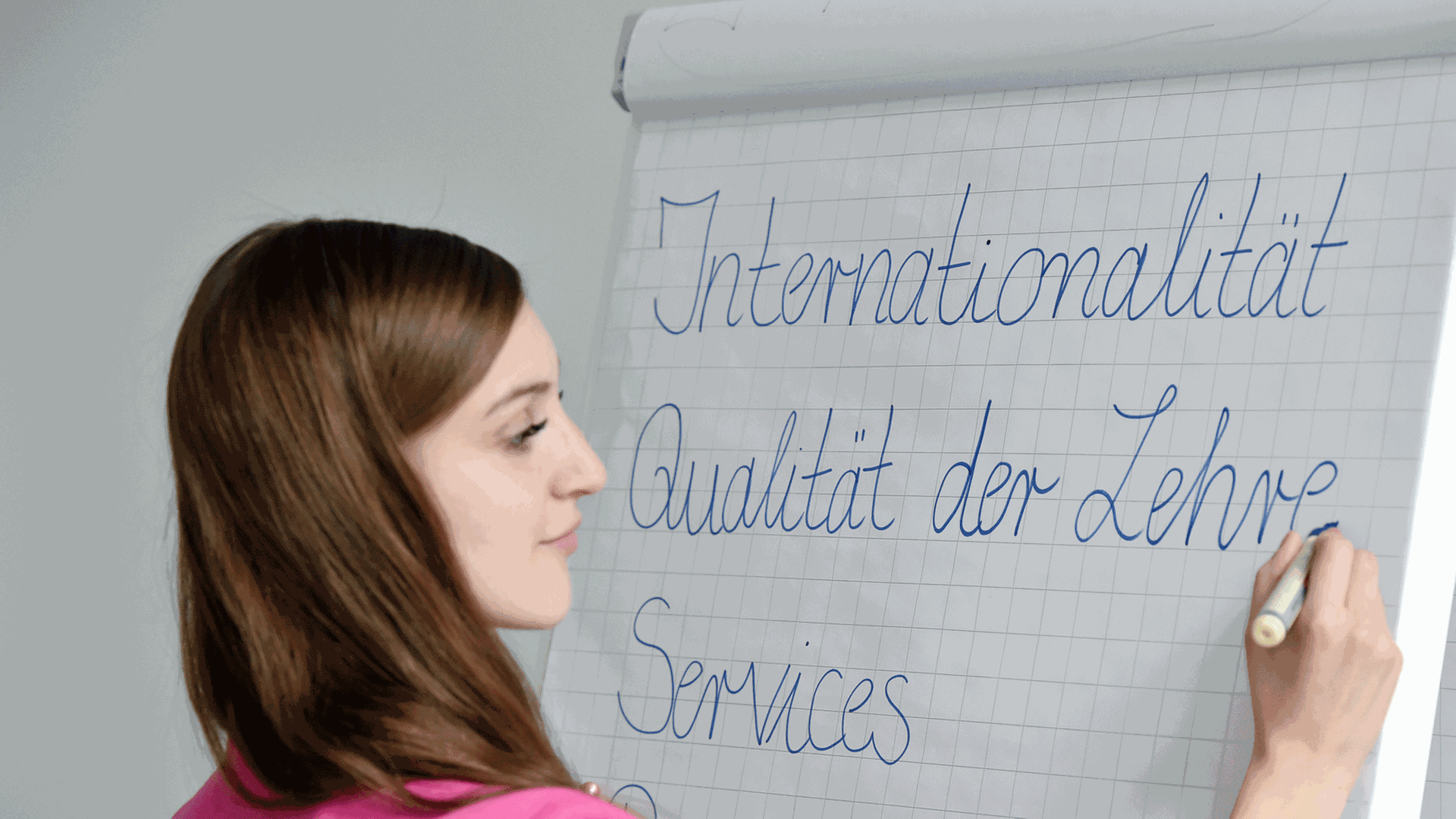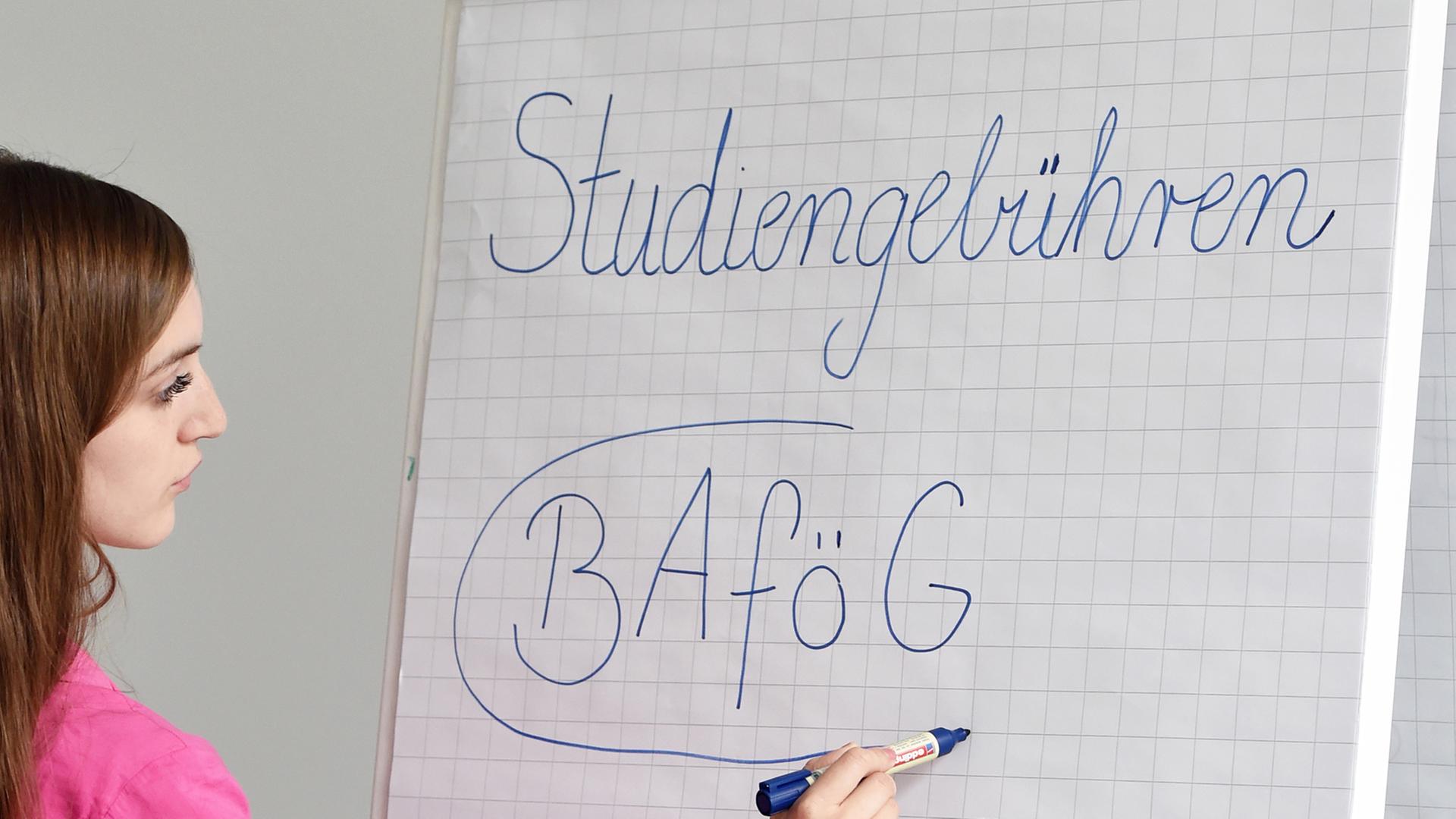
Kate Maleike: Doris Ahnen ist am Telefon, sie ist Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Guten Tag, Frau Ahnen!
Doris Ahnen: Guten Tag, Frau Maleike!
Maleike: Malu Dreyer, Ihre Ministerpräsidentin, sprach heute Vormittag von einem positiven Signal für den Bildungsföderalismus. Hätte der Bundesrat nicht heute noch ein noch positiveres Signal geben können, wenn er denn zum Beispiel hätte auch außer der Grundgesetzänderung für die Wissenschaft auch direkt das Kooperationsverbot für die Bildung verabschieden können?
Ahnen: Politik ist manchmal auch die Kunst des Machbaren. Und wir haben, glaube ich, jetzt ein ganz ordentliches Paket auf den Weg gebracht, das da sagt, dass einerseits die Länder entlastet werden, weil der Bund die BAföG-Mittel zu 100 Prozent übernimmt – damit können die Länder mehr in die Grundfinanzierung der Hochschulen finanzieren. Andererseits das Grundgesetz geändert werden soll, was vor allen Dingen ermöglicht, dass es dauerhafte Kooperationen im Hochschulbereich geben kann. Und beides brauchen wir und beides ist sinnvoll. Ich sage auch – und das ist ja auch heute so im Bundesrat zum Ausdruck gebracht worden –, es wäre schön, wenn man sich auch noch verständigen könnte, dass es neue Formen der Kooperation im schulischen Bereich gibt. Aber man darf das eine nicht von dem anderen abhängig machen, sondern wir müssen jetzt einen guten Schritt gehen. Und wir wollen einen weiteren Schritt gehen, darum werden wir noch ein bisschen ringen müssen.
Maleike: Kommen wir mal konkret zu den Großaufgaben, die Sie angesprochen haben, die auch der Bundesrat heute Morgen angesprochen hatte, Inklusion zum Beispiel, Schulsozialarbeit. Wie muss man sich das künftig vorstellen, wer ist da für was zuständig?
Ahnen: Sie diskutieren jetzt natürlich über den bisher noch nicht so gut gelösten Bereich. Ich kann das nachvollziehen, dass Sie in die Richtung fragen, ich sage aber auch, die öffentliche Debatte in den letzten Monaten war auch eine andere. Die Länder sind auch immer wieder aufgefordert worden, auch von der Öffentlichkeit, diesen im Hochschulbereich sinnvollen Schritt nicht zu blockieren. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, einen guten Schritt zu machen und gleichzeitig deutlich zu machen, dass es weitere Bedarfe gibt. Und die bestehen zum Beispiel in den Bereichen, die Sie genannt haben – im Bereich der Inklusion und auch im Bereich der Schulsozialarbeit. Hier strecken sich die Länder nach der Decke, im Übrigen gerade beim Thema Schulsozialarbeit auch die Kommunen. Wir haben hier noch keine neuen Lösungsmechanismen mit dem Bund. Wir haben den Bund gebeten, mit uns darüber zu reden, wie gerade auch in diesen Feldern Zusammenarbeit besser funktionieren könnte. Aber da muss man konstatieren: Das ist mit diesem Paket nicht gelöst.
Maleike: Frau Ahnen, das BAföG und die frei werdenden Gelder, da kämpft der Kita-Bereich gegen den Hochschulbereich und die Schulen gleich mit. Wie sinnvoll war das eigentlich, die frei werdenden Gelder zur freien Verfügung sozusagen zu stellen, hätte man das nicht irgendwie auch zweckbinden müssen?
Ahnen: Die Länder haben sich klar committet, dass dieses Geld für Bildung und Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden soll. Das tun die Länder auch. Welche Schwerpunkte sie setzen, hängt natürlich auch immer davon ab, welchen Ausbaustand sie in welchem Bereich haben. Klar ist, wir brauchen zusätzliches Geld für den Bildungsbereich, das heißt, in allen Ländern sind Dinge offen geblieben, die dringend angegangen werden müssen. Aber welche jetzt mit dieser BAföG-Entlastung prioritär angegangen werden, ist sicherlich auch ein Diskussionsprozess vor Ort.
Maleike: Würden Sie also auch sagen, dass das heute ein positives Signal aus dem Bundesrat für den Bildungsföderalismus gegeben hat?
Ahnen: Ich finde, es hat heute ein positives Signal für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Wissenschaftsbereich gegeben. Und ich finde, es sind neue Möglichkeiten, entstehen neue Möglichkeiten, wenn die BAföG-Entlastung so kommt, aber noch mal: Ich wünsche mir auch, dass wir im schulischen Bereich noch intensiver mit dem Bund zusammenarbeiten.
Maleike: Dann füge ich da jetzt die Nachricht an, die ebenfalls heute gekommen ist, nämlich von den drei Stiftungen Bertelsmann-Stiftung, Deutsche-Telekom- und Robert-Bosch-Stiftung. Die haben ein Positionspapier veröffentlicht. Und sie sagen, der Bildungsföderalismus steckt in der Krise und er muss deshalb in seiner gesamten Architektur weiterentwickelt werden. Und die drei Stiftungen fordern nun oder empfehlen die Einrichtung eines nationalen Bildungsrates. Was sagen Sie dazu?
Ahnen: Also ich glaube nicht, dass das eine richtige und realistische Betrachtung des Bildungsföderalismus ist. Ich finde, wenn man sich PISA anschaut, ist seither unglaublich viel passiert. Im Übrigen erkennen das ja durchaus auch nationale und internationale Organisationen bis hin zur OECD, die Deutschland oft kritisiert hat, an. Wir haben deutlich bessere Ergebnisse bei den Leistungsvergleichen und Ähnliches mehr, insofern, man muss nicht immer auf alles schimpfen, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, dass man sich weiter anstrengen muss. Aber ich sage auch mal, ich glaube nicht, dass es unser drängendstes Problem ist, dass wir jetzt ein neues Gremium einrichten, sondern das finde ich das Gute an der Bundesratsstellungnahme, wir benennen sehr konkret Bereiche. Und Sie haben sie ja auch nachgefragt, sie liegen ja auch auf der Hand, wo es gemeinsame Handlungsbedarfe gibt, zum Beispiel beim Thema Inklusion. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mal eine neue Runde drehen, dass wir uns darüber erst mal politisch verständigen – da gibt's im Übrigen auch den Bildungsbericht, der liegt längst vor uns, sagt das. Es kommt jetzt darauf an, Wege zu finden, dass man das tatsächlich auch umsetzen kann. Und insofern, ich glaube nicht, dass man die Probleme dadurch löst, dass man immer neue Gremien einrichtet, sondern bei Dingen, die sich auch durch Studien durchgesetzt haben, die allgemein anerkannt sind, geht es sehr konkret darum, Lösungswege zu finden für eine bessere Zusammenarbeit.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.