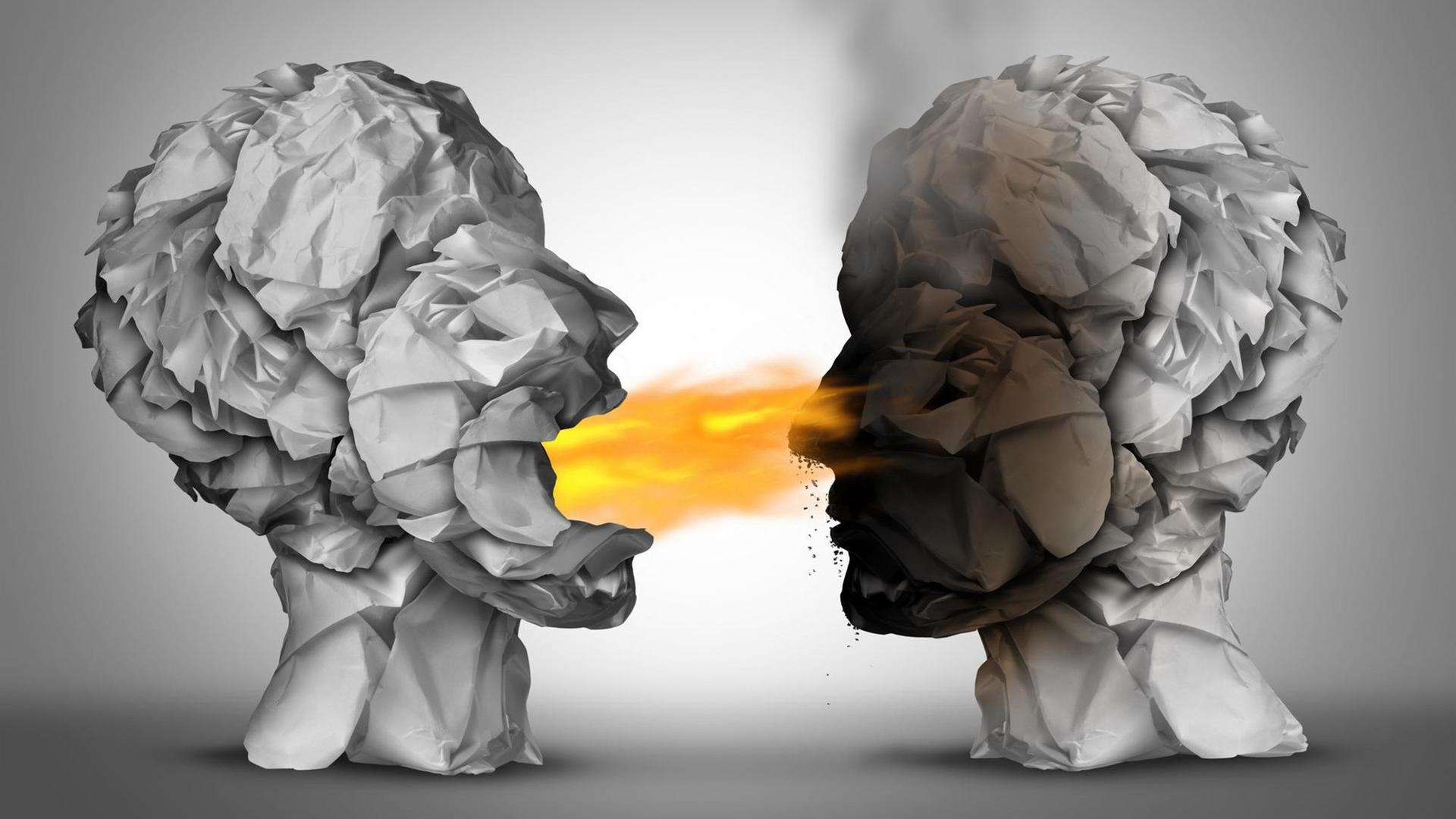Seit WDR-Intendant Tom Buhrow das Lied "Meine Oma ist ne alte Umweltsau" auf öffentlichen Druck hin aus dem Netz nehmen ließ, spätestens aber seit das Hamburger Literaturfestival Harbour Front die Kabarettistin Lisa Eckhart auslud, macht das Thema "Cancel Culture" die Runde – vor allem in den Sozialen Medien entwickelte sich das Thema im Jahr 2020 zu einem festgefahrenen Grabenkrieg um kulturelle Deutungshoheit. Dabei müsste das Phänomen differenzierter betrachtet werden, denn selbst das Canceln hat eine gute Seite. Nämlich dann, wenn es von den Künstler*innen selbst ausgeht und ihr eigenes Werk betrifft, wie etwa im Fall der US-Sitcom "30 Rock".
Unser Autor Tim Baumann möchte Impulse für fruchtbarere Diskussionen geben. Er hat sich für Corso mit Komiktheorie auseinandergesetzt und mit den Humorschaffenden Matthias Egersdörfer, Knacki Deuser, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Kaya Yanar gesprochen: über ihren Blick auf Komik, Grenzüberschreitungen, Medialität und Political Correctness. In diesem Online-Beitrag sind Ausschnitte aus Tim Baumanns Hörstück abgebildet – das gesamte Radiofeature ist als Podcast zum Nachhören verfügbar.
Komik als Störung
Einen Ansatz dafür, warum Komik so häufig von Empörung und Protest begleitet wird, bietet die Komiktheorie des niederländischen Soziologen Anton C. Zijderveld: Aus soziologischer Sicht ist jeder Teil des gesellschaftlichen Lebens durch Werte, Normen und die allgemein anerkannte Bedeutung von kommunikativen Codes wie Wörtern und Symbolen gekennzeichnet. Mit diesem Normalverhalten brechen Komiker*innen. Zijderveld schreibt:
"Komik stellt eine Art Störung oder Unordnung dar: Durch das Lachen darüber erklären die Leute diese Störung zu etwas Harmlosem. Zuerst schafft die Störung eine Art kognitiver und moralischer Dissonanz – die aber verschwindet dadurch, dass sie als harmlos erkannt und weggelacht wird. Der Erfolg hängt aber immer auch vom kulturellen Kontext des Publikums ab – das ist in der Soziologie von großer Bedeutung. Ein blasphemischer oder obszöner Scherz wird etwa bei der Armee einen völlig anderen Effekt haben als bei der Heilsarmee, wo er mit Sicherheit nicht als lustig und harmlos weggelacht würde. Daraus folgt: Das Lachen und die Komik sind unabhängig voneinander, aber beide sind abhängig vom sozialen und kulturellen Kontext."

Der Kabarettist Matthias Egersdörfer sieht in Grenzüberschreitungen und Tabubrüchen auf der Bühne zudem eine Art Ventil für das Publikum:
"Dass da vielleicht auch Gedanken ausgesprochen werden, die man vielleicht kennt, aber man würde das nie wagen, das in der Öffentlichkeit zu machen. Also dass ich da Sachen anspreche, die vielleicht bei einigen im Untergrund schlummern, aber die Vorstellung, dass man das wirklich äußert, diese Gedanken, das ist dann im besten Fall vielleicht so überraschend, dass man lachen muss."
"Kabarettisten sind keine Politiker"
Zentral ist für die Komik also nicht die Intention der Künstler*innen – schließlich gibt es auch unfreiwillige und umstrittene Komik - sondern, dass das jeweilige Publikum deren Verhalten als zwar irritierend, aber harmlos einordnet. Die Grenzüberschreitung sorgt für Spannung, die sich im Lachen des Publikums entlädt. Damit das funktionieren kann, ist es aber wichtig, dass die Provokation nicht allzu weit übers Ziel hinausschießt und sich damit den Rückweg in die Normalität verunmöglicht. Anton Zijderveld:
"Komische Aussagen, Handlungen und Ereignisse müssen als heiteres Spiel betrachtet werden, nicht etwa als Rebellion oder Revolution, die darauf abzielt, die institutionalisierte Ordnung zu verändern oder gar zu zerstören. Die kulturelle Ordnung zu zerstören, wäre für einen Komiker dasselbe, als wenn ein Kind sein Spielzeug zerstören würde. Tatsächlich sind die Werte, Normen und Bedeutungen seiner Umgebung die Spielzeuge des Komikers, eines heiteren homo ludens."

Gerade die Relativierung der Provokation ist für Erfolg in Comedy und Kabarett wichtig, sagt Knacki Deuser:
"Das muss man sich klarmachen: Auch Kabarettisten sind keine Politiker. Das sind Leute, die auf eine Bühne gehen und Tickets verkaufen. Sonst müssten sie einen anderen Job machen. Das heißt, die wollen provozieren, aber am Ende wollen sie die begeistern und wollen Erkenntnis schaffen. Das heißt, in der Regel will ich die vor den Kopf stoßen und etwas öffnen und dann bestenfalls das Saatgut der Erkenntnis reinlegen, das aber schon so schnell wächst, dass es kurz vorm letzten Applaus aufgeht, damit man da schon hat: Ach, so hat er oder sie das gemeint."
Und obwohl auch für Lutz von Rosenberg Lipinsky das gemeinsame Lachen alles andere als revolutionär ist, kann das Bühnengeschehen für ihn dennoch eine kleine, aber nicht belanglose politische Wirkung zeitigen:
"Man muss natürlich immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass das Publikum in aller Regel nur einen kleinen Teil der Gesellschaft ausmacht. Und oft genug nicht denjenigen, der seinerseits wirklich Macht besitzt. Das heißt, wir haben es schon immer auch damit zu tun, dass wir natürlich ein Ventil anbieten und dass man sich da auslachen kann. Und dass man gleichzeitig damit eben entspannt und gut gelaunt am Abend nach Hause geht anstatt stinksauer. Das heißt, das revolutionäre Potenzial wird da auf eine denkbar angenehme Weise aber doch letzten Endes zum Zusammensturz gebracht und nicht wirklich aufgeheizt. Und das ist dann doch auch versöhnlich und positiv. Also, ich meine das ja gar nicht negativ, aber ich würde schon sagen, da haben wir die Funktion, Mildtätigkeit und auch Verständnis in die Gesellschaft zu tragen. Und das funktioniert zum Glück ja größtenteils."
Bühne, Podcast, Social Media
Problematisch wird es, wenn Grenzüberschreitungen sich nicht mehr relativieren oder einordnen lassen. Ein Problem, das zum Teil in der Medialität begründet liegt. Lutz von Rosenberg Lipinsky:
"Also für mich gibt es einen entscheidenden Unterschied – und das ist der Unterschied zwischen live und medial. Also wer im Fernsehen auftritt oder eben tatsächlich gezielt Internetkanäle nutzt, um sich zu präsentieren, muss natürlich grundsätzlich davon ausgehen, dass dort bestimmte Effekte verpuffen, die bei einem Liveauftritt sehr, sehr gut funktionieren. Dazu gehören eben auch Kleinigkeiten wie unter Umständen Gestik, Mimik, oder aber auch ein Atmer oder aber auch eine Stimm-Modulation, die beim Livepublikum dazu führt, dass die sofort spüren, das war jetzt nicht ernst gemeint oder das relativiert sich mit dem, was wir auch vor zwanzig Minuten gehört haben, das ordnet sich ein. Wenn man diese Kurzauftritte ansieht und diese Häppchen daraus, dann muss man sagen, fallen unglaublich viele dieser Faktoren weg. Und das empfinde ich häufig als großes Problem."
Gerade die ausschnitthafte Verkürzung sorgt dafür, dass die Empörungsmaschinerie der Sozialen Medien zuverlässig ihre Skandale findet.
Ein aktuelles Beispiel für mediale Empörung über einen kurzen Ausschnitt ist der Eklat um Serdar Somuncu und Florian Schröder: In ihrem gemeinsamen Podcast bei Radio Eins hatte Somuncu in einem komisch gemeinten Wutanfall nicht nur auf der Verwendung des N-Wortes beharrt, sondern sich auch in inakzeptabler Weise sexistisch geäußert. Auf einer Bühne hätte das womöglich funktioniert – im Podcast nicht. Zu wenig unterscheidbar schien die Person Serdar Somuncu von seiner Bühnenrolle – denn das Format Podcast suggeriert Privatheit.
In den Sozialen Netzwerken wurde entsprechend heftig gestritten – und während die Seite der Empörten Serdar Somuncu und Florian Schröder als Sexisten und Rassisten entlarvt sah, unterstellten die Verteidiger der beiden den Kritikern Humorlosigkeit. Am Ende der Empörung standen eine Entschuldigung des Senders und der Künstler und eine Nachbearbeitung des Podcasts.
Man stelle sich vor, über was man hätte reden können, statt sich gegenseitig mit Labels wie Rassist oder humorloser Henker zu versehen – darüber, ob eine komische Intention die Verwendung des N-Wortes rechtfertigen kann. Über die Lust an der Provokation. Über die Frage, ob Serdar Somuncu seine Arbeit überhaupt als primär komisch versteht oder eher als Aktionskunst, die das Publikum am Ende eben nicht zurück in die Balance führt, sondern mit fragenden Gesichtern nach Hause schickt. Vieles davon wurde zwar angerissen, am Ende aber bleibt die Erkenntnis, dass mehr als ein Abwatschen nicht dabei herauskommen kann, wenn die Diskussionsgrundlage ein Dreiminutenausschnitt ist und der Rahmen für die Argumentation aus 280 Zeichen besteht.
Tabubrüche
Zwar hat auch dieses Abwatschen im Aushandlungsprozess gesellschaftlicher Regeln seine Berechtigung, nimmt es aber überhand, wird Dialog unmöglich.
Gerade der ist aber zwingend notwendig, wenn Komik Grenzen so weit überschreitet, dass andere darin keine Harmlosigkeit mehr erblicken können oder sogar verletzt werden. Ein Beispiel hierfür ist etwa das N-Wort. Für Knacki Deuser eine rote Linie – egal ob privat oder auf der Bühne:
"Also ich finde, man kann nicht alles sagen. Also, Sachen haben sich tatsächlich verändert. Da ändern sich Wörter. (…) Und dann hat man die gefälligst auch irgendwann mal zu akzeptieren und muss nicht immer sagen: Ja, aber ich hab das doch früher gesagt. Ja, Pech. Du hast es früher gesagt, ist ja auch okay, aber jetzt eben nicht mehr. Und vielleicht sagt man auch mal Entschuldigung und sagt, ich hab dazugelernt."
Der Comedian Kaya Yanar hingegen glaubt, dass auch grobe Provokationen auf der Bühne ihre Berechtigung haben:
"Weil das eine geschützte Atmosphäre ist im Theater auf der Bühne. Wenn der das nicht kann im Theater, wenn der Schauspieler, der Kabarettist, der Satiriker das auf der Bühne nicht kann, wo machen wir das dann? Sollen wir das wirklich in irgendwelchen Kneipen machen? Sollen wir das um Bierbänke herum versammelt machen? Da finde ich das ja schlimmer. Ich finds gerade gut, dass man das in so einer geschützten Kulturatmosphäre macht. Ich sage jetzt nicht, dass wir alles, was auf der Bühne passiert, unkommentiert lassen, um Gottes Willen, ich sage nur, wir müssen das tun dürfen – im Auftrag der Gesellschaft, wenn man das so pathetisch formulieren möchte."
Political Correctness
Da Komik von Grenzüberschreitungen lebt, birgt sie immer die Gefahr der Verletzung. Darum ist es für Matthias Egersdörfer entscheidend, wer die Torte ins Gesicht bekommt. In seinen Programmen ist das zumeist er selbst – beziehungsweise seine Bühnenfigur.
"Also ich finde es immer schwierig, wenn das aus einer gewissen Arroganz heraus kommt und dann gegen irgendwelche Leute geht, die sich nicht wehren können oder die sowieso schwach sind, also dann wird’s, glaub ich, schwierig. Wenn es gegen die Schwachen geht aus einer Stärkeposition heraus, dann ist es eigentlich scheiße."
Was Matthias Egersdörfer hier beschreibt, lässt sich im Reizwort Political Correctness zusammenfassen.
"Mir hat mal eine schlaue Frau erklärt, dass auch diese Auseinandersetzung mit dieser Political Correctness, dass das schon eine gewisse revolutionäre Tat ist, die grad passiert. Und ich glaube, da muss mehr verlangt werden, um ein Weniges zu erreichen. Und da geht’s halt manchmal nicht zimperlich zu."

Der Comedian Kaya Yanar warnt aber davor, die Komik der Vergangenheit im Giftschrank verschwinden zu lassen, denn auch das, was aus heutiger Sicht inakzeptabel sei, müsse als Dokument der Zeitgeschichte erhalten werden.
"Ich kann es verstehen, dass manche Dinge vielleicht aus heutiger Sicht absolut nicht gehen – also ich hab jetzt in meiner Karriere noch nichts entdeckt, aber ich kann das verstehen, dass man das rückwirkend zumindest kritisch analysiert. Aber das dann sofort zu canceln, find ich schwierig – vor allem, wenn es zwanzig Jahre her ist. Man kann halt den Zeitgeist von früher schlecht angreifen, weil der ist ja nicht mehr da."
Was tun?
Eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Debatte ist für Komiker*innen unerlässlich – hier muss jede*r seinen eigenen Weg finden: Kaya Yanar etwa hat seine Figur Ranjid in den sozialen Medien zur Disposition gestellt, Lutz von Rosenberg Lipinsky hingegen diskutiert in seinen Kabarettprogrammen direkt mit dem Publikum.
Wichtig bleibt dabei vor allem, die Debatte nicht als rein repressiv zu betrachten – denn Komik hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem enorm von der ständigen Aushandlung von Grenzen profitiert. Einen Hemmschuh für die Auseinandersetzung sieht der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky darin,
"... dass provoziert wird, aber nicht zurückgenommen wird. Und dass bei Gegenwind dann umgedreht wird und aus dem Täter das Opfer hervorgeht plötzlich, dieser klassische Mimimi-Gedanke. Und das ist dann letzten Endes auch nicht nur im Bereich der rechtspopulistischen Parteien so, das ist eben leider auch im künstlerischen Bereich vielfach so. Und da möchte ich echt mal sagen: Leute, macht euch locker. Aber auf allen Seiten. Denn wer provoziert auf der Bühne und auch meinetwegen mit Klischees spielt, der soll das auch machen – aber dann soll er es auch bitteschön machen und nicht hinterher so tun als hätte er es nicht gesagt. Und wenn dann andere Leute da keinen Spaß verstehen, dann muss man das auch so markieren und sagen: Ja, Entschuldigung, das war aber ein Spaß, den habt ihr nicht verstanden, tut mir Leid. Aber nicht so tun als würde jetzt eine Meinung unterdrückt, nur weil jemand anderer anderer Auffassung ist."

Letztlich findet die Aushandlung aber weder im Netz noch im Feuilleton statt, sondern auf der Bühne. Denn nur dort können die Künstler*innen gemeinsam mit dem Publikum ergründen, wo die Grenzen der Komik für diesen einen Abend und dieses eine Publikum verlaufen.