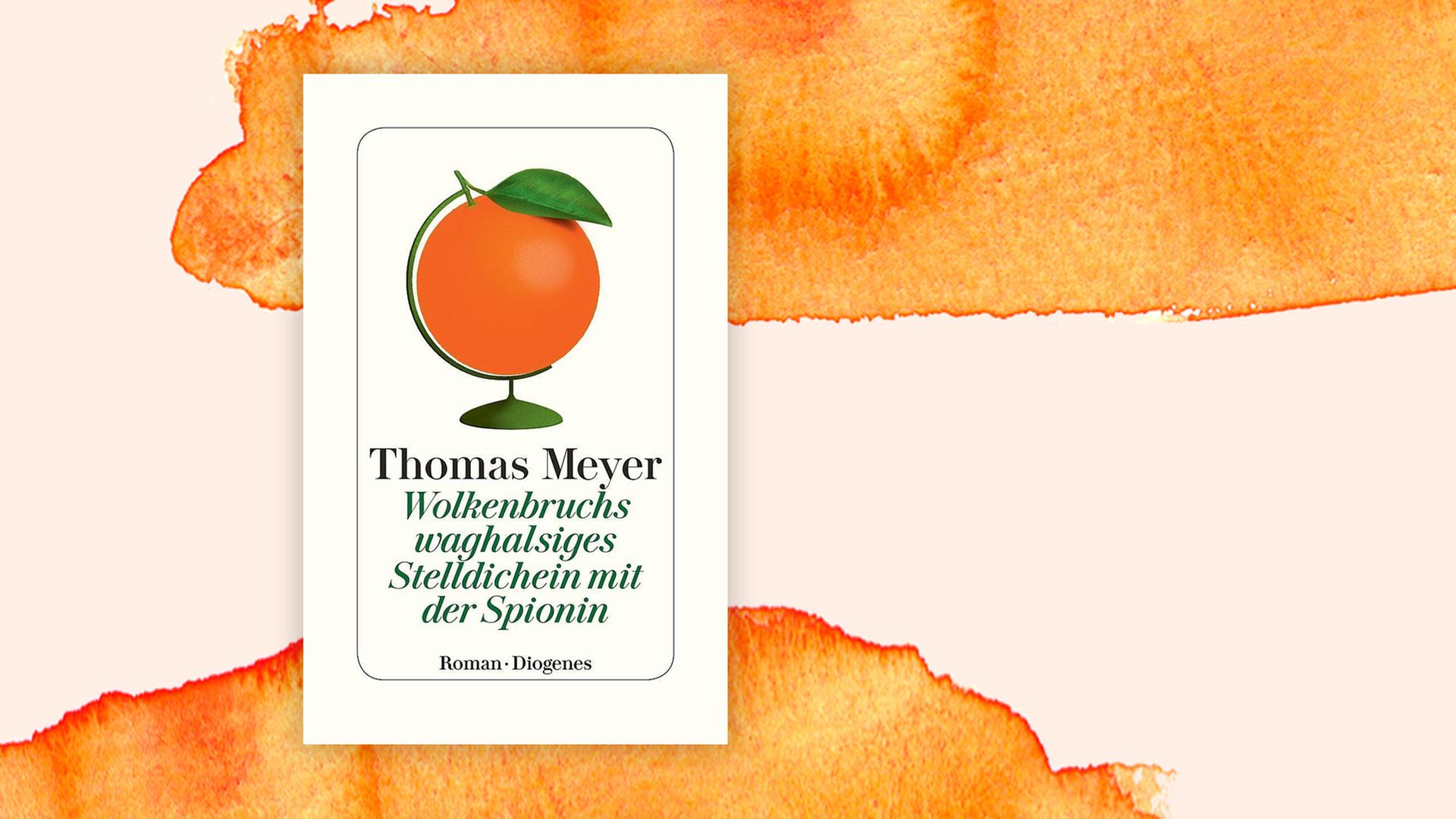Am Anfang steht "die schöne Bitte", und das erinnert an die gnadenlos komischen Katastrophengeschichten von Hermann Harry Schmitz, die 1911 unter dem Titel Der Säugling erschienen. Darin finden sich scheinbar arglos klingende Überschriften wie "Das verliehene Buch" oder "Onkel Willibald will baden", man ahnt schon das drohende Drama, und dann geht wirklich auch alles schief. Jetzt also "Die schöne Bitte". Sie kommt von Otto, dem Helden von Dana von Suffrins gleichnamigen Vaterbuch – das ihr Verlag keck "Roman" nennt – und unentrinnbar nimmt das Schicksal auch hier seinen Lauf:
"Die schöne Bitte war eine Art getarnter Befehl und funktionierte so: Erst bat Otto, dann bat er noch einmal, und schließlich klagte er in wehleidigem Ton darüber, dass er uns so schön gebeten hatte, und trotzdem hätten wir einfach ignoriert seine schöne Bitte. Er schlich sich, wie immer völlig lautlos, an uns heran und erschreckte uns mit der Bitte. Er sagte: Meine Kinder, ich habe in mir so viele schöne Erinnerungen, die ich euch bitte aufzuschreiben, bitte lasst unsere schöne Familiengeschichte nicht gelangen in Vergessenheit! Wer wird sich einmal erinnern an meine Familie, meine Länder, meine Abenteuer!"
Alle sind bekloppt
Nicht auszudenken, wenn Otto nicht so schön darum gebeten hätte. Es hätte uns um dieses Buch gebracht. Es erzählt seine Geschichte aus der Perspektive der Tochter Timna, die ihren gealterten Vater zusammen mit ihrer Schwester Babi umgibt und umhegt, auslacht und erträgt. Dabei sind eigentlich alle drei meschugge, und auch der Erzählerin dämmert das irgendwann, vielleicht dank ihres neuen Freundes, der zum genervten Zaungast dieses familiären Treibens wird: "Lange Jahre dachte ich, meine Familie sei normal."
Ist sie aber nicht, und das macht den Reiz dieses Buchs mit aus. Otto nicht, der aus Siebenbürgen kommt und von einem k.u.k.-Vater abstammt. Der seine Verfolgung als Jude überlebt, 1962 nach Israel auswandert, sein Land in vier Kriegen verteidigt und von dort einer ersten Ehe entkommt, der er ausgerechnet Deutschland vorzieht. Seine Integration, sprich: der Ingenieurs-Lehrstuhl an einer Fachhochschule, verdankt sich mehr als seinem Genie jahrelanger Bestechung in pünktlichen Monatsraten. Durchgeknallt auch seine zweite Frau, Mutter der beiden Schwestern, von der es heißt: "Ich glaube, das Leben meiner Mutter war schön, bevor sie meinen Vater kennenlernte."
Alltag nach Auschwitz
Für sie ist er irgendwann nicht nur der Wichser, sondern wird auch mal als rumänischer Jude beschimpft, wofür sie wiederum verhauen wird. Das gemeinsame Sorgenkind, Babi, hat sogar ein Intermezzo in der, wie es heißt, "Klapsmühle" hinter sich. Die Töchter erfassen irgendwann den Lauf der Welt, von dem offenbleiben muss, ob er auch auf das bedrohte Jüdischsein bezogen ist.
"… denn auch wenn alle Erwachsenen immer nur Andeutungen machten, hatten wir begriffen, dass unsere Familie viel zu klein war, dass uns überall der Tod nachstellte, dass nichts zusammenpasste; und dann waren aus greisen Kindern auf einmal kindische Erwachsene geworden."
"Otto" ist allerdings zum wenigsten ein Buch über den Holocaust – die Diskussion, ob man komisch über ihn schreiben darf, braucht nicht wiedereröffnet zu werden, die Gaskammern sind auch hier nicht lustig. Dafür ist es eins über das Leben als Juden und Einwanderer, erst in Haifa, dann in Deutschland. Darin bleibt die Schoah für die Überlebendengeneration anwesend, während anderes nach und nach schwindet, wie die religiösen Gebräuche.
Ich habe so eine Nummer nicht
So hat Otto immer die wichtigsten Dokumente zur Hand, für den Fall der Deportation, auch wenn er seinem Nachkriegsdeutschland mehr traut als der Ukraine – für ihn das Land der "Judenschlächter, Bestien und Hyänen" –, oder dem kommunistischen Rumänien, das die Familienvilla enteignet hat und sie nicht wieder rausrückt. Was seiner Familie und ihm widerfahren ist, ist nicht vollends klar, die Synagoge im transsylvanischen Kronstadt aber ist 1945 voller trauriger Juden, nichts als ein "See der Tränen". Ein Arzt in München rührt bei einer Routineuntersuchung unversehens daran:
"Wir sahen ihm zu, wie er den Arm unseres Vaters in seinen weißen weichen Händen hielt und […] nach den Venen tastete. Mein Vater hielt still und rief: Nein, ich habe so eine Nummer nicht! Wir sind davongekommen! Der Arzt ließ seinen Arm los und sagte: Ihre Venen!"
Für Ottos Töchter dagegen ist die Schoah nicht das alles tragisch Überschattende:
"… als uns in der siebten Klasse ein Bild des kurz nach der Befreiung von Buchenwald von seiner Pritsche fragend in die Kamera blickenden Elie Wiesel gezeigt wurde, war meine erste Assoziation: meine Familie im Wohnwagen (obwohl wir natürlich alle viel dicker waren)."
Die "zweite Generation" findet den Witz wieder
Dana von Suffrin liefert einen Blick der Nachkommen auf ihren jüdischen Vater und die Großeltern und damit ein, wenn auch komplett verschiedenes, Parallelbuch zu den 2006 unter dem Namen Lea Kirstein erschienenen autobiographischen Reflexionen "Die zweite Generation" – nur fast ohne jede Schwere. Die Ausgangslagen sind dabei lose verwandt, es geht um Alltag als Kind überlebender jüdischer Eltern im Nachkriegsdeutschland, um Ticks, die auf Traumata hindeuten, es gibt auch ein Schweigen und wenig Bewahrtes, Gerettetes, kaum Hinterlassenschaften:
"Es gab in unserer Familie keine Briefe oder Tagebücher vergangener Generationen."
So ist die schöne Bitte von Timnas Vater auch Rettungsversuch einer Welt von gestern, die mit ihm, dem letzten Überlieferer, untergehen wird. Otto sucht Halt in der Vergangenheit, trifft Siebenbürger sächsische Sonderlinge, nicht alle von ihnen Altnazis, findet das Gestern im Heute wieder:
"Ein paar Jahre später lobte er mich, wenn ich altertümliche Ausdrücke wie anno dazumal oder Oheim nutzte. Er ging in die Hocke und sagte, was hast du da gerade gesagt, mein Kind? Ich sagte: Anno dazumal waren wir mit dem Wohnwagen in Slowenien. Die Augen meines Vaters blickten wehmütig, und mein Vater sagte, woher hast du diese Wörter, in so schönen Wörtern hat dein Otata auch geredet […] dabei redete ich einfach so, wie Dagobert Duck in meinen Comics sprach …"
Getrunken wird, was auf den Tisch kommt
Für Otto sind das Puzzlestückchen teils verklärender Erinnerungen, die sonst aber hinter den Sensationen der Gegenwart zurücktreten: ein "neuer Aldi" verzückt ihn, Tiefkühlpizza Margherita im Dreierpack ernährt ihn, und er, der kein Buch anrührt, außer an Pessach die Haggada, sucht sich ein gesichtsloses neues Zuhause, ohne Seele:
"Doch Otto wollte das Reihenhaus, den Neubau, das Haus ohne Zeit und ohne Geschichte, vielleicht weil er selbst so viel Geschichte in sich hatte, dass er nicht von weiteren Geschichten umgeben sein wollte."
"Otto" ist dabei zuallererst ein Buch um einen immer hinfälligeren Vater, Buch des Abschieds, auch von der Mutter, die die Scheidung herbeigesehnt hat, als Alkoholikerin bös abgestürzt und "schon beim lieben Gott" ist. Aber selbst Gebrechen lassen sich komisch erzählen:
"Wir benutzten im Haus meines Vaters übrigens nur sehr ungern Gläser, weil wir wussten, dass er manchmal in sie pinkelte, um seinen Urin besser begutachten zu können oder um Nierensteine zu finden […] Als wir einmal Gäste hatten, wussten Babi und ich nicht weiter: Sollten wir ihnen auch … erzählen, dass wir aus Prinzip kein Glas verwendeten? Wir stellten ihnen und auch uns selbst die Gläser hin und ich musste am Tisch heimlich von einem Glas ein Stück milchigen Tesafilm entfernen, den mein Vater darauf geklebt hatte, um sich Farbton und Menge seines Urins zu notieren."
Das Fahren gibt mit Lebenswert
Was Deutsch als Fremdsprache-Lernende herunterbeten können, hat Otto in Jahrzehnten nicht recht gelernt: Im Deutschen steht das Verb im normalen Hauptsatz, ist es keine Frage ohne Fragewort oder ein Imperativ, an Position zwei, im Nebensatz jedoch am Ende. Seine verdrehten Wortstellungen oder deutsche Nachahmungen jiddischer Phrasen geben dem Ganzen eine Exotik, wie sie zu den Erfolgsrezepten eines doch bereichernd abweichenden Deutschs gehören, Kaminer & Co lassen grüßen. Das klingt dann so: "Haben die Fahrräder sich gut verhalten?"
Als Otto seine vergreisende Autofahrtüchtigkeit verteidigen will, indem er stolz an seinen rumänischen Volksarmeepanzerführerschein erinnert, verbittet er sich die zaghaften Widerworte seiner Tochter: "Was musst du herumspazieren in meinen Sachen? Das Fahren gibt mir Lebenswert."
Einzelne Stimmen verorten die Autorin schon in jiddischen Erzähltraditionen, sie selbst erwähnte einmal die New Yorker Dichter der Sweatshops. Das waren kämpferisch-rebellische, aber vor allem todernste Lyriker wie Morris Rosenfeld oder Joseph Bovshover, der im Irrenhaus endete, was auf ganz falsche Fährten führt und vielleicht auf die materiell unsichere Existenz verweist.
Schürzenjäger, zum Fremdschämen
Ich sehe Dana von Suffrins Debut eher in einer anderen Reihe starker Literatur, die allesamt um Einwandererfamilien kreist. Es ruft John Fantes grandiose Vaterfiguren ins Gedächtnis, allesamt italo-amerikanische Familientyrannen, Weinsäufer und zunehmend hinfällige Schürzenjäger, zum Fremdschämen und doch heißgeliebt; es erinnert an Sergej Dovlatovs jüdisch-armenisch-russisches Familienalbum Naschi – "Die Unsren" – und an Henryk Grynbergs "Flüchtlinge", heimatlose Polen und Juden.
Diese Bücher sind ebensosehr von einer Komik, die manchmal vergessen lässt, dass es darin auch um Krankheit und Sterben, um Abschiede geht oder ums Überleben und Davongekommensein. Dana von Suffrin hat nicht die Familienchronik schreiben können, um die ihr Vater sie gebeten hatte. Zu bruchstückhaft sein herrliches Erinnern und Erzählen.
Herausgekommen ist vielleicht viel mehr als das: eine Beschreibung miteinander geteilter Zeit, die die Bundesrepublik ab den achtziger Jahren wachruft, ein deutsch-jüdisches Familienbuch, das voller Neugier und Staunen ist angesichts der unvertrauteren Seiten eines irgendwann jungen und attraktiven Vaters, die vorm Erleben der Tochter liegen, ein fast zärtliches, seinem Anderssein stets zugewandtes, würdevolles Vaterbuch, das mit Witz unterhält, ohne an Tiefe einzubüßen, und heute seinesgleichen sucht.
Dana von Suffrin: "Otto"
Kiepenheuer & Witsch, Köln. 234 Seiten, 20 Euro.
Kiepenheuer & Witsch, Köln. 234 Seiten, 20 Euro.