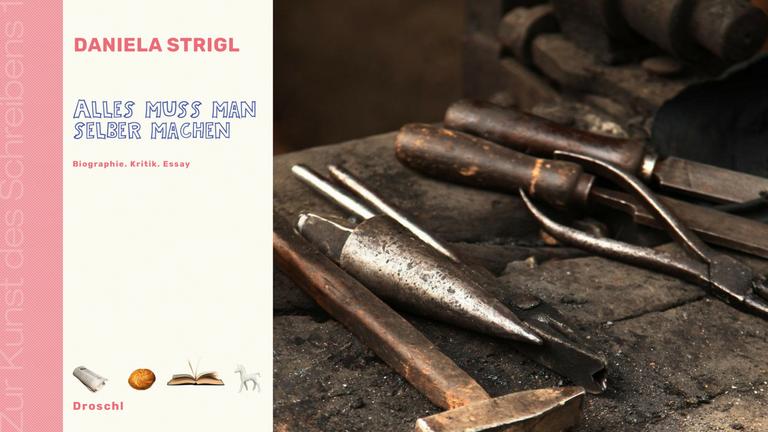
Was eine Poetikvorlesung ist, was sie darf und was sie leistet, wurde im Zusammenhang mit Christian Krachts Frankfurter Vorlesungen viel diskutiert. Das Format, ein Hybrid aus Autobiographie, Poetologie und literarischen Strategien, wurde 1959 an der Universität Frankfurt als Brückenschlag zwischen Dichtkunst und Wissenschaft initiiert. Mit gesteigertem Interesse des Literaturbetriebs an Autor und Werkstattpoetik in den 90er-Jahren erfährt das Format im deutschsprachigen Raum einen regelrechten Boom und wird heute an über 30 Universitäten angeboten. Die stilistischen und inhaltlichen Ausrichtungen des programmatisch offenen Genres variieren. Gemeinsam ist den zahlreichen Vorlesungen, dass es in der Regel Schriftsteller sind, die aus der Praxis ihres Schreibens im Hörsaal eine Poetik destillieren. Die Universität Graz variiert dieses Konzept: Hier sprechen auch Wissenschaftler und Kritiker.
Öffnung der Universitäten für die Praxis
Fragen nach dem Fiktionalisierungsgrad rücken bei deren Ausführungen in den Hintergrund, manche Herausforderungen sind jenen der dozierenden Schriftsteller ähnlich. Daniela Strigl beginnt ihre Vorlesung in Graz wie viele Poetikdozenten vor ihr mit einem Eingeständnis:
"Was ich hier tue, kostet mich Überwindung. Ich bin es nicht gewohnt, über mich zu sprechen, statt über eine Sache, die meistens die der Literatur ist."
Mit diesen Sätzen reiht sie sich nahtlos ein in die rhetorische Tradition von Poetikdozenten, ihre eigene Rolle kritisch zu hinterfragen. Sie bekunden Unfähigkeit oder Angst – und sind im Folgenden der Aufgabe dennoch gewachsen. So auch Strigl, in deren Vorlesungen sich "Persönliches", "ein bisschen Theorie", Erfahrungsschilderungen und "Auszüge aus den Diskussionen" abwechseln.
Die Öffnung der Universitäten für die Praxis befürwortet die Kritikerin im rückblickenden Gespräch nach ihrer Vorlesung:
"Das sind lauter Dinge, die in die Schreibpraxis hinein reichen und die eben mehr Leute interessieren als die im Elfenbeinturm Beheimateten."
Biographie, Kritik und Essay
Strigl, die sich vor kurzem am Wiener Institut für Germanistik mit einer Biographie über Marie von Ebner-Eschenbach habilitierte und für ihre Tätigkeit als Literaturkritikerin mehrfach ausgezeichnet wurde, zeigt in ihren Vorlesungen unterschiedliche Kontexte des Schreibens und deren Schnittstellen an drei Genres auf - Biographie, Kritik und Essay. Gilt die Biographie etwa in der akademischen Welt als wenig geschätzte Textsorte zweifelhaften Rufs, funktioniert die breitenwirksame Literaturvermittlung nach wie vor am besten über das Andocken an das Schriftsteller-Bild. Strigl bekennt sich zu missionarischem Eifer und entscheidet sich im Zweifelsfall gegen formale Experimente, um etwaige Kritiker der Biografie zu beeindrucken und für das Erzählen für ein Lesepublikum: "Der Theorie zum Trotz".
Als trotzig oder widerspenstig könnte man auch Strigls Haltung zum Literaturbetrieb beschreiben. Ihre Überzeugung, dass man nicht nur über Literatur reden könne, wenn es in Wirklichkeit um ökonomische Verflechtungen und betriebliche Allianzen geht illustriert der Band anschaulich mit entsprechenden Fallbeispielen aus ihrer Arbeit: Von der Causa André Heller, die als österreichische "Literaturbetriebsposse" ins deutsche Feuilleton einging bis zu Strigls empörter Replik auf eine Literatursendung, in der Kritiker Nobelpreisträger als Idioten diffamierten. Gleichzeitig ermöglicht die Einbettung aktueller Diagnosen in einen breiten historischen Rahmen mit Referenzen von Tucholsky bis Kerr der Kritikerin eine Relativierung der immer wiederkehrenden Klage zur Krise der Kritik:
"Das gibt sich alles. Zeitungskrise, E-Book, Content, Depression, Emphase, Shortlist, Longlist, Literarisches Quartett, das gibt sich. Die Literaturkritik wird es überstehen. Die Literatur sowieso."
Es geht nicht um "Lektürepartnervermittlung"
Während Strigl den Essay als Gattung der Freiheit charakterisiert, der alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen kann, simuliert sie diese Freiheit, wenn sie Kritiken schreibt mit einem Trick: Sie versetzt sich in einen Zustand des Als-ob und tut, als gehöre sie nicht zum gemeinsamen Markt. Das passt zu ihrem hohen Anspruch an das Metier: Historisch ein Erbe der Aufklärung, geht es der Literaturkritik nach Strigl eben nicht um "Lektürepartnervermittlung", sondern um Erkenntnis:
"Ich glaube ja nicht, dass Lesen gesund macht oder schön, auch nicht unbedingt glücklich. Aber es bereichert auf jeden Fall und das kann man nur schreibend und redend weiter geben. Es ist halt eine Vertiefung oder Intensivierung des Lebens, wenn man liest und das ist momentan nicht Konsens in der Gesellschaft."
Wie in der eigenen Arbeit das Vertiefen in Texte an einem magischen Punkt in "closest reading" umschlägt, an dem sich eine "neue und aufregende Freiheit der Verknüpfung" ergibt, sich ein Zustand "poetisch-wissenschaftlicher Erleuchtung" einstellt, das beschreibt Strigl elektrisierend im dritten und letzten Kapitel.
"Literaturwissenschaftlerin, die sich nicht schämt, Essayistin zu sein"
Überzeugt die erste Vorlesung zur Biographie mit Einblicken in die Annäherung an etwas, das strukturell uneinholbar ist und der zweite Teil mit Strigls streitbarem Plädoyer für eine wahre Kritik, die dem jeweiligen Werk gerecht zu werden versucht, so ist es die dritte Vorlesung zum Essay, die Zusammenhänge von Lesen, Schreiben und Denken verdichtet. Hier wird deutlich, wie willkürlich die Grenzziehungen zwischen literarischem und nicht-literarischem Schreiben manchmal sind. Strigl bezeichnet sich als "Literaturwissenschaftlerin, die sich nicht schämt, Essayistin zu sein" und reklamiert Enthusiasmus, ein letztes Moment des Unerklärlichen und das, was Schriftsteller als "flow" bezeichnen auch für den eigenen Arbeitsprozess:
"Ich glaube, es ist wirklich ein rätselhaftes Umschlagen von Sitzfleisch in Geist. Man kann den nicht forcieren, man kann ihn nur herbei führen durch intensive Lektüren und dadurch, dass einige Zeit vergangen ist, in der man sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigt hat. Und dann stellt es sich so ein, dass es unverkennbar ist. Man weiß dann einfach: Jetzt ist es genug. Jetzt fügt sich‘s. Es wird evident."
Vielfach ist im Band vom wechselseitigen Bedingen von Schreiben und Denken die Rede. Klar zeigt sich: Poetik bedeutet Kunst und Handwerk. Eine zusätzliche Dimension dieser Erkenntnis erfuhr Strigl während der Arbeit am Manuskript aufgrund einer schweren Schulterverletzung am eigenen Leib:
"Das war vielleicht auch eine Erfahrung aus dem Ganzen, wie sehr meine Existenz mit Schreiben verknüpft ist."
Von der Spanischen Hofreitschule bis zum Niedergang der Semmel
"Alles muss man selber machen" ist ein leidenschaftliches und geistreiches Buch, das konsequent vermeidet, was Strigl als "das Schlimmste" bezeichnet: Langeweile. Der Titel entpuppt sich nicht zuletzt als Aufforderung, nicht abzuwarten, bis andere aktiv werden, sondern sich selbst einzumischen, auch in Angelegenheiten, die über die Germanistik hinaus gehen: Von der Spanischen Hofreitschule bis zum Niedergang der Semmel. Wenn das Buch eine Gebrauchsanweisung ist, dann ist es eine zum Selbst-Denken.
Vor allem aber ist Daniela Strigls Poetikvorlesung ein Essay, der selbst eindrücklich realisiert, was seine Autorin vom Genre im Anschluss an Lichtenberg erwartet: Ein Experimentieren mit Ideen, das nachvollziehbar Machen eines gedanklichen Umherschweifen statt des Entwurfs eines festgefügten Denkgebäudes, ein Ort der Erfahrung und der Subjektivität.
Im Hintergrund wirkt bei jedem Essay, der sich selbst ernst nimmt eine Utopie, stellt Strigl am Ende ihrer Vorlesungen mit Verweis auf die allererste Poetikdozentin in Frankfurt, Ingeborg Bachmann, fest, und schließt mit einem Zitat aus deren Vorlesung, das ihre Leser freuen wird:
"Denn dies bleibt doch: sich anstrengen müssen mit der schlechten Sprache, die wir vorfinden, auf diese eine Sprache hin, die noch nie regiert hat, die aber unsere Ahnung regiert und die wir nachahmen. (…) Es gilt, weiterzuschreiben."
Daniela Strigl: "Alles muss man selber machen"
Biographie. Kritik. Essay
Droschl Verlag, Graz/Wien. 152 Seiten. 15 Euro
Biographie. Kritik. Essay
Droschl Verlag, Graz/Wien. 152 Seiten. 15 Euro

