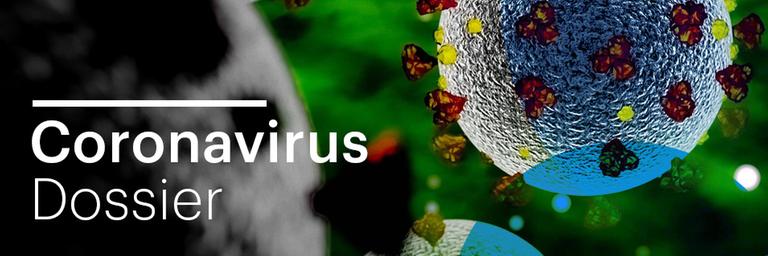Das Coronavirus hat gezeigt, wie stark global vernetzt die Welt ist – und doch ist gerade in diesen Zeiten häufig vom "Ende der Globalisierung" die Rede. In den ersten Wochen der Pandemie war die erste Reaktion: Abschottung, nationale Alleingänge. Die Frage, warum auf ein grenzüberschreitendes Virus mit nationaler Abschottung und Grenzschließungen reagiert wurde, sei auf verschiedenen Ebenen zu beantworten, sagte Sonja Levsen, Historikerin an der Universität Freiburg, im Dlf.
"Sich auf das Bekannte, das Nationale besinnen"
Zum einen auf psychologischer Ebene: Der nationale Reflex, die Grenzen zu schließen sei weniger eine rationale politische Strategie als vielmehr eine emotionale Reaktion gewesen in einer Situation der Unübersichtlichkeit und der Dynamik, in der man sich auf das Bekannte und Übersichtliche, also die Nation, besinnen möchte.
Sodann seien "die Nationalstaaten im Moment das am effektivsten organisierte Instrument", erklärte die Historikerin Sonja Levsen. Gerade die Exekutive sei beim schnellen Handeln häufig am effektivsten.
In der Medienberichterstattung sei zusätzlich gerade zu Anfang der Pandemie plötzlich sehr viel mit nationalen Stereotypen gearbeitet worden.
Immense Kosten der Grenzschließungen
Im Hinblick auf Infektionszahlen und Maßnahmen gegen die Pandemie sei es darüber hinaus zu einer Art Wettstreit gekommen. Dieser habe zu aggressiven Abgrenzungen und Selbststilisierungen, sowie auch zur Abwertung des jeweiligen Nachbarn geführt, so Levsen.
Für künftige Krisen sei zu fragen: Wie lässt es sich verhindern, dass die nationalen Staaten einzeln und potenziell gegeneinander agieren. Welche grenzüberschreitenden Institutionen, welche Kooperationen brauche es, damit beispielsweise die EU auch ein stärkerer Faktor sein könnte: "Damit auch die immensen Kosten, die Grenzschließungen mit sich bringen, vermieden werden können."