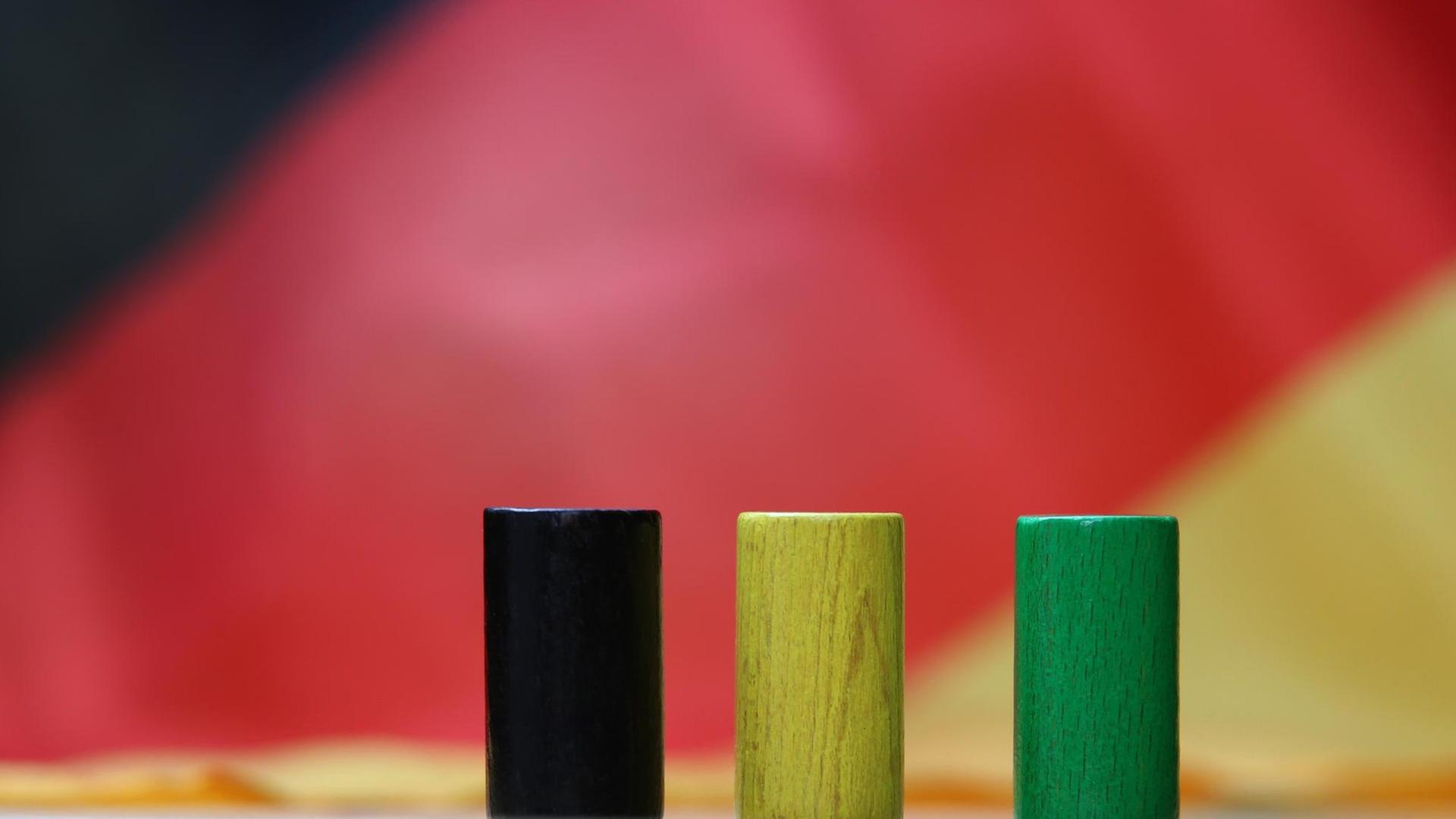
Von Klaus Remme, Monika Dittrich, Barbara Schmidt-Mattern, Katharina Hamberger, Gudula Geuther und Theo Geers
Der genaue Zeitpunkt war alles andere als zufällig. Das Projekt Jamaika platzte am Sonntag kurz vor Mitternacht, da war die selbst gesteckte Frist für das Ende der Verhandlungen, 18.00 Uhr, schon seit Stunden verstrichen - doch, hey, irgendwo auf dieser Welt ist es immer 18.00 Uhr und kurz vor Mitternacht ist es ausgerechnet in Jamaika 18.00 Uhr. Die Verhandlungen liefen schon den ganzen Tag über nicht gut, Hoffnungszeichen am gestrigen Nachmittag hatten sich wieder in heiße Luft aufgelöst.
Aus Sicht der FDP hatte man schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zeit zugegeben, den Samstag drangehängt, den Sonntag drangehängt, jetzt reichte es. Nach einer letzten Gesprächsrunde standen Parteichef Christian Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki auf. Längst vorbei die Euphorie der ersten Phase, als Kubicki versichert hatte: "Wir stehen nicht als Erste auf." Lindner redet eigentlich gerne frei, er redet in der Regel auch über längere Zeit druckreif. Diese kurze Erklärung am Sonntag kurz vor Mitternacht hatte er sich aufgeschrieben, ausgedruckt und eine gute Stunde vorher in die Innentasche seines Anzugs gesteckt. Kernsatz: "Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren."
"Keine gemeinsame Vertrauensbasis"
Lindner ist in diesem Moment umgeben von Mitgliedern der liberalen Verhandlungsdelegation. Die Erschöpfung nach wochenlangen Sondierungsgesprächen steht den Frauen und Männer ins Gesicht geschrieben, während ihr Parteichef erläutert, warum ein Jamaika-Bündnis mit CDU, CSU und Grünen für die FDP nicht in Frage kommt:
"Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten."
"Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten."
Was für ein Paukenschlag: Viele Beobachter hatten fest damit gerechnet, dass es spätestens in der Nacht auf Montag einen Durchbruch geben würde, dass sich CDU, CSU, FDP und Grüne auf eine Regierungsbildung einigen würden. Immer wieder war von der staatspolitischen Verantwortung der Jamaika-Sondierer die Rede: Wer sonst solle eine Koalition bilden, da die SPD in die Opposition will und ein anderes Bündnis rechnerisch nicht möglich oder mit Blick auf die AfD politisch nicht gewollt ist? Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zu diesem Zeitpunkt an die Kompromissbereitschaft der Verhandlungsteams appelliert.
"Die Möglichkeit des Scheiterns"
Nun ist es anders gekommen. Doch im Rückblick muss man sagen: Das war ein Abbruch mit Ansage. Dass die FPD von allen Beteiligten am ehesten bereit war, die Sondierungsgespräche zu verlassen, hatte Christian Lindner immer wieder angedeutet. Zum Beispiel Anfang November.
"Es steht fifty fifty. Wir streben keine Neuwahlen an, fürchten aber auch die Wählerinnen und Wähler nicht."
"Es steht fifty fifty. Wir streben keine Neuwahlen an, fürchten aber auch die Wählerinnen und Wähler nicht."
Keine Angst vor Neuwahlen: Da war sie bereits, die Möglichkeit des Scheiterns. Schon beim Auftakt der Sondierungsgespräche hatte Christian Lindner die mögliche Koalition als "vierblättriges Kleeblatt" beschrieben und darauf verwiesen, dass es sich dabei um seltene Exemplare handele. Und die FDP war am Verhandlungstisch in einer Ausnahmesituation.

Anders als bei Union und Grünen gab es keine innerparteilichen Querelen, Christian Lindner ist als Parteivorsitzender unangefochten. Anders als Union und Grüne brauchte die FDP keinen Verhandlungserfolg, um die Bundestagswahl zu einer Erfolgsstory zu machen. Ihr Wiedereinzug in den Bundestag war - durch die Parteibrille gesehen - der eigentliche Erfolg für diese Legislaturperiode.
Und das Projekt Wiederaufstieg ist aus Sicht von Christian Lindner mit diesem Erfolg keinesfalls abgeschlossen. Es geht darum, das Image der Partei nachhaltig zu verändern. Die Liberalen müssen nach der politischen Katastrophe alles dafür tun, nicht erneut als opportunistische Mehrheitsbeschaffer zu gelten, als Partei, die alles mitmacht, nur um zu regieren. Christian Lindner, Anfang November im Interview mit dem ZDF:
"Wenn ich zwischen zwei Vorwürfen wählen kann: Der erste ist, ihr seid nicht kompromissbereit genug, und der andere Vorwurf: Ihr habt Euch verbogen, ihr seid die Umfaller, ihr steht nicht zu Eurem Programm, ihr habt vor der Wahl etwas ganz anderes gesagt. In dem Fall lasse ich mir lieber zu viel Prinzipien vorwerfen. Als keine zu haben."
"Wenn ich zwischen zwei Vorwürfen wählen kann: Der erste ist, ihr seid nicht kompromissbereit genug, und der andere Vorwurf: Ihr habt Euch verbogen, ihr seid die Umfaller, ihr steht nicht zu Eurem Programm, ihr habt vor der Wahl etwas ganz anderes gesagt. In dem Fall lasse ich mir lieber zu viel Prinzipien vorwerfen. Als keine zu haben."
Groko-Politik, garniert mit grüner Petersilie
Im Wahlkampf hatte Christian Lindner versprochen: Wir machen keine Koalitionsaussage. Wir stehen für uns selbst. Und wir wollen nicht um jeden Preis mitregieren.
"Wir sind auch bereit zur Übernahme von Verantwortung. Wir wollen gestalten und nicht nur protestieren. Wir wollen Gutes bewirken. Opposition mag bequem sein. Aber wir wollen nicht bequem regieren, sondern wir wollen unser Land voranbringen. Wenn es also möglich ist, Trendwenden zu erreichen, dann sind wir dabei. Wenn es aber nicht möglich ist, Trendwenden zu erreichen, dann wäre es verantwortungslos. Denn dann ist unsere Rolle: Opposition."
"Wir sind auch bereit zur Übernahme von Verantwortung. Wir wollen gestalten und nicht nur protestieren. Wir wollen Gutes bewirken. Opposition mag bequem sein. Aber wir wollen nicht bequem regieren, sondern wir wollen unser Land voranbringen. Wenn es also möglich ist, Trendwenden zu erreichen, dann sind wir dabei. Wenn es aber nicht möglich ist, Trendwenden zu erreichen, dann wäre es verantwortungslos. Denn dann ist unsere Rolle: Opposition."
Opposition, so könnte es nun kommen. Sicher ist das nicht. Fragt man Christian Lindner, wie es nun weitergeht, wird er einsilbig. Neuwahlen sind aus seiner Sicht noch keine zwingende Konsequenz der gescheiterten Sondierung. Die FDP sieht es so: In den vier Wochen der Sondierungsgespräche ist uns inhaltlich eine Fortführung der Groko-Politik, garniert mit grüner Petersilie, angeboten worden. Der Weg der SPD in eine Regierungsbeteiligung ist aus Sicht Lindners deshalb erheblich kürzer als der für die FDP. "Wir haben ernsthaft verhandelt", versicherten die Liberalen und mit Blick auf die Sozialdemokraten nehmen sie für sich in Anspruch, es wenigstens versucht zu haben.
Welche inhaltlichen Punkte am Schluss ausschlaggebend waren für den Ausstieg der FDP, blieb am Montag weitgehend diffus. Die großen Streitpunkte bei den Sondierungen allerdings waren seit Wochen bekannt: Klima-, Flüchtlings- und Finanzpolitik.
Symbolwert Solidaritätszuschlag
Beispiel Solidaritätszuschlag. Vor allem die FDP wollte den 5,5-prozentigen Zuschlag auf die Einkommenssteuerschuld in dieser Legislaturperiode abschaffen, im Idealfall ab 2020 komplett für alle. Der Union war dies wegen der Einnahmeausfälle von Anfang an zu teuer. Ihr schwebte ein Stufenmodell vor, mit einer Entlastung von zunächst vier Milliarden Euro in einem ersten Schritt. Die Grünen waren beim Soli nicht festgelegt.

In den Sondierungen stieg der Symbolwert des Soli für die FDP dann sehr schnell. Denn für andere Formen der Steuerentlastung wie die Senkung von Mittelstandsbauch oder Kalter Progression ist die Zustimmung der 16 Bundesländer notwendig, von denen zehn derzeit von der SPD regiert oder mitregiert werden. Da konnten sich alle Jamaika-Sondierer leicht ausrechnen, wie das ausgehen würde. Denn SPD-Ministerpräsidenten wie Stephan Weil aus Niedersachsen hatten sich schon vor der Wahl festgelegt: "Ich bin sehr für Steuerentlastung, und das kann der Staat auch bezahlen, aber der Staat – das ist in diesem Fall der Bund."
Kein Soli hieße Mindereinnahmen von mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr
Auch deshalb vertrauten die Liberalen lieber auf das, was im Bund allein entschieden werden kann - und das war der Soli, dessen Einnahmen allein an den Bund fließen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer: "Die anderen Gesprächspartner haben nicht den Mut zu großen Steuerreform, die insbesondere kleinere und mittlere Einkommen entlastet, die Kalte Progression beseitigt. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf das Versprechen, den Soli abzuschaffen bis 2019."
Das Problem der FDP: Kein Soli mehr ab 2020 hieße Mindereinnahmen beim Bund von mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr. Für 2020 und 2021 wären das zusammen mehr als 41 Milliarden Euro - nur in den letzten beiden Jahren dieser Legislatur. Damit hätte die FDP den Spielraum, den der geschäftsführende Finanzminister Altmaier zuletzt für die gesamten vier Jahre auf 45 Milliarden Euro bezifferte, fast für sich allein beansprucht. Das wollte noch nicht einmal die Union mittragen, erklärt Ralph Brinkhaus - der Haushaltsexperte der CDU.
"Wenn wir dann ab 2019, 2020 über eine Jahresbelastung von 20 Mrd. Euro reden, dann ist das viel. Dann muss man sich entscheiden, gibt man das Geld für einen schnellen Soli-Abbau aus oder gibt man es lieber für Bildung, Kinder und andere Dinge aus."
"Wenn wir dann ab 2019, 2020 über eine Jahresbelastung von 20 Mrd. Euro reden, dann ist das viel. Dann muss man sich entscheiden, gibt man das Geld für einen schnellen Soli-Abbau aus oder gibt man es lieber für Bildung, Kinder und andere Dinge aus."
Auslöser für den Ausstieg
Also mussten Kompromisse her. Der zuletzt gehandelte sah vor, den Soli stufenweise abzubauen und ganz im Sinne von Union und Grünen bei den unteren und mittleren Einkommen zu beginnen. Dadurch, so die Darstellung der Grünen, wären Dreiviertel aller Steuerzahler vom Soli befreit worden. Zusätzlich war man bereit, der FDP ein Enddatum auch für das letzte Viertel der besserverdienenden Soli-Zahler zu geben. Dieses Datum würde allerdings erst in der nächsten Wahlperiode, also nach 2021, liegen. Das wurde dann zu einem Auslöser für Christian Lindners Ausstieg aus den Sondierungen.
"Und am Ende des Abends war der Kompromissvorschlag der CDU ihr eigenes Wahlprogramm in Fragen des Soli und das war nach so vielen Wochen dann doch zu viel für uns. Der Kompromiss sollte sein, die FDP übernimmt das Wahlprogramm der CDU in Fragen des Soli."
"Und am Ende des Abends war der Kompromissvorschlag der CDU ihr eigenes Wahlprogramm in Fragen des Soli und das war nach so vielen Wochen dann doch zu viel für uns. Der Kompromiss sollte sein, die FDP übernimmt das Wahlprogramm der CDU in Fragen des Soli."
Das reichte der FDP offenkundig nicht, denn eine Befreiung von Dreiviertel der Steuerzahler vom Soli wäre - in Euro und Cent - auf eine geringere Entlastung hinaus gelaufen, als es der FDP vorschwebte. Und zum Nachlegen kam es dann nicht mehr, erzählt Cem Özdemir von den Grünen.
"Als wir dann in die Schlussrunde gingen, sind wir mit dem Mandat da reingegangen, noch mal drauf zu legen. Das heißt, wir hätten in der bestehenden Legislaturperiode ein Gesetz gemacht, um aus dem Soli auszusteigen, die letzten Stufe wäre dann möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode gewesen, wobei man auch hätte darüber reden können, aber wir hätten noch mal was drauf gelegt, dass auf die 75 Prozent, die schon bei dem ursprünglichen Vorschlag vollständig entlastet worden wären, noch was drauf gekommen wäre."
"Als wir dann in die Schlussrunde gingen, sind wir mit dem Mandat da reingegangen, noch mal drauf zu legen. Das heißt, wir hätten in der bestehenden Legislaturperiode ein Gesetz gemacht, um aus dem Soli auszusteigen, die letzten Stufe wäre dann möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode gewesen, wobei man auch hätte darüber reden können, aber wir hätten noch mal was drauf gelegt, dass auf die 75 Prozent, die schon bei dem ursprünglichen Vorschlag vollständig entlastet worden wären, noch was drauf gekommen wäre."
Die Entlastung der Steuerzahler vom Soli lässt damit erst einmal auf sich warten. Wiedervorlage ist sicher.
Knackpunkt Migration und Flucht
Einer der härtesten Brocken der Jamaika-Sondierungen war das Thema Migration und Flucht - es stand immer im Raum, dass sich die Verhandler hier nicht einigen werden können. Vor allem im Fokus: Das Recht auf Familiennachzug für diejenigen, die in Deutschland subsidiären Schutz erhalten haben. Die Große Koalition hatte dieses Recht für subsidiär Schutzberechtigte eingeführt. Wobei mit Familie hier nur die Kernfamilie gemeint ist, also der Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Anfang 2016 - nachdem 2015 die Flüchtlingszahlen massiv gestiegen waren - dann der Schritt zurück: Das Recht auf das Nachholen der Kernfamilien wurde für die subsidiär Schutzberechtigten wieder ausgesetzt. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, CDU, begründete das damals so: "Wir haben das ausgesetzt bis Mitte 2018, weil wir nicht wollten, dass die Zahl so groß ist."

Von Anfang an ging es bei der Auseinandersetzung um den Familiennachzug vor allem um Zahlen. Zum einen darum, wie viele subsidiär Schutzberechtige in Deutschland leben. Die CSU schätzt, dass es bis Ende dieses Jahres rund 300.000 sein werden, vor allem Syrer und Iraker. Aber es ging immer auch darum, wie viele Menschen jeder einzelne Flüchtling nachholen könnte.
Fest steht, dass solche Zahlen falsch sind. Das Bundesinnenministerium geht seit einigen Monaten davon aus, dass einem Flüchtling im Schnitt ein Angehöriger folgt. Woher diese Annahme stammt, wurde nicht begründet. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dagegen kommt auf eine sehr viel geringere Anzahl. Nachzugsberechtigt wären nach Ansicht der Wissenschaftler 50- bis 60.000 Angehörige. Bei weitem nicht alle davon, so glauben sie, würden tatsächlich kommen.
Dennoch wollten CDU und CSU - und auch die FDP - dass der Familiennachzug auch nach März 2018 für die Bürgerkriegsflüchtlinge weiter ausgesetzt bleibt. So haben CDU und CSU dies auch als Begrenzungs-Maßnahme in ihrem Kompromiss zur Obergrenze, dem sogenannten "Regelwerk zur Migration", festgehalten. Darin heißt es, die Zahl von 200.000 aus humanitären Gründen aufgenommenen Menschen solle nicht überschritten werden.
Kompromiss zum Greifen nah
Die Grünen hingegen waren von vornherein gegen die Aussetzung des Familiennachzugs und entsprechend auch nicht die Verlängerung dessen: "Ich appelliere da an Sie, lassen Sie den Familiennachzug wieder zu. Sei es aus christlichen Gründen, sei es aus humanitären Gründen", forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Große Koalition noch im November vergangenen Jahres auf. Bei den Sondierungen trafen also zwei diametral entgegengesetzte Positionen aufeinander.
Immer wieder wurde das Thema bei den Jamaika-Gesprächen aufgerufen - ohne nennenswerten Fortschritt. Die Grünen blieben bei ihrer Position, der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige dürfe nicht weiter ausgesetzt werden. Die Union, vor allem die CSU, machte das "Regelwerk zur Migration", zum Maßstab aller Dinge

Die FDP wusste die Union auf ihrer Seite. Am Sonntagabend schien alles auf gutem Wege zu sein. Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sprach von einer konsensualen Lösung, die Grüne und Union - und damit wohl auch die FDP - mittragen hätten können. Der Kompromiss war offenbar zum Greifen nah und entgegen vieler Erwartungen resümierte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Laschet: Der Familiennachzug sei am Ende kein Thema gewesen, an dem eine Jamaika-Koalition gescheitert wäre.
Uneinigkeit bei der Klimapolitik
Ein weiteres Streitthema der Sondierungen: Die Klimapolitik:"Wart Ihr heute schon in der Früh da? Jaaaa…" Die Szene war wohl kalkuliert: Bevor CSU-Chef Horst Seehofer am Samstagabend die CDU-Parteizentrale in Berlin verließ, schritt er - umringt von Kameras und Mikrofonen - zu den demonstrierenden Kohlekumpeln aus der Lausitz hinüber. Die Männer sind besorgt: Werden die Jamaika-Sondierer für den Klimaschutz einen schrittweisen Kohleausstieg einleiten und wenn ja, was bedeutet das für zehntausende Arbeitsplätze in den deutschen Kohle-Revieren? Seehofer beruhigte:
"Glaubt uns, wir Bayern schauen auf Euch. Und wir schauen auch, dass es nur zu solchen Vereinbarungen kommt, die von Euch auch vertreten oder ausgehalten werden können."
"Glaubt uns, wir Bayern schauen auf Euch. Und wir schauen auch, dass es nur zu solchen Vereinbarungen kommt, die von Euch auch vertreten oder ausgehalten werden können."
Die Männer nickten, ihr Gesichtsausdruck blieb skeptisch. Ob Horst Seehofer, Claudia Roth, Wolfgang Kubicki, oder Anton Hofreiter - sie alle spazierten an diesem Wochenende zu den Demonstranten hin. Und ganz egal ob schwarz, grün oder gelb – alle wollten die gleiche Botschaft an den Mann bringen: Wir lassen Euch nicht im Stich. Dabei wurde hinter verschlossenen Türen Stunde um Stunde gerungen. Vor allem die Grünen kämpften um verbindliche Klimaschutz-Ziele:
"Weil wir zwar in vier Wochen erreichen konnten, dass endlich dann alle anerkannt haben, dass die deutschen Klimaschutzziele gelten und dass wir schrittweise aus der Kohleverstromung heraus müssen, aber die Höhe der Reduzierungsmenge, die war nach wie vor bis zum letzten Stand strittig, und auch die Frage, wie man das gesetzlich verankert", sagte Annalena Baerbock, Mitglied im Grünen Sondierungsteam und Klimaschutz-Expertin der Bundestagsfraktion.
"Weil wir zwar in vier Wochen erreichen konnten, dass endlich dann alle anerkannt haben, dass die deutschen Klimaschutzziele gelten und dass wir schrittweise aus der Kohleverstromung heraus müssen, aber die Höhe der Reduzierungsmenge, die war nach wie vor bis zum letzten Stand strittig, und auch die Frage, wie man das gesetzlich verankert", sagte Annalena Baerbock, Mitglied im Grünen Sondierungsteam und Klimaschutz-Expertin der Bundestagsfraktion.
"Die alte Wunde reißt wieder auf"
Die 36-Jährige kennt die Problematik aus ihrer politischen Heimat, sie hat ihren Wahlkreis in Brandenburg, nördlich des Braunkohlereviers in der Lausitz. Umso intensiver hatte Baerbock in den letzten Wochen am Sondierungstisch um einen Kohleausstieg gerungen - die meiste Zeit gegen den Widerstand von Union und FDP. Gab es beim Klimaschutz ein Drei gegen Eins – zulasten der Grünen? Baerbock überlegt lange:
"Also alle Themen hatten absolut wellenförmige Bewegungen. In der allerersten Sitzung sind wir relativ schnell eigentlich eingestiegen, dass wir auch schon über den Kohleausstieg diskutiert haben…"
"Also alle Themen hatten absolut wellenförmige Bewegungen. In der allerersten Sitzung sind wir relativ schnell eigentlich eingestiegen, dass wir auch schon über den Kohleausstieg diskutiert haben…"

Doch immer wieder stockten die Gespräche, neben den Themenbereichen Migration, Finanzen und Europa lieferte die Klimaschutzpolitik die heftigsten Kontroversen. Die Grünen nannten immer wieder die FDP als Haupt-Störenfried. Hinzu kam, dass die CSU beim Klimaschutz weniger blockierte als etwa beim Thema Migration, denn in Bayern stehen verglichen mit anderen deutschen Regionen kaum fossil-thermische Kraftwerke. Schon Tage vor dem Scheitern der Gespräche kursierte daher das Angebot der CDU, Kraftwerke mit sieben Gigawatt Kohleleistung abzuschalten. Annalena Baerbock:
"Ja, es gab den Vorschlag von sieben Gigawatt. Wir haben immer gesagt, acht bis zehn ist das, was wir brauchen. Hängt auch davon ab, ob man Stein- und Braunkohle mitreinzählt. Und vor allem, wird das gesetzlich verankert? Und dieser Diskussion hat sich dann einfach die FDP entzogen, so wie auch in anderen Themenfeldern."
"Ja, es gab den Vorschlag von sieben Gigawatt. Wir haben immer gesagt, acht bis zehn ist das, was wir brauchen. Hängt auch davon ab, ob man Stein- und Braunkohle mitreinzählt. Und vor allem, wird das gesetzlich verankert? Und dieser Diskussion hat sich dann einfach die FDP entzogen, so wie auch in anderen Themenfeldern."
Die alten Feindbilder wirken wieder
Am Ende - betont Baerbock, seien die Gespräche nicht am Klimaschutz gescheitert. Im Gegenteil, noch am Samstag kursierten neue Details - man wolle mit Blick auf die Klimaziele nun bis zum Jahr 2030 den Weg für einen Kohleausstieg gezielt festlegen, entweder per Gesetz oder durch Vereinbarungen mit der Kohleindustrie. Zusätzlich war im Gespräch, den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht mehr zu deckeln, sondern stärker voranzutreiben. Mit dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen liegen all diese Pläne nun auf Eis.
Seit der Nacht auf Montag dominieren im Berliner Regierungsviertel die Neuwahl-Spekulationen die Debatte - die Inhalte rücken in den Hintergrund. Und die alten Feindbilder wirken wieder. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter geißelt das Verhalten der FDP:
"Diese unverantwortliche Aktion reißt die alte Wunde wieder stärker auf."
"Diese unverantwortliche Aktion reißt die alte Wunde wieder stärker auf."
Die Grünen bleiben laut Hofreiter gesprächsbereit, die FDP legt sich nicht fest, die Union und vor allem Angela Merkel sortieren sich, die SPD setzt auf Neuwahlen. Der Ball liegt jetzt im Spielfeld des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier steht in der Verantwortung.






