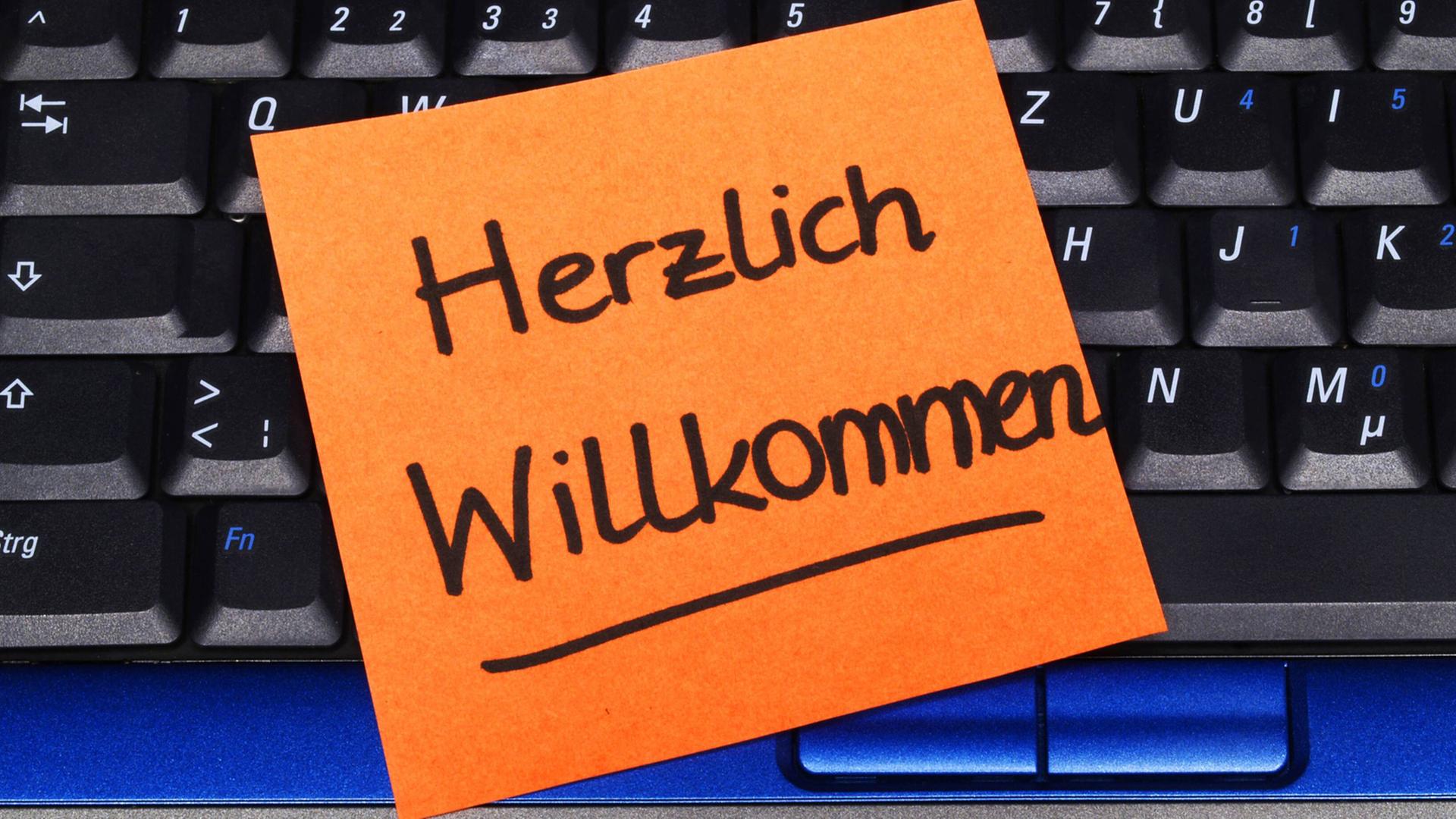
Jede Gruppierung, Gesellschaft, jede Nation erweist die Höhe ihrer Kultur am Grad, in dem sie bereit und fähig ist, das Andere, das Fremde, den Anderen, den Fremden aufzunehmen, sein Anderssein, seine Fremdheit, ja gerade auch sein Nichtverständliches zu respektieren.
Vor einiger Zeit hat eine in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Schweizer Studie unsoziales, feindseliges Verhalten gegenüber Angehörigen fremder Gruppen als tief in der Evolution verankerten Impuls ausgemacht. Wenn es daher etwas gibt, worauf ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Nation wahrhaft "stolz" sein könnte, dann auf die Ausbildung eines anti-evolutionären Impulses - als Sinn aller wahren Kultur und Humanität.
Unter dem Stichwort "Willkommenskultur" hat solche Humanität mit ihren gleichsam geöffneten Armen den vielen Flüchtlingen gegenüber sich in unserem Land auf schöne Weise offenbart. Zugleich aber verdeckt der zum Schlagwort gewordene Begriff der Willkommenskultur, wie sehr seine Inhalte und Bedeutungen uraltes Kulturgut der Menschheit sind, die in den Gesetzen der Gastfreundschaft jenen "evolutionären Impuls" der Fremdenfeindlichkeit seit je zu zähmen versuchten.
"Alle Vergehen wider die Fremden sind der Rache der Götter anheimgegeben"
In allen Religionen und Kulturen galt der Gast als heilig und ein Vergehen gegen die Gastfreundschaft zog göttliche Rache nach sich. Schon Platon hatte in seinen "Gesetzen", den "Nomoi", um die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus das Gastrecht als höchste ethische Pflicht verankert.
"Die Verpflichtung gegen die Gastfreunde muß man für unverbrüchlich heilig halten, denn alle Vergehen (...) wider die Fremden sind, verglichen mit denen, die sich auf die Mitbürger beziehen, in höherem Maße der Rache der Götter anheimgegeben: denn der Fremde, verlassen von Freunden und Verwandten, ist erbarmungswürdiger für Menschen und Götter."
Als schlimmste Strafe für ein Vergehen folgte die Verbannung außer Landes - in die Fremde, in die "Elende". Denn "elend" war im Wortsinn das Schicksal dessen, der aus der Gemeinschaft verstoßen war, er war schutzlos, vogelfrei.
Darum hatte er auch anderswo, außerhalb des eigenen Landes, als Schutzflehender Anspruch auf Aufnahme, ohne Ansehen seiner Schuld und jegliches Vergehen gegen einen Schutzflehenden zog die Rache der Götter nach sich. Die antiken Tragödien von Aischylos bis Sophokles berichten davon.
Mehrere Jahrhunderte später aber wird es in einem Brief des Apostels Johannes an die Hebräer heißen:
"Gastfrei zu sein, vergesset nicht; denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt."
Diese Mahnung aus dem Neuen Testament bezieht sich auf eine sehr alte Geschichte im Ersten Buch Mose und verbindet damit jüdische und christliche Nächstenliebe, denn das Originalwort für "gastfrei", wie Luther hier übersetzt, war die schlichte Aufforderung, den Fremden zu "lieben".

Welches aber sind die Formen, in denen sich die Gastfreundschaft darstellt? Welches sind ihre Gesetze? Gibt es eine Rechtsform für sie?
Im 8. Buch der Metamorphosen schildert der römische Dichter Ovid, wie der Göttervater Zeus mit seinem Begleiter Merkur in sumpfigem ödem Gelände auf der Suche nach einer Herberge ist. Alle Bewohner weisen die in Menschengestalt daherkommenden Götter ab - nur ein armes, sehr altes Paar namens Philemon und Baucis öffnet den Fremden seine bescheidene Hütte, schürt das Feuer im Herd, breitet Decken für ein Lager aus, unterhält sie und tischt ihnen auf - in Ovids liebevoller Aufzählung:
"Oliven der keuschen Minerva,
Doppelgefärbte, dann herbstliche Kornelkirschen, in flüss'ge
Hefe gelegt, Endivien und Rettich, Käse und Eier,
Die man nur leicht in nicht mehr glühender Asche gewendet,
Alles in irdnen Gefäßen. (...) dann holt man vom Herde das warme
Essen; den Wein - er besitzt nicht eben ein höheres Alter -
Trägt man ein wenig beiseite: der Nachtisch erhält seine Stelle.
Da gibt's Nüsse und Feigen, vermischt mit runzligen Datteln,
Pflaumen sind da und duftende Äpfel, gebettet in weiten
Körbchen, und Trauben, von purpurnen Reben gepflückt; in der Mitte
Prangt eine glänzende Wabe von Honig. Zu allem gesellen
Freundliche Mienen sich bei und ein guter, nicht geizender Wille."
Doppelgefärbte, dann herbstliche Kornelkirschen, in flüss'ge
Hefe gelegt, Endivien und Rettich, Käse und Eier,
Die man nur leicht in nicht mehr glühender Asche gewendet,
Alles in irdnen Gefäßen. (...) dann holt man vom Herde das warme
Essen; den Wein - er besitzt nicht eben ein höheres Alter -
Trägt man ein wenig beiseite: der Nachtisch erhält seine Stelle.
Da gibt's Nüsse und Feigen, vermischt mit runzligen Datteln,
Pflaumen sind da und duftende Äpfel, gebettet in weiten
Körbchen, und Trauben, von purpurnen Reben gepflückt; in der Mitte
Prangt eine glänzende Wabe von Honig. Zu allem gesellen
Freundliche Mienen sich bei und ein guter, nicht geizender Wille."
Erst als der sich leerende Weinkrug sich immer neu füllt, bemerken die beiden Alten das Wunder und erkennen die göttlichen Gäste. Diese überzeugen ihre Gastgeber, mit ihnen die Hütte zu verlassen, denn der ganze Ort mit seinen Bewohnern soll zur Strafe für ihre Abweisung im Sumpf versinken, mit Ausnahme der Hütte der beiden gastfreundlichen Alten. Diese verwandelt sich in einen Tempel, in dem Philemon und Baucis bis zu ihrem und - wie sie sich wünschen dürfen - gleichzeitigen Lebensende Dienst tun dürfen.
Werte, die unser Verhältnis zum Anderen regeln
In diesem Mythos, den Ovid etwa zu Beginn unserer Zeitenwende erzählt, sind alle Implikationen der Gastfreundschaft enthalten, die seit Menschengedenken bis heute Geltung haben. Es sind die ungeschriebenen Gesetze des menschlichen Miteinanders - Werte, die in allen Kulturen, allen Religionen, den polytheistischen wie den monotheistischen, vorhanden sind. Sie regeln nicht nur unser Verhältnis zu sozial entwickelter Gastlichkeit, die wir Freunden und Auserwählten entgegen bringen. Sie regeln primär unser Verhältnis zum Anderen, zum Fremden, der Herberge, vorübergehende Aufnahme oder nur Ansprache sucht. Das heißt, in allen Formen der Gemeinschaft und des Umgangs mit dem Fremden wirken die alten Archaismen der Gastfreundschaft fort, die bis heute ihr wesentlicher, sei es konkreter, sei es metaphorischer Inhalt sind: Wärme, Bewirtung, Obdach und Schutz, ein Lager und Aufnahme in die Gemeinschaft, ins menschliche Gespräch.
Auch die Etymologie hat diese archaischen Wurzeln bewahrt, in denen sich sowohl jener evolutionäre Impuls der Abwehr wie zugleich auch seine anti-evolutionäre Überwindung reflektiert: Denn "hostis" bedeutet im Lateinischen ebenso "Feind" wie "Gast", alle Bildungen und Ableitungen wie Hospitalität als Gastfreundschaft einerseits und Hostilität als Feindseligkeit andererseits entstammen demselben indogermanischen Wortstamm. In ihm ist jenes Doppelte, Zweischneidige bewahrt, das jede Ankunft eines Fremden, Unbekannten fragen lässt: Kommt er als Feind oder kommt er als Freund? Nehmen wir ihn auf als Gast, entschärfen wir die möglicherweise ungünstige Antwort, können diese im besten Fall gar in eine positive verwandeln. Beide Parteien gehen ein Risiko ein, sind darin einander verbunden.
Der algerisch-jüdische Philosoph Jaques Derrida hat in seinen Vorlesungen über die Gastfreundschaft diese Verbindung als "Geiselhaft" beschrieben, in die Gastgeber und Gast einander nehmen durch die unausgesprochene Verpflichtung, die sie wechselseitig in diesem Verhältnis, einem mehr oder weniger freiwilligen Bündnis, eingehen. Auch dies spiegelt sich wider in der Etymologie: Im Französischen bedeutet hôte, jener selben Sprachfamilie entstammend, zugleich Gastgeber und Gast. Sowohl möglicher Gewinn wie alles denkbare Konfliktpotential gründen daher in dieser Gastbeziehung selbst.
"Geiselhaft" von Gast und Gastgeber
Albert Camus hat in seiner 1957 erschienenen Erzählung L'Hôte, im Deutschen Der Gast, einen solchen Konflikt dargestellt, jene unauflösliche "Geiselhaft", in die Gast und Gastgeber wechselseitig zu geraten vermögen, sowie sie dieses Verhältnis, eingehen - ob gewollt oder nicht. Die Handlung spielt in den Unruhen kurz vor dem algerischen Unabhängigkeitskrieg, dem Camus mit zwiespältigem Engagement für die Sache der arabischen Algerier begegnete.

Einem aus Frankreich stammenden Lehrer namens Daru wird von der Kolonialbehörde ein verhafteter Araber übergeben, der in einer Familienfehde seinen Vetter umgebracht hat. Der Lehrer soll ihn für eine Nacht beherbergen und anderntags der Polizei im nächsten Dorf ausliefern. Gegen seinen Willen muss der Lehrer sich der Order unterziehen und den Fremden, mit dem er sich nur über Gesten verständigen kann, aufnehmen. In Angst und Misstrauen, vor allem seitens des Lehrers, verbringen beide die Nacht. Vergebens hofft Daru, dass der Araber fliehen möge, um ihn so von dem Auslieferungsauftrag zu befreien. Am anderen Morgen brechen sie beide in Richtung des genannten Dorfes auf. An einer Weggabelung verabschiedet der Lehrer den Gast, indem er ihm bedeutet, dass der eine Weg zurück zu den Nomaden in die Freiheit führt und der andere zu der Polizeibehörde, die ihn dem Gericht ausliefern wird. Der Araber - als Namenloser gleichsam ein Stellvertreter alles Fremden - möchte ihm noch etwas zu verstehen geben, aber der Lehrer macht kehrt, und als er sich später noch einmal umdreht, sieht er den Araber auf dem Weg zur Polizei.
Nicht nur das widerstrebende Verhalten des Lehrers, der nicht bereit ist, den Gast trotz seines Verbrechens auszuliefern - auch das Verhalten des Arabers folgt aller kulturellen Differenz zum Trotz dem gleichen ungeschriebenen Gesetz der Gastfreundschaft: Hätte der Araber den Weg in die Freiheit eingeschlagen, hätte er seinen Gastgeber, der bereits aufgrund seines Widerstrebens sich bei dem Gendarmen verdächtig gemacht hat, in ernsthafte Gefahr gebracht. Dass die Gefahr ihm ebenso von anderer Seite droht, wird bei Darus Rückkehr deutlich, als er auf der Tafel die Worte liest:
"Du hast unseren Bruder ausgeliefert. Das wirst du büßen."
Das Bündnis auf Zeit, die Geiselhaft, die das Gastverhältnis prägt, führt indes auf eine noch tiefer gründende Beziehung zurück, die in Form und Begriff des Gebens, der Gabe selbst liegt, im Verhältnis dessen, der gibt, und dessen, der die Gabe annimmt, empfängt. Diese Wechselbeziehung hat wiederum der französische Ethnologe Marcel Mauss in seiner berühmten, 1925 publizierten Abhandlung Die Gabe an Stämmen im nordwestlichen Amerika untersucht.
Ein "potlatch" genanntes Ritual des Schenkens regelt dort Austausch und Macht der Stämme und ihrer Häuptlinge in einer Trias von 'geben','annehmen' und 'erwidern'. Eine Gesetzmäßigkeit, eine Verpflichtung, der sich keiner entziehen kann, es sei denn um den Preis seines Ansehens und seiner Ehre, der eigenen wie der seiner Sippe. Die unerlässliche Erwiderung des Beschenkten aber stellt sich stets als 'Überbietung' der erhaltenen Geschenke dar, womit der in Riten zelebrierte Vorgang sich tendenziell endlos fortsetzt und bis zur Zerstörung, dem Ruin der eigenen Besitztümer gehen kann - als höchstem Machtbeweis.
Jene Gegenseitigkeit, die sich der Berechenbarkeit entzieht
So fern uns heute eine solche Sitte auch erscheinen mag, zeigt sich in ihr doch ein wesentliches Element, das in allem Geben, aller Gastfreundschaft wirksam ist und überdauert: jene Gegenseitigkeit, die sich der Berechenbarkeit entzieht, die in einem nichtrationalen, nicht messbaren Element der Verschwendung, des Übermaßes liegt. Der französische Schriftsteller und Philosoph Georges Bataille nahm dieses Element auf für seine Kapitalismuskritik, der zufolge nicht der Mangel, sondern die Verschwendung jenseits rationalisierter, ausschließlich profitinteressierter Prozesse wiederzuentdecken und für eine andere ökonomische Ordnung fruchtbar zu machen sei.
Doch nicht erst die Erwiderung der Gastfreundschaft, die ja zunächst auch eine Art Geschenk darstellt, sondern schon ihre Gabe an den Gast als solche kann aufgrund des Sakrosankten, das dem Gesetz innewohnt, selbstzerstörerische Züge annehmen. Dann, wenn der Gastgeber bereit ist, dem Gast nicht nur seine materiellen Besitztümer zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Ehre seiner Nächsten, Frauen oder Töchter, zu opfern. Diese in unseren Augen empörende Version wird im Alten Testament erzählt, als Lot in Sodom zwei Fremde aufnimmt und von den verderbten Bewohnern zu ihrer Herausgabe aufgefordert wird. Dass die beiden Fremden Engel sind, göttliche Boten, die ihm den Untergang von Sodom ankündigen sollen, erfährt er erst später. Lot, dem seine Gäste heiliger sind als seine weiblichen Angehörigen, bietet der erregten Menge stattdessen seine halberwachsenen Töchter an, damit sie mit ihnen nach Belieben verfahre, in vollem Wissen, dass dies Gewalttätigkeit und Missbrauch bedeutet.
Der französische Schriftsteller und Maler Pierre Klossowski hat diesen unerträglichen Gedanken in seinem in den fünfziger Jahren erschienenen Roman Die Gesetze der Gastfreundschaft in gewisser Weise weiter gesponnen. Über dem Bett im Fremdenzimmer hat der Hausherr in einem Rahmen die Gesetze der Gastfreundschaft angebracht, die in der Aufforderung münden, sich seiner Frau zu "bedienen".
Die Metapher des "Eindringens" - ins Haus, in die Gastfreundschaft, in die unschuldigen Frauen - erhält hier, wie Jacques Derrida diese Anordnung in seinem philosophischen Kontext analysiert, ihre sexuelle Konnotation zurück. Derrida hat damit zugleich die Dimension der unendlichen Offenheit des Gastfreundschaftsverhältnisses reflektiert, seinen Todesabgrund - den Skandal, der nicht erst hier, sondern bereits mit der in den Fremden "eindringenden" Frage beginnt. Oder anders, er hat analysiert, wie der Skandal, den wir in solcher Pervertierung empfinden - von der untergeordneten, zum Objekt degradierten Stellung der Frau oder auch der Sklaven einmal abgesehen -, bereits in der ersten Begegnung mit dem Fremden selber liegt, mit der Frage nach Herkunft und Namen, sprich seiner Identität.
Verschwendung, Verausgabung, Überbietung
Das Beispiel zeigt, dass das nicht rationalisierbare Element, das jedes Gastverhältnis prägt, als Element der Verschwendung, der Verausgabung, der Überbietung, ja auch des Opfers, sich nach der einen oder anderen Seite zu kehren vermag: zu Selbstaufgabe und Zerstörung materieller und menschlicher sowie tierischer Besitztümer auf der einen Seite - und zu purer Freundschaft, Generosität und Nächstenliebe auf der anderen. Es berührt das Thema von Dank und Dankbarkeit, die wiederum auf beiden Seiten wirksam sind: als Dank des Gastes an den Gastgeber wie auch dessen Erwartung der Dankbarkeit seitens des Gastes. Auch hier sind Missbrauch und in der Folge Ehrverlust, Ächtung und Rache möglich.
In Timon von Athen hat Shakespeare vor gut 400 Jahren ein solches Drama der Undankbarkeit inszeniert: Dort führt die maßlose Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit Timons, eines reichen, angesehenen Athener Bürgers, zu seinem Ruin. Als er sich in der eigenen Not an seine alten Schuldner wendet, in der Hoffnung, dass sie ihm nun Dank erweisen und beistehen werden, ziehen die sich alle zurück. Seine Rache fällt so ähnlich hart, bitter und gnadenlos aus wie jene in Lots und Ovids Geschichte. Nicht nur wird Timon bei einem Festgelage, zu dem er noch einmal einlädt, den undankbaren Gästen dampfendes Wasser und Steine vorsetzen, sondern auch den Feldherrn Alkibiades bei seinem Feldzug gegen Athen unterstützen. Der vermeintliche Philanthrop Timon hat sich am Ende in einen rachsüchtigen Misanthrop verwandelt, maßlos als der eine wie der andere.
Anders geartet: die fast zum Klischee geronnene Gastfreundlichkeit, für die man besonders östliche Völker rühmt, Turkmenen, Georgier, Kaukasier überhaupt, aber auch Beduinen und Nomaden. Bei aller Verklärung hat dies auch damit zu tun, dass die Tauschwertrationalität des westlichen Kapitalismus, die alles, auch den menschlichen Verkehr, ihrer kalten Logik unterzieht, dort nicht oder noch nicht beherrschend wurde und die alten Traditionen und Riten nicht gänzlich verdrängen konnte
Ein schönes, in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück reichendes Zeugnis ist dafür Tolstois Roman Hadschi Murat, der mit seiner legendären, historisch verbürgten Titelgestalt des muslimisch-kaukasischen Kämpfers zwischen Russen und dem eigenen Volk viel über fremde Sitten und Bräuche erzählt. Auch hier gelten die ungeschriebenen, immer religiös fundierten Gesetze des Gastrechts.
Zugleich erfahren sie eine Vertiefung oder Erweiterung, wenn Hadschi Murat, als Gast bei den gegnerischen Russen, zu denen er zum Schein übergelaufen ist, sich bereits während seines Aufenthalts "revanchiert". Lobt beispielsweise ein Anwesender einen Gegenstand, den er bei sich hat, so schenkt Hadschi Murat ihm diesen sogleich. Denn "Kunak," der Gast, heißt im Kaukasischen immer auch Freund - selbst wenn das Geschehen im Feindeslager spielt. Der kleine Sohn des russisch‑fürstlichen Gastgebers erhält so Hadschi Murats Säbel zum Geschenk, die Dame eines anderen Hauses seinen weißen Überwurf. Eine Variation dieser Sitte hat sich bis heute in Georgien erhalten, wo der zum Festmahl Eingeladene sich auch noch ein Geschenk aussuchen darf Den Georgiern gilt der Gast als "Geschenk Gottes", entsprechend schuldet der Gastgeber ihm Dank dafür, dass er ihn aufnehmen und bewirten darf.
Bedürfnis nach einer anderen Form des Austauschs - auch in der westlichen Gesellschaft
In all diesen überschwänglich sich darbietenden Formen der Gastfreundschaft, in ihrer nichtrationalen, scheinbar interesselosen Gegenseitigkeit hat sich ein Wesensmoment jener kredit- und zinslosen Verschwendung erhalten, deren Verlust früher oder später auch diesen Gesellschaften droht, sofern auch sie von der Globalisierung erfasst werden und die ökonomischen Prinzipien des Mehrwerts mit der sie treibenden Gier die Oberhand gewinnen. Dass indessen auch in unserer reichen westlichen Gesellschaft das Bedürfnis nach einer anderen Form des Austauschs, im materiellen wie metaphorischen Sinn, nicht gänzlich versiegt ist, machte der buchstäblich grenzenlose Empfang der Flüchtlinge deutlich.
Was sich hier nicht zuletzt auch als Nächstenliebe manifestiert, ist jedoch keineswegs nur christliches Erbe, sondern prägt Judentum und Islam gleichermaßen. Jene Mahnung aus dem Hebräerbrief drückte dies bereits aus. Sie erinnert an eine andere biblische Episode, die der mit Lot und Sodom unmittelbar voraus geht. Hier ist es Abraham, dem bei Mamre die Fremden begegnen, deren Göttlichkeit er zunächst nicht erkennt. Doch ist es in Wahrheit sein Gott, der HERR selbst, der ihm, Abraham, in Gestalt dreier fremder Männer erscheint und die wechselnde Ansprache im Plural oder Singular erklärt:
"Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße waschen, und laßt euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, daß ihr euer Herz labet; danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast.
Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß feinsten Mehls, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes gutes Kalb und gab's dem Knechte; der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen."
Was folgt, ist nichts Geringeres als die Ankündigung eines Sohnes, den Sara trotz ihres hohen Alters noch gebären soll: Isaak, den Stammvater des jüdischen Volks, während sein Halbbruder Ismael, Abrahams erstgeborener Sohn, als wichtigster Prophet in den Islam einging. In der 9. Sure des Korans wird wiederum das Almosengeben zur heiligen Pflicht gemacht und in all diesen Riten und Pflichten, die im Islam zum Teil juridische Form annehmen, sind Demut und Ehrerbietung gegenüber dem Fremden, dem "Sohn des Weges", wie es im Koran auch heißt, ihr charakteristischer Teil.
Zahlreiche Beispiele aus Bibel, Neuem wie Altem Testament, sowie dem Koran und den Hadithen, aus Sitten und Gebräuchen ließen sich noch anführen. Etwa der schöne jüdische Brauch, am Sederabend, dem Vorabend von Pessach, am Tisch einen Platz und ein Gedeck für einen Gast freizuhalten - stellvertretend für den Propheten Elia, der als Ankündiger des Messias erwartet wird. In Joseph Roths Erzählung Hiob wird am Sederabend der verschollen geglaubte Sohn des ebenfalls zur Feier eingeladenen Nachbarn zurückkehren, als unerkannter Fremder diesen Platz einnehmen, bevor er sein Schicksal erzählt und sich zu erkennen gibt. Ebenso zahlreich die Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus zur Barmherzigkeit und Gastfreundschaft mahnt, gerade auch den Ärmsten und Geringsten gegenüber. Bei Matthäus verkündet er das "Weltgericht", wo der göttliche Richter die Gerechten zu seiner Rechten setzen wird mit den Worten:
"Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Und wenn dann die Gerechten fragen, wann das gewesen wäre, wird er antworten: Wahrlich, ich sage euch: 'Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mit getan.'"
Nicht zu vergessen die Weihnachtsgeschichte: die vergebliche Herbergssuche des Flüchtlingspaares Maria und Joseph, die in einem Stall endet, mit dem jüdischen Baby, dem neugeborenen Jesus in der Krippe, welche gleichsam die Wiege des Christentums ist. Die Wurzeln der sogenannten christlichen Nächstenliebe sind, wie all diese Geschichten zeigen, weit älter als das Christentum selbst. Ihre säkulare Form gewann sie im Kategorischen Imperativ von Kant. Doch schon in dem uralten Gastrecht, wie es bei Platon und hier in den großen Religionen erscheint, wird sein ziviler, menschenrechtlicher Kern sichtbar. Denn Gastrecht ist immer auch Menschenrecht.
Das mag umso mehr erstaunen, als wir erst seit der Französischen Revolution den Anspruch auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gewonnen und erst nach dem barbarischen Countdown des 20. Jahrhunderts die Charta der Menschenrechte in unserem Gesetz verankert haben, deren Geltung wir auch für andere Staaten fordern
Immanuel Kant, der Philosoph der Aufklärung, war es, der 1795, also wenige Jahre nach der Französischen Revolution, in seiner Schrift Zum ewigen Frieden diesen zivilen menschenrechtlichen Kern der Hospitalität aufgriff, um ihn in einer republikanisch-völkerrechtlichen Verfassung zu begründen und zu entwickeln. Deren weitreichende Forderungen und Konsequenzen als Garanten für einen Weltfrieden sind bis heute nicht eingeholt und wirken aktueller denn je. Ausdrücklich befreit Kant die Hospitalität von religiösen oder philanthropisch-vagen Anstrichen, begründet vielmehr mit ihr ein Weltbürgerrecht.
"Es ist hier (...) nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht des Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen."
Kant: "Besuchsrecht" ohne Ansehen von Hautfarbe, Religion und Rang
Kant betont, dass es sich bei solcher Hospitalität nicht um ein Gastrecht, sondern lediglich um ein Besuchsrecht handle,
"welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein, mehr Recht hat, als der andere."
In diesem "Besuchsrecht", das Kant im Geiste der Aufklärung und der revolutionären Ideale unter die Gesetze der Hospitalität fasst, sind auch alle Implikationen der Gastfreundschaft enthalten, die dem Fremden, dem Unbekannten als solchem gelten, ohne Ansehen von Hautfarbe, Religion und Rang.

Die Betonung des "Rechts", unabhängig von jenen zwiespältigen Ansprüchen der Gastfreundschaft, führt indessen noch zu einem tieferen Gehalt, den es im Sinne jenes Weltfriedens, den Kant als Ziel visiert, weiter aufzuklären gilt. Denn unausgesprochen etabliert er mit seinem Gesetz der Hospitalität zugleich ein Daseinsrecht für jeden Menschen, wer es auch sei, mit all den Konsequenzen, die das heute hat - ein Recht, das allein in der Tatsache da zu sein liegt. Das berührt die Menschenwürde, die wir im ersten Paragraphen des Grundgesetzes verankert haben, und die kein Vergehen, welcher Art auch immer, ihm nehmen kann. Auch wenn bei Kant all dies nicht zur Sprache kommt: Eine zeitgenössische gesellschaftliche Konsequenz aus seiner Philosophie wäre die Abschaffung der Todesstrafe, eine andere das "bedingungslose Grundeinkommen".
Wo aber, um auf die Geste der geöffneten Hand, der ausgebreiteten Arme zurückzukommen - wo beginnen Fremdheit und Andersheit? Erst im fremden Land, mit fremder Sprache? Oder schon beim Nebenstehenden in der Straßenbahn?
"Nichts ist fremdartiger und fremder als der Andere",
sagte der Philosoph Emmanuel Lévinas. Also der Mitmensch. Jeder also dem Nächsten ein Fremder und im schönsten Falle ein Gastfreund, ein Gast. Nur in dieser Perspektive lässt sich jener evolutionär-feindselige Impuls zu einer menschenwürdigen Haltung umbilden, die seit je in aller Gastfreundschaft bewahrt ist, und deren Grenzen und Bestimmungen jenseits von quantitativen "Obergrenzen" immer neu auszuhandeln sind - im Bewusstsein, dass Gerechtigkeit, Weltfrieden und Menschenrecht auch jenes nichtrationalen, liebenden Überschusses bedürfen, der dem nie endenden work in progress zu wahrer Humanität seine Triebkraft verleiht.
Marleen Stoessel lebt als freie Autorin, Essayistin und Kulturpublizistin in Berlin. Sie veröffentlichte zuletzt den kulturgeschichtlichen Essay "Lob des Lachens. Eine Schelmengeschichte des Humors" (2008/2015).




